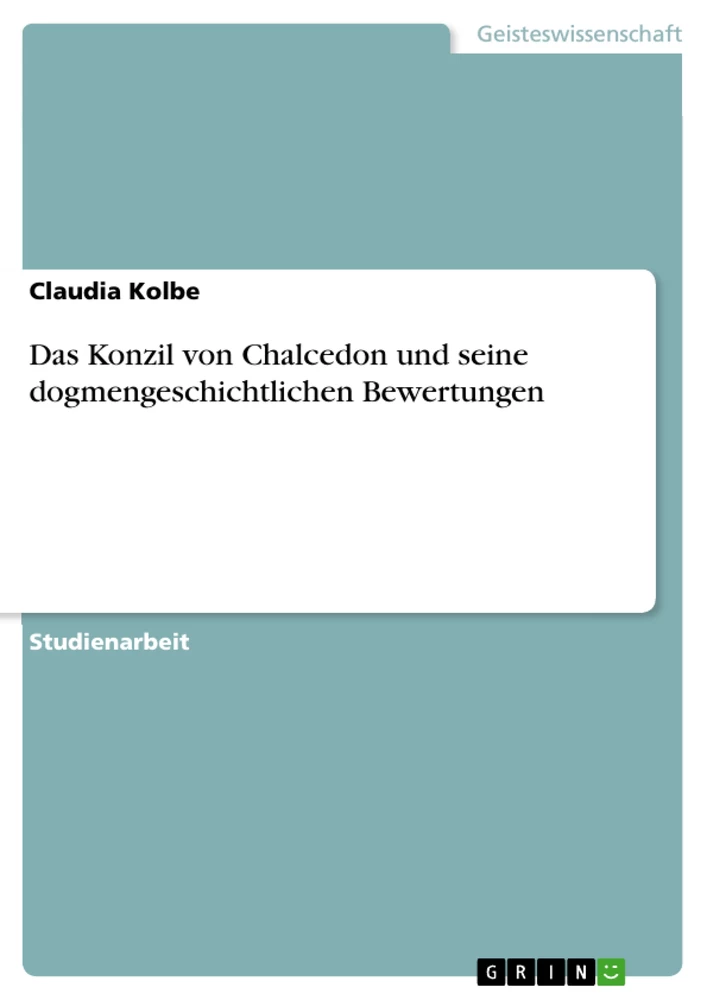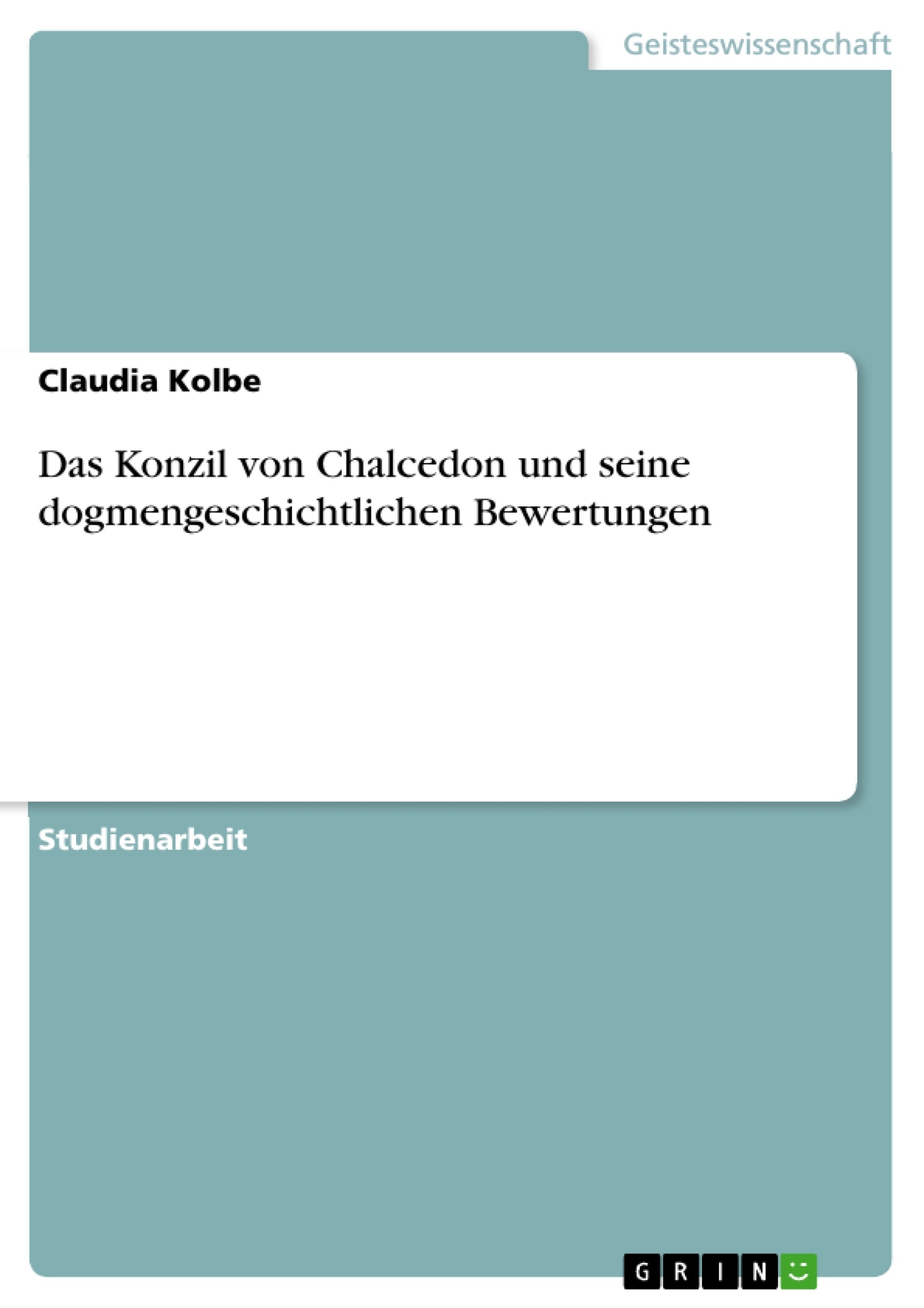Die Frage nach dem Zu- und Miteinander der göttlichen und menschlichen Natur der Person Jesu Christi hat schon immer viele Theologen beschäftigt. Vor allem im 4. und 5. Jahrhundert stand sie im Mittelpunkt theologischer Streitigkeiten. Dabei kamen die kirchlichen Würdenträger in arge Schwierigkeiten: Wollten sie doch das Unmögliche ermöglichen, einerseits den Glauben an einen einzigen Gott beizubehalten, andererseits aber auch Jesus "göttliche Attribute" zuzuschreiben.
Im Zentrum der Auseinandersetzungen stand demnach die Frage nach dem Verhältnis Jesu Christi zum himmlischen Vater. Die Theologen versuchten mit den Begriffen "wesenseins" und "wesensähnlich" dieses innertrinitarische Verhältnis zu beschreiben. „Die Einheit von Gott und Mensch in Jesus Christus [darzustellen war] das abschließende und krönende Thema der Christologie“ (Ohlig, Karl-Heinz: Christologie, Bd. 1. Graz, Wien, Köln: 1989), welches auf dem Konzil von Chalcedon diskutiert wurde. Hinter meist sehr ähnlichen Begriffen verbargen sich einander entgegengesetzte Grundauffassungen des Christentums. Es ging insofern um nichts weniger als um die Aufrechterhaltung eines einheitlichen Verständnisses von Jesus und damit gleichsam um einen stabilen Glauben der Christen an Jesus Christus.
Die Väter von Chalcedon hatten nun geglaubt mit ihrer Formulierung „[..]in duabus naturis [...] et in unam personam atque subsistentiam concrurrente [..]“ endlich ein Problem gelöst zu haben, „das seit 25 Jahren unabdingbar zu einer Lösung gedrängt hatte.“ Doch „ [d]ie Entwicklung verlief anders. Chalcedon wurde zum Stein des Anstoßes und zum Ausgangspunkt einer Spaltung [..]“ (aus: Grillmeier, Alois: Jesus der Christus im Glauben der Kirche, Bd. 2/1. Freiburg, Basel, Wien²: 1991, S.4.), die bis heute anhält.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Das Konzil von Chalcedon
- 2.1 Der Ausgangspunkt – zwei verschiedene Schulen
- 2.1.1 Die alexandrinische Christologie
- 2.1.2 Die antiochenische Christologie
- 2.2 Das Konzil
- 2.3 Die Entscheidung
- 2.3.1 Der "Tomus Leonis"
- 2.4 Die Formel von Chalcedon
- 2.5 Weitere Entwicklungen
- 3. Beurteilungen
- 3.1 Adolf Martin Ritter
- 3.2 Wolfhart Pannenberg
- 3.2.1 Aporetik der Zweinaturenlehre
- 3.2.2 Der Gegensatz von alexandrinischer und antiochenischer Christologie und die Formel von Chalcedon
- 3.3 Eigene Beurteilung - Abschließende Worte
- 4. Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht das Konzil von Chalcedon und seine dogmengeschichtlichen Bewertungen. Ziel ist es, die Entstehung der Formel von Chalcedon im Kontext der alexandrinischen und antiochenischen Christologie zu verstehen und verschiedene theologische Perspektiven auf ihre Bedeutung und Folgen zu beleuchten.
- Die Entwicklung der christologischen Debatten im 4. und 5. Jahrhundert
- Der Gegensatz zwischen alexandrinischer und antiochenischer Christologie
- Das Konzil von Chalcedon und seine Entscheidungen
- Die Formel von Chalcedon und ihre Interpretation
- Dogmengeschichtliche Bewertungen des Konzils
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Seminararbeit ein und beschreibt die Bedeutung der Frage nach dem Verhältnis der göttlichen und menschlichen Natur Jesu Christi in der Theologie. Sie hebt die Herausforderungen hervor, vor denen die Theologen des 4. und 5. Jahrhunderts standen, und deutet auf die Kontroversen hin, die zum Konzil von Chalcedon führten. Die zentralen Begriffe „Wesenseins“ und „Wesensähnlichkeit“ werden erwähnt, sowie die Bedeutung des Konzils für ein einheitliches Verständnis von Jesus Christus und den anhaltenden Einfluss seiner Entscheidungen. Die Arbeit kündigt ihren weiteren Verlauf an.
2. Das Konzil von Chalcedon: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das Konzil von Chalcedon, beginnend mit den unterschiedlichen christologischen Schulen Alexandrien und Antiochien. Die alexandrinische Christologie, mit Vertretern wie Athanasius und Cyrill, wird als platonisch geprägt und von oben nach unten (Gott zu Mensch) ausgerichtet beschrieben. Im Gegensatz dazu steht die antiochenische Schule, die eine biblisch-aristotelische Perspektive von unten nach oben (Mensch zu Gott) vertritt, mit Vertretern wie Diodor von Tarsus, Theodor von Mopsuestia und Theodoret von Kyros. Das Kapitel beschreibt das Konzil selbst, seine Teilnehmer und den Prozess der Entscheidungsfindung, wobei der "Tomus Leonis" und die Formel von Chalcedon hervorgehoben werden. Die anhaltende Bedeutung und die Folgen des Konzils werden ebenfalls angesprochen.
3. Beurteilungen: Dieses Kapitel präsentiert verschiedene dogmengeschichtliche Bewertungen des Konzils von Chalcedon, unter anderem die Ansichten von Adolf Martin Ritter und Wolfhart Pannenberg. Die Kapitel beschreiben die Auseinandersetzungen der Theologen mit der Zweinaturenlehre und den bleibenden Herausforderungen und Debatten, die durch das Konzil ausgelöst wurden. Die Zusammenfassung dieses Abschnitts wird die verschiedenen Perspektiven und ihre Argumentationen zusammenfassen, um ein umfassendes Verständnis der unterschiedlichen Interpretationen des Konzils zu liefern.
Schlüsselwörter
Konzil von Chalcedon, Christologie, alexandrinische Christologie, antiochenische Christologie, Zweinaturenlehre, Monophysitismus, Tomus Leonis, dogmengeschichte, Adolf Martin Ritter, Wolfhart Pannenberg.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Das Konzil von Chalcedon
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das Konzil von Chalcedon (451 n. Chr.) und seine Bedeutung für die christologische Dogmengeschichte. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Formel von Chalcedon im Kontext der gegensätzlichen alexandrinischen und antiochenischen Christologie sowie auf unterschiedlichen theologischen Bewertungen des Konzils.
Welche Christologischen Schulen werden verglichen?
Die Arbeit vergleicht die alexandrinische und die antiochenische Christologie. Die alexandrinische Christologie, vertreten durch Theologen wie Athanasius und Cyrill, wird als platonisch geprägt und von oben nach unten (Gott zu Mensch) ausgerichtet beschrieben. Die antiochenische Schule, mit Vertretern wie Diodor von Tarsus, Theodor von Mopsuestia und Theodoret von Kyros, vertritt eine biblisch-aristotelische Perspektive von unten nach oben (Mensch zu Gott).
Was ist die Formel von Chalcedon und ihre Bedeutung?
Die Formel von Chalcedon ist das zentrale Ergebnis des Konzils. Sie versucht, die christologische Debatte zwischen den alexandrinischen und antiochenischen Schulen zu beenden, indem sie die Zwei-Naturen-Lehre Jesu Christi (vollkommen göttliche und vollkommen menschliche Natur in einer Person) formuliert. Die Arbeit analysiert die Entstehung und Interpretation dieser Formel.
Welche Theologen werden in der Beurteilung des Konzils herangezogen?
Die Arbeit bezieht die dogmengeschichtlichen Bewertungen von Adolf Martin Ritter und Wolfhart Pannenberg mit ein. Ihre unterschiedlichen Perspektiven auf die Zweinaturenlehre und die Formel von Chalcedon werden beleuchtet und verglichen. Die Arbeit beinhaltet auch eine eigene abschließende Beurteilung.
Welche Schlüsselthemen werden in der Seminararbeit behandelt?
Schlüsselthemen sind: die Entwicklung christologischer Debatten im 4. und 5. Jahrhundert, der Gegensatz zwischen alexandrinischer und antiochenischer Christologie, das Konzil von Chalcedon und seine Entscheidungen, die Formel von Chalcedon und ihre Interpretation, sowie dogmengeschichtliche Bewertungen des Konzils. Die Begriffe „Wesenseins“ und „Wesensähnlichkeit“ spielen eine wichtige Rolle.
Welche Kapitel enthält die Arbeit und was ist ihr Inhalt?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel über das Konzil von Chalcedon (inklusive der Beschreibung der beteiligten Schulen und des "Tomus Leonis"), ein Kapitel mit verschiedenen Beurteilungen des Konzils und eine Bibliographie. Die Einleitung stellt die Thematik vor, die Kapitelzusammenfassungen bieten detaillierte Einblicke in den Inhalt jedes Kapitels.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Konzil von Chalcedon, Christologie, alexandrinische Christologie, antiochenische Christologie, Zweinaturenlehre, Monophysitismus, Tomus Leonis, Dogmengeschichte, Adolf Martin Ritter, Wolfhart Pannenberg.
- Quote paper
- Claudia Kolbe (Author), 2002, Das Konzil von Chalcedon und seine dogmengeschichtlichen Bewertungen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62829