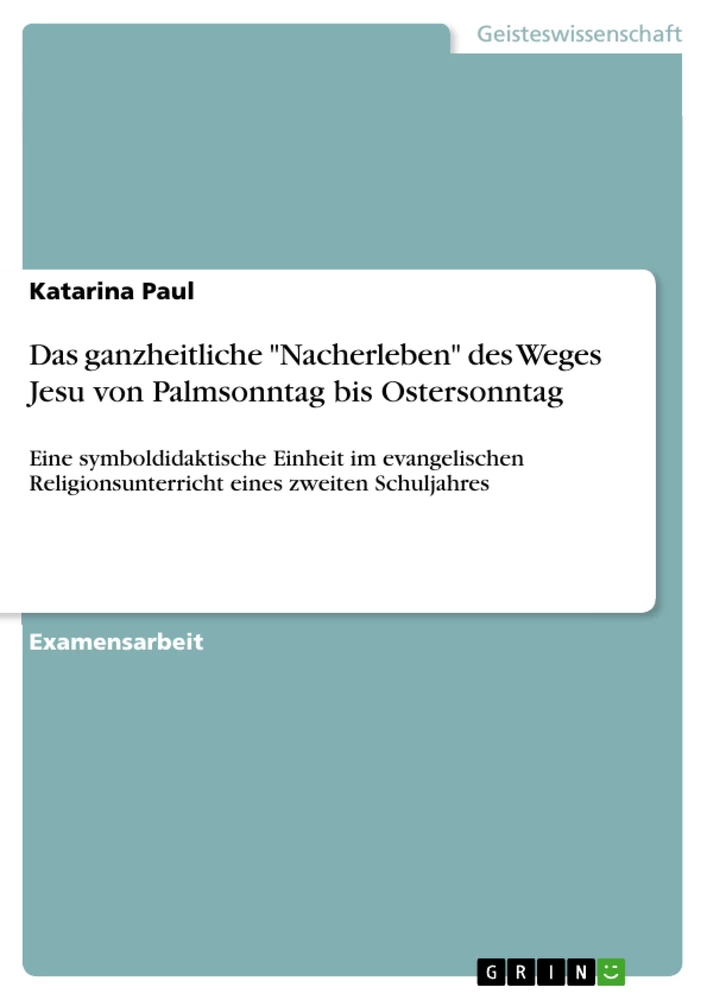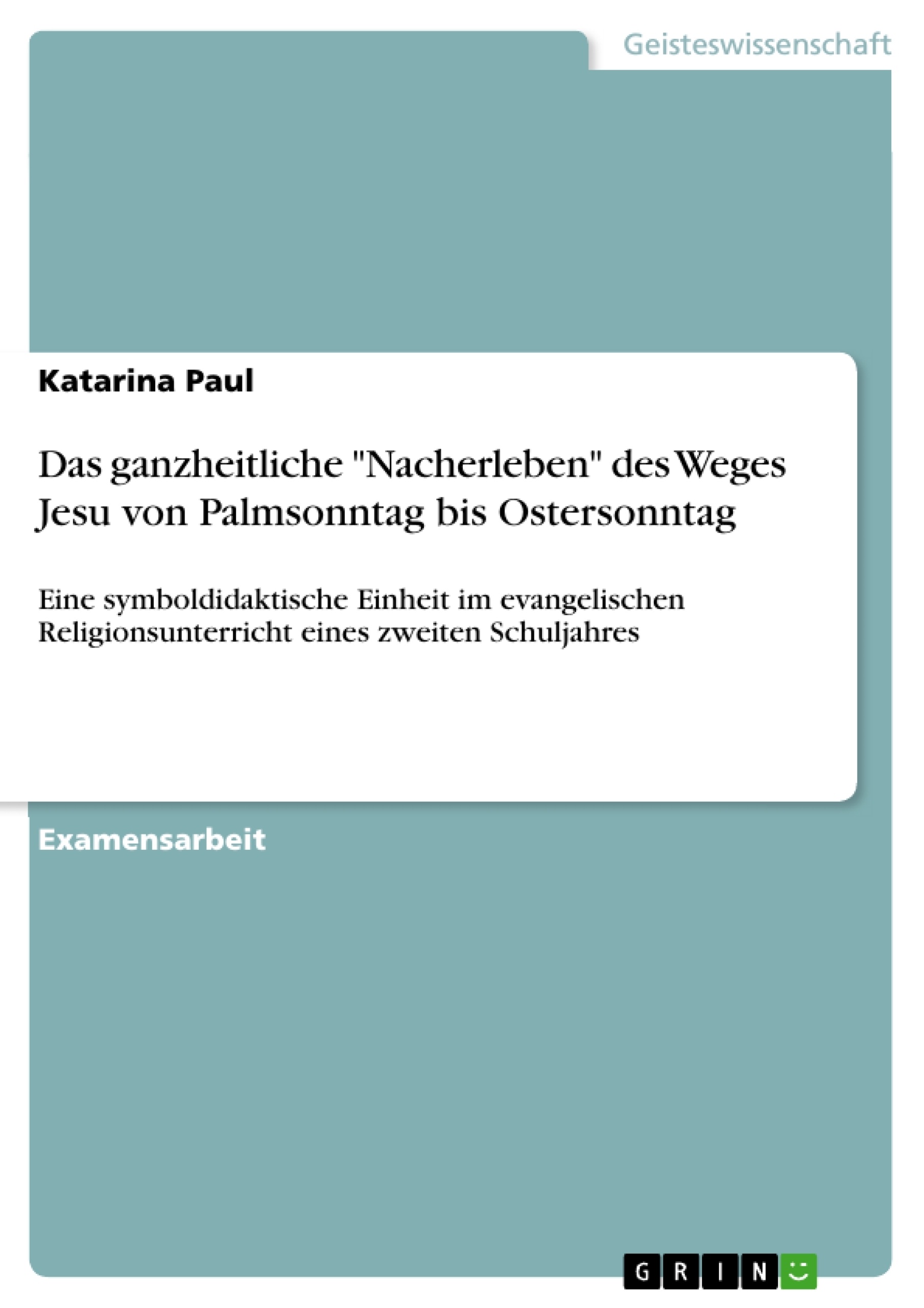Ostern ist das wichtigste christliche Fest. Die Botschaft vom Kreuz und der Auferstehung sind der Ursprung und Grundlage des christlichen Glaubens. Denn die „Sache Jesu“ geht weiter.
Die Passionszeit ist im Kirchenjahr besonders ritualisiert. Die Sonntage vor Ostern haben eigene Namen und in der Karwoche wird die Passion Christi verdichtet, wobei dem Karfreitag als dem Kreuzigungs- und Todestag Jesu eine besondere Bedeutung innewohnt. In der Unterrichtseinheit soll zuerst die biblische Passionsgeschichte vom Einzug in Jerusalem, von der Tempelreinigung, von dem Abendmahl, von Gethsemane, vom Verrat, von der Gefangennahme, vom Verhör, von der Verurteilung bis zur Kreuzigung und Grablegung erfahren und „nacherlebt“ werden.
Der Begriff „nacherlebt“ steht nicht im Sinne von miterleben, sondern soll in der gesamten pädagogischen Prüfungsarbeit durch die Wörter mit- empfunden, nach- empfunden sowie nach- gedacht und mit- gedacht definiert werden.
Die Erfahrungen von Angst und Verzweiflung, Einsamkeit und Verlassenheit, Spott und Hohn sowie Verstörung und Hoffnungslosigkeit sind Erfahrungen, die an die Erfahrungswelt der Schüler anknüpfen und aufbereitet werden können.
Auf dieser Basis können die Schüler das Osterereignis, die Botschaft über die Auferstehung Jesu und die Hoffnung und Freude über das damalige Geschehen verstehen lernen.
Welche Bedeutung hat das christliche Fest Ostern für eine zweite Grundschulklasse? Ostern ist den Schülern als ein Fest mit vielfältigen Bräuchen bekannt, daher ist es für mich wichtig die biblische Erzählung und die volkstümlichen Osterbräuche voneinander abzugrenzen.
Durch Symbole möchte ich den Schülern helfen die biblischen Erzählungen als Glaubenstexte zu verstehen. Deswegen ist es mir von großer Wichtigkeit, dass die Schüler mit allen Sinnen in die Geschichte einbringen können, damit sie sich ein eigenes Bild machen und so ihren eigenen Glauben ausbilden können.
Daher stellen sich mir folgende Fragen:
1. Ist die Behandlung der Thematik „Der Weg Jesu von Palmsonntag bis Ostersonntag“ für ein zweites Schuljahr geeignet?
2. Ist die ganzheitlich symbolische Methode für das Thema geeignet und lässt sie genug Offenheit für eine eigene Glaubensentwicklung?
Die Fragen werde ich in meiner Arbeit aufgreifen und ausführlich diskutieren, um in der Gesamtreflexion Antworten darauf geben zu können.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung und ausgehende Fragestellung
- II Konzeption der Unterrichtseinheit - Didaktische Strukturanalyse -
- 1. Lernvoraussetzungen der Schüler
- 1.1 Allgemeine Lernvoraussetzungen
- 1.1.1 der Grundschule Röddenau
- 1.1.2 der Lerngruppe
- 1.2 Spezielle Lernvoraussetzungen
- 1.2.1 Lernausgangslage
- 1.2.2 Religiöse Entwicklung
- 1.1 Allgemeine Lernvoraussetzungen
- 2. Sachanalyse und Exegese
- 2.1 Passion und Auferstehung Jesu
- 2.2 Die Religionspädagogische Praxis
- 2.3 Symbole
- 3. Didaktische Erschließung und Begründung
- 3.1 Allgemeiner didaktischer Begründungszusammenhang
- 3.2 Ganzheitlichkeit
- 3.3 Symboldidaktik
- 3.4 Bezug der UE zum Rahmenplan Grundschule
- 4. Methodische Konzeption
- 4.1 Allgemeine methodische Vorüberlegungen
- 4.2 Ausgewählte Unterrichtsmethoden und Medien
- 5. Allgemeine Lernziele der Unterrichtseinheit
- 1. Lernvoraussetzungen der Schüler
- III Dokumentation der Unterrichtpraxis
- 1. Einführung
- 2. Übersicht der geplanten Unterrichtseinheit
- 3. Ausführliche Darstellung der 9. Sequenz
- 3.1 Didaktische und methodische Vorüberlegungen
- 3.2 Lernziele
- 3.3 Tatsächlicher Verlauf und Reflexion
- 3.3.1 Reflexion allgemeiner Bedingungen
- 3.3.2 Reflexion der Versammlungs- bzw. Sammlungsphase
- 3.3.3 Reflexion der Anschauungsphase
- 3.3.4 Reflexion der Deutungsphase und Schlussphase
- IV Gesamtreflexion der Unterrichtseinheit
- V Ausblick auf weitere Umgangsmöglichkeiten mit dem Thema und der Methode
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Eignung einer symboldidaktischen Unterrichtseinheit zum Thema „Der Weg Jesu von Palmsonntag bis Ostersonntag“ für eine zweite Klasse der Grundschule. Ziel ist es, die biblischen Erzählungen kindgerecht und auf ganzheitliche Weise zu vermitteln, dabei das Symbolverständnis der Schüler zu fördern und ihnen Raum für eine eigene Glaubensentwicklung zu geben. Die Arbeit analysiert die didaktischen und methodischen Aspekte des gewählten Ansatzes.
- Kindgemäße Vermittlung der Passions- und Ostergeschichte
- Förderung des Symbolverständnisses bei Grundschulkindern
- Ganzheitlicher und symbolischer Unterrichtsansatz
- Raum für individuelle Glaubensentwicklung
- Bewertung der Eignung der Religionspädagogischen Praxis (RPP)
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung und ausgehende Fragestellung: Die Einleitung stellt die Thematik Passion und Ostern als geeignet für die Auseinandersetzung mit den Gedanken und Erfahrungen von Grundschulkindern dar, da die Erzählungen spannende und lebensnahe Aspekte enthalten. Die Arbeit untersucht die Eignung der Thematik für eine zweite Klasse und die Anwendbarkeit eines ganzheitlich-symbolischen Ansatzes, der den Schülern ermöglicht, die biblischen Erzählungen mit allen Sinnen zu erfassen und einen eigenen Glauben zu entwickeln. Die zentralen Forschungsfragen betreffen die Altersgerechtigkeit des Themas und die Offenheit des gewählten Ansatzes für die individuelle Glaubensentwicklung.
II Konzeption der Unterrichtseinheit - Didaktische Strukturanalyse: Dieses Kapitel beschreibt die didaktische Planung der Unterrichtseinheit. Es analysiert die Lernvoraussetzungen der Schüler, sowohl allgemeine als auch spezifische Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der Religion. Eine ausführliche Sachanalyse und Exegese der Passions- und Ostergeschichte aus dem Markusevangelium bildet die Grundlage für die didaktische Erschließung. Der Kapitel beschreibt den gewählten ganzheitlich-symbolischen Ansatz, die methodische Konzeption basierend auf der Religionspädagogischen Praxis (RPP), und formuliert die übergeordneten Lernziele der Unterrichtseinheit.
III Dokumentation der Unterrichtpraxis: Dieses Kapitel dokumentiert den tatsächlichen Ablauf der Unterrichtseinheit über sechs Wochen. Es gibt einen Überblick über den geplanten Stundenverlauf und eine detaillierte Beschreibung der neunten Sequenz, welche die Auferstehung behandelt. Die detaillierte Darstellung beinhaltet didaktisch-methodische Vorüberlegungen, Lernziele, den tatsächlichen Verlauf und eine Reflexion der einzelnen Unterrichtsphasen (Sammlung, Anschauung, Deutung, Gestaltung).
IV Gesamtreflexion der Unterrichtseinheit: Dieses Kapitel bietet eine umfassende Reflexion der durchgeführten Unterrichtseinheit. Es bewertet die Eignung der Thematik "Der Weg Jesu von Palmsonntag bis Ostersonntag" für eine zweite Grundschulklasse und analysiert die Wirksamkeit des ganzheitlich-symbolischen Ansatzes im Hinblick auf die Förderung des Symbolverständnisses und die Ermöglichung einer individuellen Glaubensentwicklung. Die Reflexion beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit den Stärken und Schwächen der Religionspädagogischen Praxis (RPP).
V Ausblick auf weitere Umgangsmöglichkeiten mit dem Thema und der Methode: Das Kapitel gibt einen Ausblick auf weitere Möglichkeiten, das Thema Passion und Ostern im Religionsunterricht zu behandeln und die Religionspädagogische Praxis (RPP) einzusetzen. Es schlägt vor, die Thematik in den Folgejahren aufzugreifen und zu vertiefen, den Fokus auf den Weitergang des christlichen Glaubens zu legen und einzelne Stationen der Passionsgeschichte intensiver zu bearbeiten.
Schlüsselwörter
Evangelischer Religionsunterricht, Grundschule, Didaktik, Methodik, Religionspädagogische Praxis (RPP), Symboldidaktik, Passion, Ostern, Auferstehung Jesu, ganzheitliches Lernen, Symbolverständnis, Glaubensentwicklung, kindgemäße Vermittlung, biblische Erzählungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Der Weg Jesu von Palmsonntag bis Ostersonntag - Eine symboldidaktische Unterrichtseinheit für die Grundschule"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Eignung einer symboldidaktischen Unterrichtseinheit zum Thema "Der Weg Jesu von Palmsonntag bis Ostersonntag" für eine zweite Klasse der Grundschule. Es geht darum, biblische Erzählungen kindgerecht und ganzheitlich zu vermitteln, das Symbolverständnis der Schüler zu fördern und ihnen Raum für eine eigene Glaubensentwicklung zu geben.
Welche Ziele werden in der Arbeit verfolgt?
Die Arbeit analysiert die didaktischen und methodischen Aspekte des gewählten Ansatzes. Zentrale Ziele sind die kindgemäße Vermittlung der Passions- und Ostergeschichte, die Förderung des Symbolverständnisses, ein ganzheitlicher und symbolischer Unterrichtsansatz, Raum für individuelle Glaubensentwicklung und die Bewertung der Eignung der Religionspädagogischen Praxis (RPP).
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung und Fragestellung, Konzeption der Unterrichtseinheit (didaktische Strukturanalyse), Dokumentation der Unterrichtpraxis, Gesamtreflexion der Unterrichtseinheit und Ausblick auf weitere Umgangsmöglichkeiten. Der Inhaltsverzeichnis bietet einen detaillierten Überblick über die einzelnen Abschnitte und Unterabschnitte.
Was wird in der Konzeption der Unterrichtseinheit (Kapitel II) behandelt?
Kapitel II beschreibt die didaktische Planung, analysiert die Lernvoraussetzungen der Schüler (allgemein und spezifisch), beinhaltet eine Sachanalyse und Exegese der Passions- und Ostergeschichte, erläutert den gewählten ganzheitlich-symbolischen Ansatz und die methodische Konzeption basierend auf der RPP, und formuliert die Lernziele.
Wie wird die Unterrichtpraxis dokumentiert (Kapitel III)?
Kapitel III dokumentiert den Ablauf der Unterrichtseinheit über sechs Wochen. Es enthält einen Überblick über den geplanten Stundenverlauf und eine detaillierte Beschreibung einer ausgewählten Sequenz (die Auferstehung), inklusive didaktisch-methodischer Vorüberlegungen, Lernzielen, tatsächlichem Verlauf und Reflexion der einzelnen Unterrichtsphasen (Sammlung, Anschauung, Deutung, Gestaltung).
Welche Aspekte werden in der Gesamtreflexion (Kapitel IV) betrachtet?
Kapitel IV bietet eine umfassende Reflexion der Unterrichtseinheit. Es bewertet die Eignung der Thematik für die zweite Klasse, analysiert die Wirksamkeit des ganzheitlich-symbolischen Ansatzes bezüglich Symbolverständnis und Glaubensentwicklung und beinhaltet eine kritische Auseinandersetzung mit den Stärken und Schwächen der RPP.
Welche Ausblicke gibt es in Kapitel V?
Kapitel V gibt einen Ausblick auf weitere Möglichkeiten, das Thema Passion und Ostern im Religionsunterricht zu behandeln und die RPP einzusetzen. Es schlägt vor, die Thematik in den Folgejahren aufzugreifen und zu vertiefen, den Fokus auf den Weitergang des christlichen Glaubens zu legen und einzelne Stationen der Passionsgeschichte intensiver zu bearbeiten.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Evangelischer Religionsunterricht, Grundschule, Didaktik, Methodik, Religionspädagogische Praxis (RPP), Symboldidaktik, Passion, Ostern, Auferstehung Jesu, ganzheitliches Lernen, Symbolverständnis, Glaubensentwicklung, kindgemäße Vermittlung, biblische Erzählungen.
- Quote paper
- Katarina Paul (Author), 2006, Das ganzheitliche "Nacherleben" des Weges Jesu von Palmsonntag bis Ostersonntag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62818