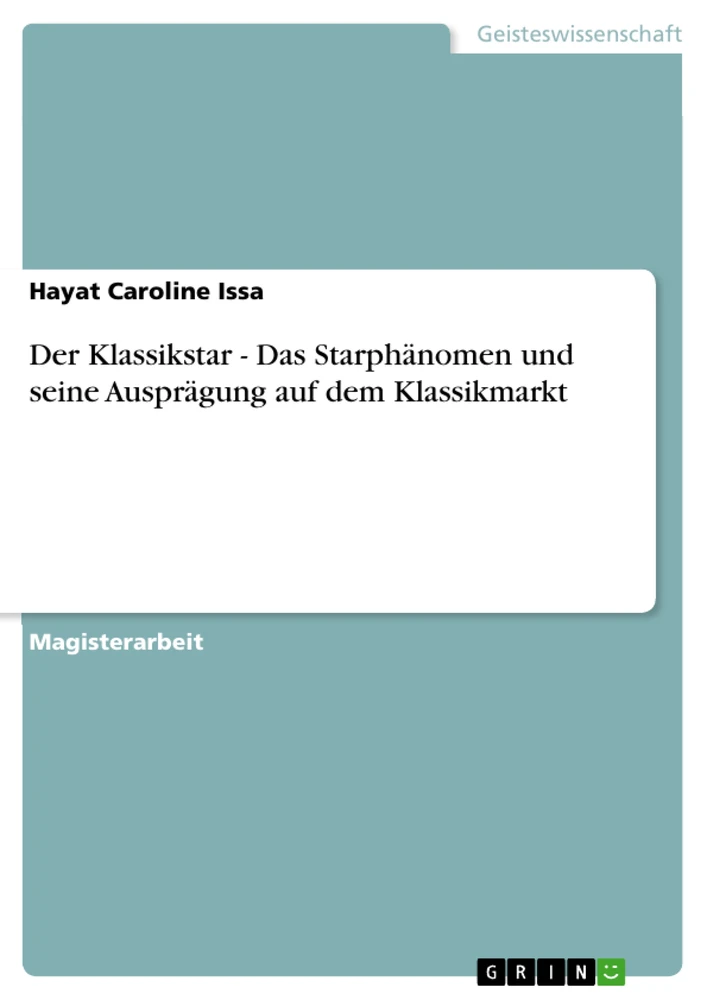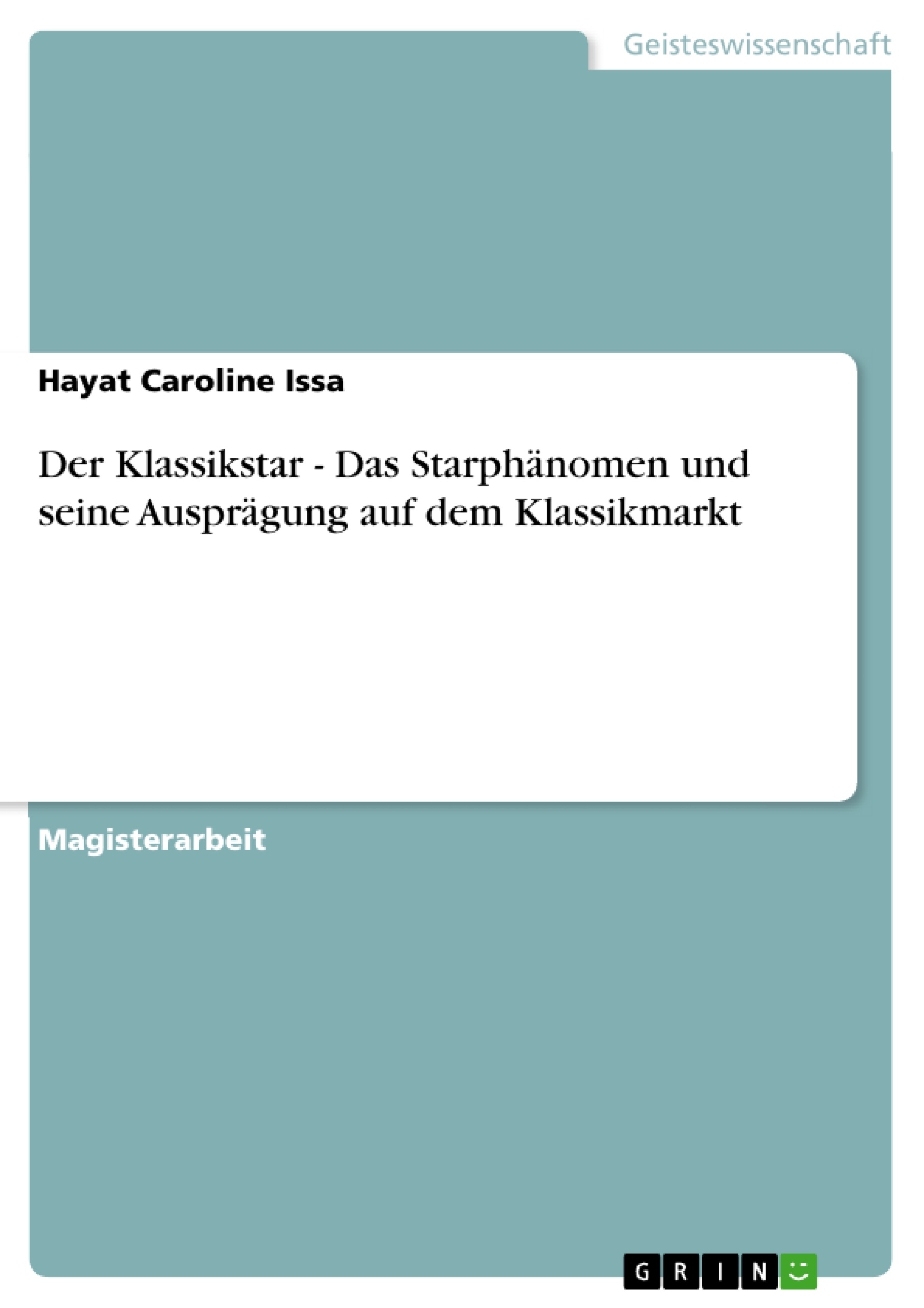Was ist ein Star? Diese Frage individuell zu beantworten, dürfte kaum schwer fallen. Jeder hat schließlich seine eigene Vorstellung von dem, wer ein Star ist und was ihn ausmacht – für den einen ist der Hollywood-Schauspieler ein Star, für den anderen der europäische Charakterdarsteller, die international bekannte Popsängerin, der eloquente Politiker, der täglich auf dem Fernsehschirm erscheinende Seifenoper-Darsteller, der zeitgenössische Maler, der exaltierte Modeschöpfer oder die klassische Operndiva. Doch haben diese Menschen etwas gemeinsam? Gibt es tatsächlich Aspekte und Merkmale, die bestimmte Persönlichkeiten zum Star werden lassen und andere, vielleicht nicht weniger talentiert und ambitioniert, eben nicht? Gibt es eine einheitliche Definition vom „Star“? Was ist das Faszinierende an diesen „besonderen“ Menschen, das andere sie bewundern, verehren und ihnen nacheifern lässt?
Dies waren die Ausgangsfragen, mit denen ich mich im Vorfeld dieser Arbeit beschäftigt habe. Da ich bereits seit einigen Jahren beruflich überwiegend mit klassischer Musik und Klassik-Künstlern im Rahmen des Konzerthaus- und Festivalbetriebs zu tun habe, lag es nah, sich diese Fragen auch und insbesondere in Bezug auf den Klassikmarkt zu stellen.
Es fällt auf, dass in den letzten Jahren der Klassikmarkt immer mehr und in immer schnellerer Folge so genannte Stars hervorbringt. Immer neue Musiker, Sänger und Instrumentalisten, junge Talente, die stets als „die neue große Klassik-Sensation“ angekündigt werden – aber auch allzu häufig rasch wieder aus dem öffentlichen Blickfeld verschwinden. Ist das Phänomen des Klassikstars ein neues? Wie werden die Musiker heutzutage inszeniert? Wie gelingt es, sie einem großen Publikum nahe zu bringen und sie möglichst langfristig am Markt zu etablieren? Wer steckt hinter dieser Vermarktung?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Abriss über die Entwicklung des Klassikmarktes seit Einführung der CD
- Die erste CD war eine Klassik-CD
- Siegeszug der CD - Euphorie in der Musikindustrie
- Gründe für die Krise
- Klassikhörer sind zu alt
- Der Fachhandel verschwindet
- Große Labels und Billiganbieter
- Ein Werk - Einhundert Interpretationen
- Stars - Forschungsstand
- Was ist ein Star? Erklärungsversuche
- Das Starimage
- Der Star als Zeichenkomplex
- Rollenimage und Privatimage
- Weitere Dimensionen des Starphänomens
- Kontinuität
- Der Star als Zeichen der Zeit
- Erfolg und Rezeption
- Wirtschaftlicher Erfolg
- Rezeption
- Psychologische Ansätze zur Erklärung des Starkults
- Zuhörer-Typologie nach Adorno
- Die rätselhafte Dimension - der Mythos
- Beispiel: Der Dirigent als mythischer Held
- Der Klassikstar
- Der Klassikstar – ein neues Phänomen?
- Exkurs - das Geschäft mit den Klassikstars
- Ronald Wilford und CAMI
- Mark McCormack und IMG
- Neuer Manager-Typus: Jeffrey Vanderveen
- Vermarktungsmöglichkeiten von Klassik-Künstlern
- Kleine Typologie der Klassikstars
- Anna Netrebko
- Anne-Sophie Mutter
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit befasst sich mit dem Starphänomen und dessen Ausprägung auf dem Klassikmarkt. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung des Klassikstars zu analysieren und die Mechanismen der Vermarktung und Rezeption zu beleuchten. Darüber hinaus sollen die spezifischen Herausforderungen und Chancen des Klassikmarktes im Kontext der gegenwärtigen Musikindustrie beleuchtet werden.
- Entwicklung des Klassikmarktes im digitalen Zeitalter
- Das Phänomen des "Klassikstars" und seine Entstehung
- Vermarktung und Rezeption von Klassikstars
- Psychologische und soziologische Aspekte des Starkults
- Analyse spezifischer Fallbeispiele von Klassikstars
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die zentralen Forschungsfragen und den methodischen Ansatz der Arbeit darlegt. Anschließend wird ein Abriss über die Entwicklung des Klassikmarktes seit der Einführung der CD gegeben, wobei die wichtigsten Herausforderungen und Entwicklungen dieser Zeit beleuchtet werden. In Kapitel 4 wird das Starphänomen aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, u.a. aus wissenschaftlicher Sicht, mit Fokus auf das Starimage als semiotisches Konstrukt. In Kapitel 5 werden weitere Dimensionen des Starphänomens beleuchtet, insbesondere die Rezeption und die psychologischen Aspekte des Starkults.
Kapitel 6 widmet sich ausführlich dem spezifischen Phänomen des Klassikstars, wobei die historischen Entwicklungen, die Vermarktungsstrategien und die Rolle von wichtigen Akteuren im Klassikmarkt analysiert werden. Schließlich werden in Kapitel 7 zwei etablierte Klassikstars, Anna Netrebko und Anne-Sophie Mutter, vorgestellt und ihre jeweiligen Karrieren, Images und Rezeptionsweisen analysiert.
Schlüsselwörter
Klassikmarkt, Starphänomen, Musikmarkt, Vermarktung, Rezeption, Klassikstars, Dirigent, Anna Netrebko, Anne-Sophie Mutter, Musikindustrie, Psychologie, Mythos, semiotisches Konstrukt.
- Quote paper
- Hayat Caroline Issa (Author), 2006, Der Klassikstar - Das Starphänomen und seine Ausprägung auf dem Klassikmarkt, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62745