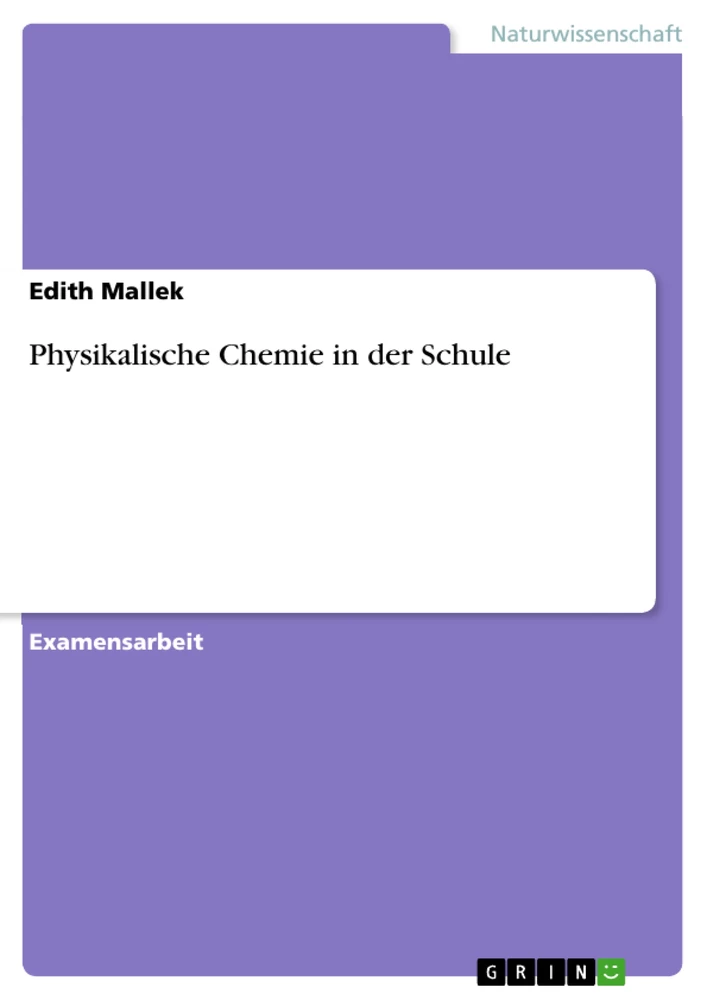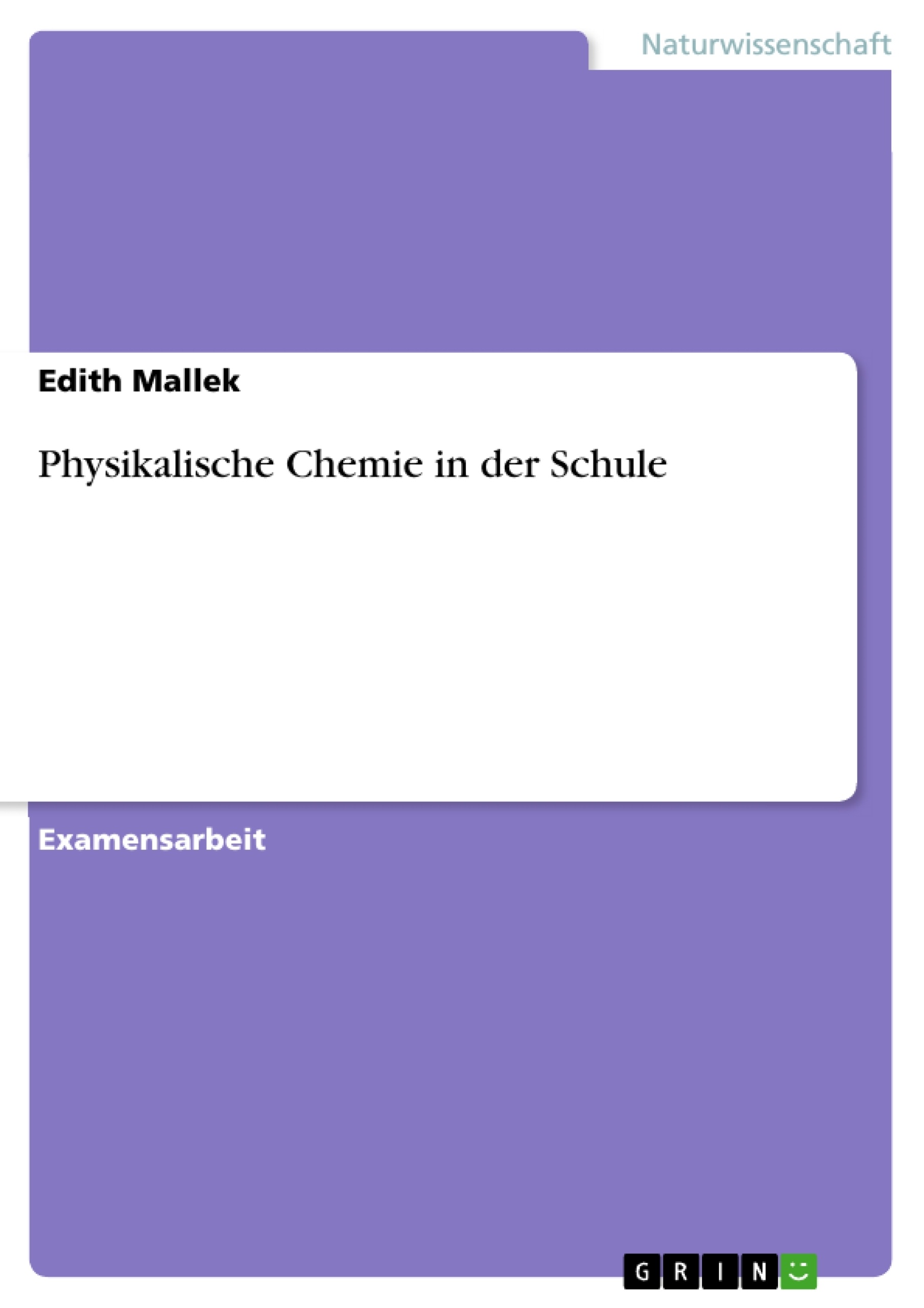Unter dem Begriff Schule verstehe ich im Rahmen dieser Arbeit den Chemieunterricht der Sekundarstufe I und II. Die tragende Säule des Unterrichts im Fach Chemie sind Experimente. Sie stellen das fundamentale Abgrenzungsmerkmal zu anderen Unterrichtsfächern dar. Der Weg vom Sachverhalt (PC) bis zum Experiment, das zum Bestandteil des Unterrichts werden kann, umfasst mindestens drei Schritte. Im Ersten muss der Sachverhalt erfasst werden, um die verschiedenen Facetten zu ergründen. Der zweite Schritt sollte dazu dienen die betreffenden Sachverhalte als solche zu erkennen. Dies ist für Physikochemie umso wichtiger, da ihre Erkenntnisse zunehmend der allgemeinen Chemie zugerechnet werden. Erst im dritten Schritt darf die Frage nach geeigneten Experimenten für den Schulunterricht gestellt werden. Dieses Vorgehen kann als „roter Faden“ dieser wissenschaftlichen Hausarbeit verstanden werden.
Diese wissenschaftliche Hausarbeit beginnt, indem auf grundlegende Probleme des heutigen Chemieunterrichts eingegangen wird (Kapitel 2). Sie werden in verschiedenen Facetten in zahlreichen fachdidaktischen Beiträgen diskutiert. Das Ziel ist hierbei weniger die Darstellung der Diskussion, sondern eine Skizze der Ausgangssituation. Es werden Aspekte erörtert, die negativen Einfluss auf den Chemieunterricht haben, obwohl die Ursachen z. T. nur indirekt in ihm begründet sind. Erst durch die Wahrnehmung dieser Probleme kann ein Weg beschritten werden, um diesen entgegenzuwirken. Nach diesem Einstieg gehe ich der Frage nach: Was ist physikalische Chemie? Hier sollen der Gegenstand „physikalische Chemie“ und einige seiner Ausprägungen näher bestimmt werden (Kapitel 3). Im Anschluss begebe ich mich auf die Suche nach Physikochemie im Lehrplan, dabei ist es wichtig die Differenzierung zwischen der Fachwissenschaft und dem Unterrichtsfach Chemie zu diskutieren, da sie in enger Beziehung miteinander stehen, jedoch nicht gleichbedeutend sind. (Kapitel 4). Bevor ich im letzten Kapitel (Kapitel 6) einige alternative Anwendungsbeispiele für Experimente zu dem Unterrichtsinhalt „Reaktionsgeschwindigkeit“ darstelle und diskutiere, halte ich es für notwendig, grundlegende didaktisch-methodische Konzepte zum Themenkomplex „Schulversuche“ darzulegen. Nur auf dieser Grundlage sind der konstruktive und produktive Einsatz und die Prüfung auf die Eignung für den Unterricht möglich.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Grundlegende Probleme des heutigen Chemieunterrichts
- 2.1. Die Chance Alchemie
- 2.2. Der Stellenwert der Chemie im Fächerkanon
- 2.2.1. Historischer Rückblick
- 2.2.2. Der quantitative Stellenwert des Chemieunterrichts ab der zweiten Hälfte des 20. Jh. in Westdeutschland
- 2.3. Chemie und Chemieunterricht im gesellschaftlichen Kontext
- 3. Die Fachwissenschaft physikalische Chemie
- 3.1. Physikalische Chemie - Begriffsbestimmung
- 3.2. Arbeitsbereiche physikalischer Chemie
- 3.3. Physikalische Chemie und Mathematik
- 3.4. Ein kurzer Einblick in die historische Entwicklung der physikalischen Chemie
- 3.5. Bedeutung der physikalischen Chemie für ihre Nachbardisziplinen
- 3.6. Physikalische Chemie in Industrie und Technik
- 4. Physikalische Chemie im Schulfach Chemie der Sekundarstufe
- 4.1. Grundlegende Überlegungen zu der Fachwissenschaft und dem Schulfach Chemie
- 4.2. Exemplarische Darstellung physikalisch-chemischer Sachverhalte im Unterrichtsfach Chemie ausgehend vom Lehrplan für Sekundarstufe
- 4.2.1. Physikalisch-chemische Inhalte im Lehrplan Chemie für Sekundarstufe
- 4.2.2. Physikalisch-chemische Verfahren im Lehrplan Chemie für Sekundarstufe
- 4.2.3. Der Überschneidungsbereich zwischen physikalisch-chemischen Verfahren und Inhalten im Lehrplan Chemie für Sekundarstufe
- 4.3. Allgemeine Anmerkungen zur Bedeutung der physikalischen Chemie im Unterricht der Sekundarstufe
- 4.4. Negative Einflüsse auf den Unterricht in physikalischer Chemie
- 4.4.1. Die Lehrerausbildung im Fachbereich physikalische Chemie
- 4.4.2. Der Schnittmengencharakter der Physikochemie
- 5. Experimente im Chemieunterricht der Sekundarstufe
- 5.1. Das Schulexperiment
- 5.2. Didaktisch-methodische Formen der Schulexperimente
- 5.3. Auswahlkriterien der Schulexperimente
- 5.4. Organisationsformen der Schulexperimente
- 5.4.1. Demonstrationsversuche
- 5.4.2. Schülerversuche
- 6. Physikalische Chemie im Unterricht der Oberstufe
- 6.1. Das „übliche Vorgehen ausgehend von der Mathematik
- 6.2. Zugang zu den Sachverhalten über geeignete Gegenstände
- 6.2.1. Verknüpfung zwischen Gegenständen und der Erfahrungswelt der Schüler
- 6.2.2. Prüfung der Gegenstände auf ihre Bedeutung für Schüler
- 6.2.3. Möglichkeit der Fächerverbindung durch die Gegenstände
- 6.3. Vorschläge für Experimente
- 6.3.1. Abhängigkeit der Reaktionszeit von der Konzentration - die Wirkung des Sauren Regens auf Pflanzen
- 6.3.1.1. Saurer Regen
- 6.3.1.2. Experiment - Die Wirkung des Sauren Regens auf die Reaktionszeit der Gartenkresse
- 6.3.1.3. Didaktisch-methodischer Kommentar
- 6.3.2. Abhängigkeit der Reaktionszeit von der Temperatur und dem Zerteilungsgrad
- 6.3.2.1. Enzyme
- 6.3.2.2. Abhängigkeit der Reaktionszeit von der Temperatur und dem Zerteilungsgrad am Beispiel der enzymatischen Zersetzung von Lebensmitteln
- 6.3.2.3. Didaktisch-methodischer Kommentar
- 6.3.3. Abhängigkeit der Reaktionszeit von Katalysatoren
- 6.3.3.1. AspirinⓇ und sein Wirkstoff Acetylsalicylsäure
- 6.3.3.2. Wirkung der Schwefelsäure bei der Darstellung von Acetylsalicylsäure
- 6.3.3.2. Methodisch-didaktischer Kommentar
- 6.3.1. Abhängigkeit der Reaktionszeit von der Konzentration - die Wirkung des Sauren Regens auf Pflanzen
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Hausarbeit analysiert die Integration physikalisch-chemischer Konzepte in den Chemieunterricht an Gymnasien. Ziel der Arbeit ist es, die Relevanz dieser Fachdisziplin für das Verständnis chemischer Phänomene im Schulunterricht aufzuzeigen und didaktisch-methodische Ansätze für eine gelungene Umsetzung in der Praxis zu entwickeln.
- Der Stellenwert der physikalischen Chemie im Schulfach Chemie
- Die Bedeutung von Experimenten für das Lernen in der physikalischen Chemie
- Didaktische Ansätze zur Vermittlung physikalisch-chemischer Sachverhalte
- Die Rolle des Lehrplans für die Integration von physikalischer Chemie im Unterricht
- Herausforderungen und Chancen der physikalischen Chemie im Chemieunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die Relevanz der physikalischen Chemie für den Chemieunterricht beleuchtet. Anschließend werden grundlegende Probleme des heutigen Chemieunterrichts diskutiert, wobei die Chancen der Alchemie und der Stellenwert der Chemie im Fächerkanon im Fokus stehen. Im dritten Kapitel wird die Fachwissenschaft physikalische Chemie näher betrachtet, einschließlich ihrer Definition, Arbeitsbereiche, Beziehung zur Mathematik, historischen Entwicklung und Bedeutung für andere Wissenschaften.
Kapitel 4 widmet sich der Integration der physikalischen Chemie im Schulfach Chemie der Sekundarstufe. Es werden exemplarische Darstellungen physikalisch-chemischer Sachverhalte anhand des Lehrplans für die Sekundarstufe vorgestellt. Dabei werden sowohl Inhalte als auch Verfahren berücksichtigt.
Kapitel 5 behandelt die Bedeutung von Experimenten im Chemieunterricht der Sekundarstufe. Hier werden didaktisch-methodische Formen von Schulexperimenten, Auswahlkriterien und Organisationsformen beleuchtet.
Im letzten Kapitel werden die besonderen Herausforderungen und Möglichkeiten der physikalischen Chemie im Unterricht der Oberstufe beleuchtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schwerpunkten physikalische Chemie, Chemieunterricht, Didaktik, Schulexperimente, Lehrplan, Sekundarstufe, Oberstufe. In den Fokus der Untersuchung werden Themen wie der Stellenwert der physikalischen Chemie im Schulfach, die Relevanz von Experimenten und die Entwicklung didaktisch-methodischer Ansätze zur Vermittlung von physikalisch-chemischen Inhalten gestellt.
- Quote paper
- Edith Mallek (Author), 2006, Physikalische Chemie in der Schule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62677