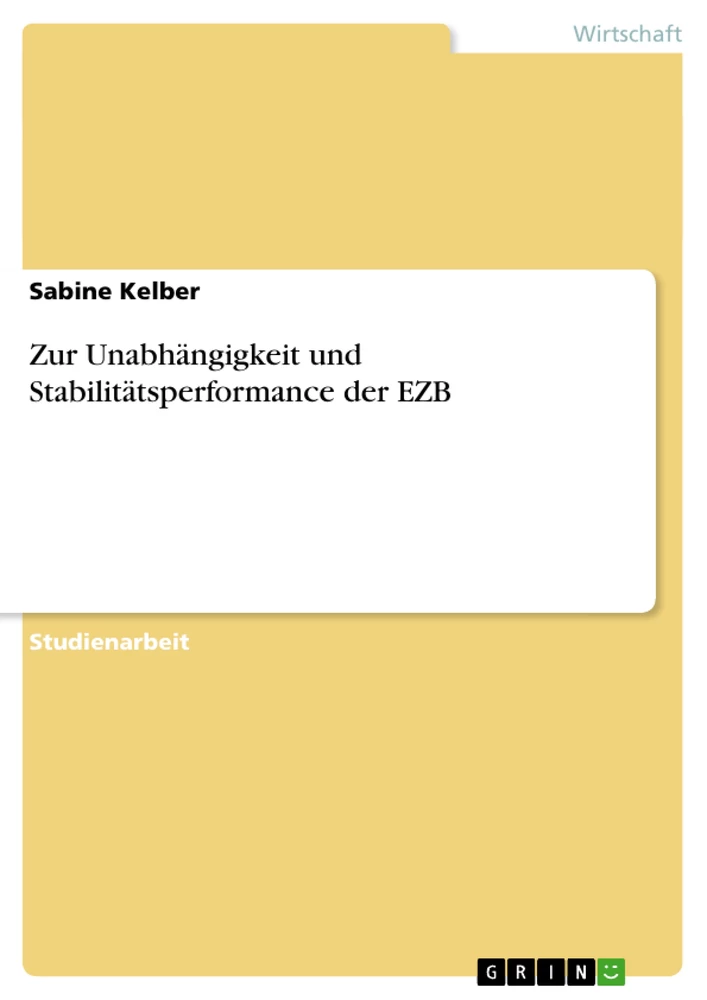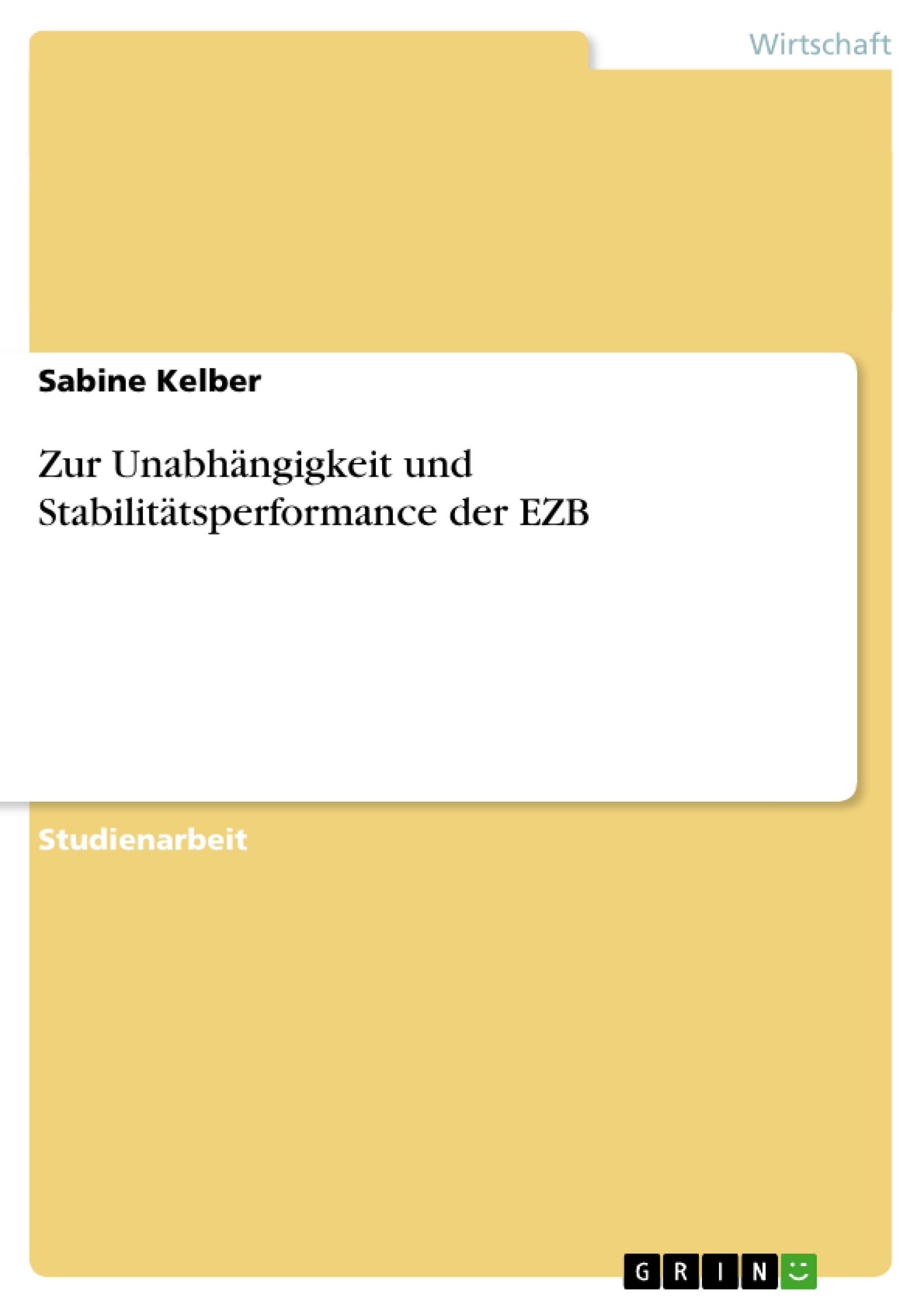Eine zentrale Herausforderung der neu gegründeten Europäischen Zentralbank (EZB) war die Schaffung einer glaubwürdigen Position im Währungsraum, da die EZB Anfang 1999 ohne „Track Record“, also ohne Verweis auf frühere Erfolge, ihre Arbeit aufnehmen musste. Für eine glaubwürdige und unabhängige Notenbankpolitik kann man, entweder durch die Schaffung einfacher Regeln, der Zentralbank rigide Beschränkungen auferlegen oder der Zentralbank gesetzliche Unabhängigkeit zusichern, um ihr geldpolitischen Spielraum zu lassen, und Zentralbanker mit entsprechender Einstellung wählen. Diese Verantwortlichen müssen konservativ sein und Inflation ablehnen, was bedeutet, dass sie ein Mehr an Inflation im Austausch gegen weniger Arbeitslosigkeit nicht zu akzeptieren bereit sind. Trotz des kurzen Bestehens der EZB versuchen wir im Folgenden, eine Analyse der bisherigen Performance darzustellen und zu bewerten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Entstehungsgeschichte
- 2.1 Die ersten Zentralbanken – ein kurzer historischer Abriss
- 2.2 Die ersten Ideen eines gemeinsamen Marktes
- 2.3 Das EWS-I-System
- 2.4 Das EWS-II-System
- Exkurs: Handelsgeschichte: Wie wirkte der Euro auf den Handel seit 1999?
- 3. Notenbanken
- 3.1 Definition „Notenbank“
- 3.2 Die Europäische Zentralbank
- 3.2.1 Aufbau der EZB
- 3.2.2 Zielsetzung der EZB
- 3.2.3 Geldpolitische Strategie
- 3.2.4 Geldpolitische Instrumente
- 3.3 Strategien anderer nationaler Notenbanken
- 4. Unabhängigkeit und Geldpolitik
- 4.1 Definition „Unabhängigkeit“
- 4.2 Glaubwürdigkeit
- 4.3 Zeitinkonsistenz
- 4.4 Der Policy-Mix
- 4.5 Problematik asymmetrischer Schocks und die Theorie der optimalen Währungsräume
- 5. Unabhängigkeit der EZB
- 5.1 Juristische Sicherung der Unabhängigkeit
- 5.2 Regelungen bei Erweiterung des Euroraums
- 5.3 Gefahren für die Unabhängigkeit
- 6. Die Stabilitätsperformance der EZB
- 6.1 Definition „Stabilität“
- 6.2 Performance der EZB seit Gründung
- 6.3 Gefahren für die Stabilität
- 7. Zusammenhang zwischen Unabhängigkeit und Stabilitätsperformance
- 7.1 Studienergebnisse
- 8. Status, aktuelle Probleme und Zukunftsaussichten des ESZB
- 8.1 Versuchte Einflussnahme auf die Geldpolitik durch Medien und Politiker
- 8.2 Überschussliquidität und widersprüchliche Aussagen der Zwei-Säulen-Theorie
- 8.3 Hedge-Fonds und Kapitalsammelstellen
- 8.4 Grundlegende Infragestellung der Zwei-Säulen-Strategie
- 8.5 Bedeutung nationaler Wirtschaftspolitik
- 8.6 Bedeutung des US-Außenhandelsdefizits für den Euro
- 8.7 Szenarien der Euro-Gemeinschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Unabhängigkeit und die Stabilitätsperformance der Europäischen Zentralbank (EZB). Ziel ist es, den Zusammenhang zwischen beiden Aspekten zu analysieren und aktuelle Herausforderungen für die EZB zu beleuchten.
- Entstehungsgeschichte und Entwicklung des EWS/EWU
- Unabhängigkeit der EZB: Juristische Grundlagen und potenzielle Gefährdungen
- Stabilitätsperformance der EZB: Erfolge, Herausforderungen und Risiken
- Zusammenhang zwischen Unabhängigkeit und Stabilitätsperformance
- Aktuelle Herausforderungen für die EZB im Kontext der globalisierten Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel dient als Einführung in die Thematik der Arbeit und beschreibt die Forschungsfrage sowie die Struktur der Untersuchung. Es skizziert den Kontext der europäischen Integration und die Bedeutung der EZB für die Stabilität des Euroraums.
2. Entstehungsgeschichte: Dieses Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung, beginnend mit den ersten Zentralbanken bis hin zur Gründung der EZB. Es werden die verschiedenen Phasen des Europäischen Währungssystems (EWS) detailliert dargestellt, einschließlich der Herausforderungen und Kompromisse, die zu ihrer Gestaltung führten. Der Exkurs zur Handelsgeschichte analysiert den Einfluss des Euro auf den Handel seit seiner Einführung.
3. Notenbanken: Hier wird der Begriff "Notenbank" definiert, und die Europäische Zentralbank wird im Detail vorgestellt. Der Aufbau der EZB, ihre Ziele und ihre geldpolitische Strategie werden erklärt. Zusätzlich werden die Strategien anderer nationaler Notenbanken betrachtet, um einen Vergleich zu ermöglichen und die Besonderheiten der EZB hervorzuheben.
4. Unabhängigkeit und Geldpolitik: In diesem Kapitel wird der Begriff der Unabhängigkeit einer Zentralbank umfassend analysiert. Verschiedene Dimensionen der Unabhängigkeit werden unterschieden (personell, institutionell, finanziell, funktionell). Die Bedeutung von Glaubwürdigkeit der Geldpolitik wird im Zusammenhang mit der Lucas-Kritik erläutert. Das Kapitel untersucht auch die Problematik der Zeitinkonsistenz und beleuchtet den Policy-Mix, d.h. das Zusammenwirken von Geld- und Fiskalpolitik, anhand konkreter Beispiele aus den USA und Deutschland.
5. Unabhängigkeit der EZB: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die rechtlichen Grundlagen der Unabhängigkeit der EZB, wie sie im Europarecht (Maastricht-Verträge), im deutschen Gesetz und in der Europäischen Verfassung verankert sind. Zusätzlich werden Regelungen bei Erweiterungen des Euroraums und potenzielle Gefahren für die Unabhängigkeit der EZB behandelt.
6. Die Stabilitätsperformance der EZB: Dieser Abschnitt definiert den Begriff „Stabilität“ im Kontext der Geldpolitik und analysiert die Performance der EZB seit ihrer Gründung. Es werden sowohl die Erfolge als auch die Herausforderungen und Gefahren für die Stabilität des Euroraums, insbesondere strukturelle Probleme wie die Fiskalpolitik und Verschuldung der Mitgliedstaaten sowie die Tarif- und Beschäftigungspolitik, diskutiert.
7. Zusammenhang zwischen Unabhängigkeit und Stabilitätsperformance: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert Studienergebnisse zum Zusammenhang zwischen der Unabhängigkeit der Zentralbank und ihrer Stabilitätsperformance. Die Ergebnisse werden im Kontext der vorherigen Kapitel diskutiert und interpretiert.
8. Status, aktuelle Probleme und Zukunftsaussichten des ESZB: Das Kapitel beschreibt den aktuellen Status des Europäischen Systems der Zentralbanken (ESZB), beleuchtet aktuelle Probleme wie versuchte Einflussnahmen auf die Geldpolitik, die Überschussliquidität und die Zwei-Säulen-Strategie. Es diskutiert die Bedeutung nationaler Wirtschaftspolitik, das US-Außenhandelsdefizit und verschiedene Szenarien für die Zukunft der Euro-Gemeinschaft.
Schlüsselwörter
Europäische Zentralbank (EZB), Europäisches Währungssystem (EWS), Europäische Währungsunion (EWU), Unabhängigkeit der Zentralbank, Geldpolitik, Stabilitätsperformance, Inflation, asymmetrische Schocks, optimale Währungsräume, Glaubwürdigkeit, Zeitinkonsistenz, Policy-Mix, Fiskalpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Unabhängigkeit und Stabilitätsperformance der EZB
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument analysiert die Unabhängigkeit und die Stabilitätsperformance der Europäischen Zentralbank (EZB). Es untersucht den Zusammenhang zwischen diesen beiden Aspekten und beleuchtet aktuelle Herausforderungen für die EZB im Kontext der globalisierten Wirtschaft.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die Entstehungsgeschichte des EWS/EWU, die rechtlichen Grundlagen und potenziellen Gefährdungen der EZB-Unabhängigkeit, die Stabilitätsperformance der EZB (Erfolge, Herausforderungen und Risiken), den Zusammenhang zwischen Unabhängigkeit und Stabilitätsperformance sowie aktuelle Herausforderungen für die EZB in der globalisierten Wirtschaft. Es werden auch Konzepte wie asymmetrische Schocks, optimale Währungsräume, Glaubwürdigkeit, Zeitinkonsistenz und der Policy-Mix erläutert.
Welche Kapitel umfasst das Dokument und worum geht es in jedem Kapitel?
Das Dokument ist in acht Kapitel gegliedert: Kapitel 1 ist eine Einleitung. Kapitel 2 beleuchtet die Entstehungsgeschichte des EWS/EWU. Kapitel 3 definiert den Begriff „Notenbank“ und beschreibt die EZB detailliert. Kapitel 4 analysiert Unabhängigkeit und Geldpolitik. Kapitel 5 konzentriert sich auf die Unabhängigkeit der EZB. Kapitel 6 analysiert die Stabilitätsperformance der EZB. Kapitel 7 untersucht den Zusammenhang zwischen Unabhängigkeit und Stabilitätsperformance. Kapitel 8 behandelt den aktuellen Status, Probleme und Zukunftsaussichten des ESZB.
Wie ist die Unabhängigkeit der EZB juristisch abgesichert?
Die juristische Sicherung der EZB-Unabhängigkeit wird im Dokument im Detail erläutert, wobei Bezug auf das Europarecht (Maastricht-Verträge), deutsches Gesetz und die Europäische Verfassung genommen wird. Das Kapitel beleuchtet auch Regelungen bei Erweiterungen des Euroraums und potenzielle Gefahren für die Unabhängigkeit.
Wie wird die Stabilitätsperformance der EZB bewertet?
Das Dokument analysiert die Stabilitätsperformance der EZB seit ihrer Gründung. Es werden sowohl Erfolge als auch Herausforderungen und Gefahren für die Stabilität des Euroraums diskutiert, einschließlich struktureller Probleme wie Fiskalpolitik, Verschuldung der Mitgliedstaaten und Tarif-/Beschäftigungspolitik.
Welchen Zusammenhang stellt das Dokument zwischen Unabhängigkeit und Stabilitätsperformance her?
Das Dokument präsentiert und analysiert Studienergebnisse zum Zusammenhang zwischen der Unabhängigkeit der Zentralbank und ihrer Stabilitätsperformance. Diese Ergebnisse werden im Kontext der vorherigen Kapitel diskutiert und interpretiert.
Welche aktuellen Probleme und Zukunftsaussichten für das ESZB werden im Dokument angesprochen?
Das Dokument beschreibt aktuelle Probleme wie versuchte Einflussnahmen auf die Geldpolitik, Überschussliquidität und die Zwei-Säulen-Strategie. Es diskutiert die Bedeutung nationaler Wirtschaftspolitik, das US-Außenhandelsdefizit und verschiedene Szenarien für die Zukunft der Euro-Gemeinschaft.
Welche Schlüsselwörter sind für das Verständnis des Dokuments relevant?
Wichtige Schlüsselwörter sind: Europäische Zentralbank (EZB), Europäisches Währungssystem (EWS), Europäische Währungsunion (EWU), Unabhängigkeit der Zentralbank, Geldpolitik, Stabilitätsperformance, Inflation, asymmetrische Schocks, optimale Währungsräume, Glaubwürdigkeit, Zeitinkonsistenz, Policy-Mix, Fiskalpolitik.
- Quote paper
- Sabine Kelber (Author), 2005, Zur Unabhängigkeit und Stabilitätsperformance der EZB, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62663