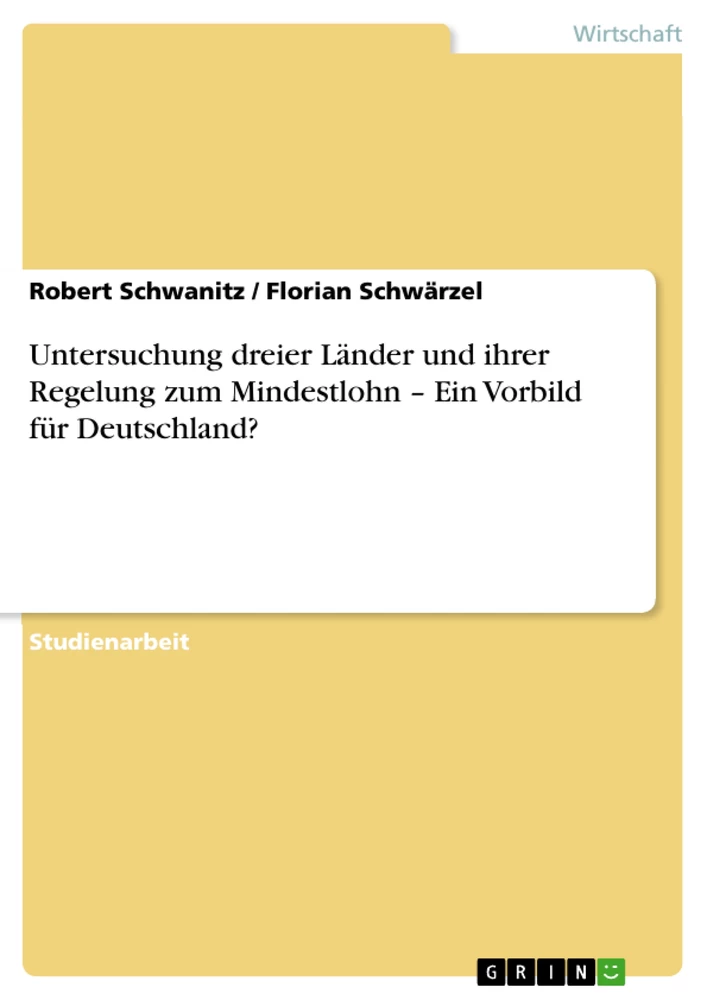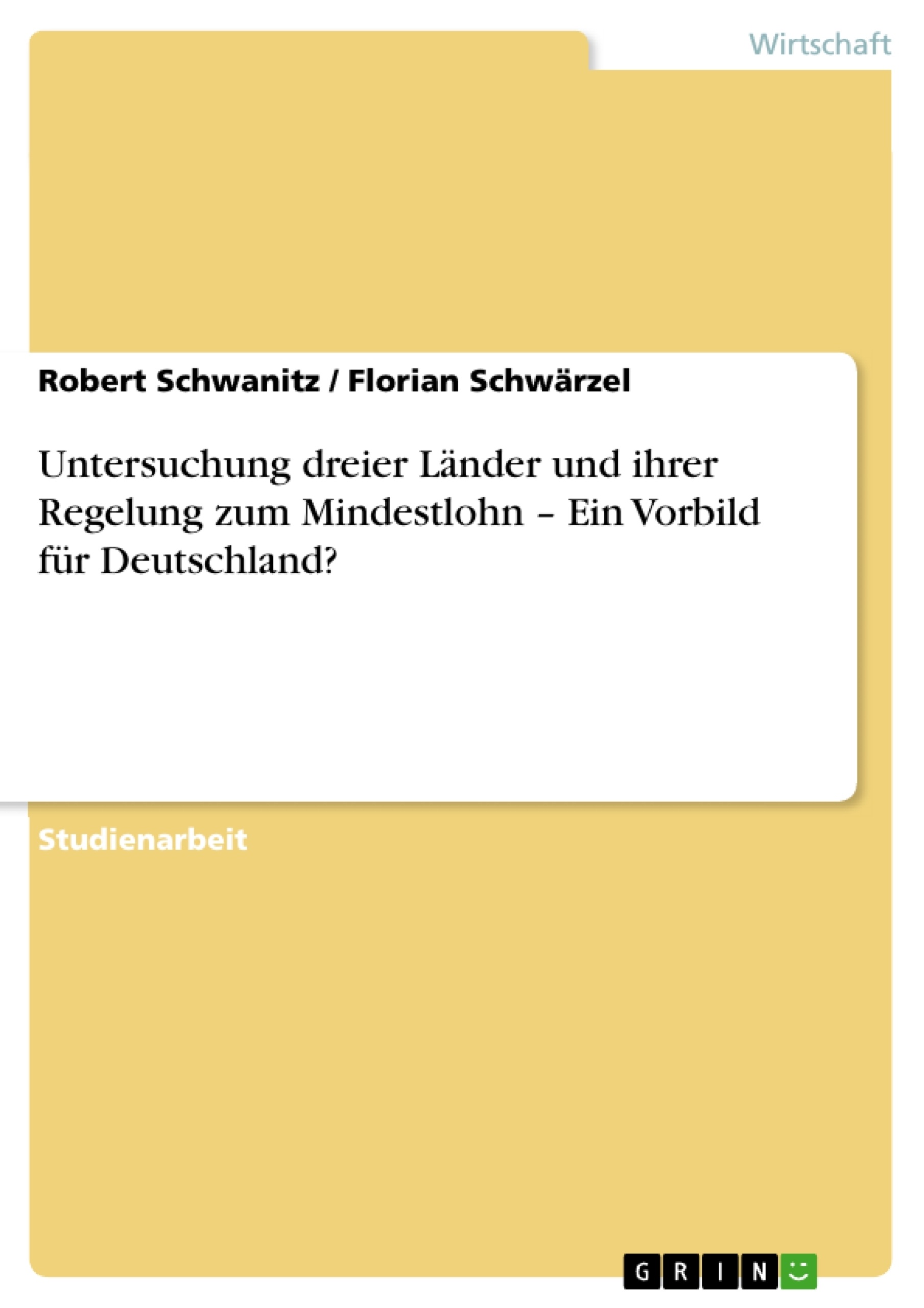Über die Parteigrenzen hinweg ist die Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit ein zentrales Thema in diesem Wahlkampf gewesen. Obwohl die Parteien in ihren Programmen – ob es nun „Vorfahrt für Arbeit“ (Union) oder „Vertrauen in Deutschland“ (SPD) heißt - durchaus ähnliche Ziele angeben, unterscheiden sich ihre Mittel jedoch zeitweise grundlegend. Während die Linke.PDS über einen Mindestlohn in der Höhe von 1.000 € - 1.400 € stritt (@ Berlinkontor.de) , um die gesamtwirtschaftliche Nachfrage zu stärken, lehnen die Liberalen „Mindestlöhne, egal in welcher Form sie festgelegt werden“ rigoros ab, da sie „tendenziell zu höheren Preisen [führen] und […] darüber die Kaufkraft [schwächen]“ (@ Wahlprogramm FDP). Diese beiden Forderungen stehen exemplarisch für zwei unterschiedliche Herangehensweisen an das Problem der Arbeitslosigkeit. „Im Grunde geht es dabei um die Frage, ob Arbeitslosigkeit verursacht wird durch (1) einen zu hohen Preis für Arbeit, d.h. zu hohe Löhne, und/oder zu großzügige Sozialleistungen […] oder (2) eine zu geringe gesamtwirtschaftliche Nachfrage“ (Bofinger, 153). Ziel dieser Hausarbeit ist es jedoch nicht, die Wahlprogramme für Arbeitsmarkt- oder Lohnpolitik der einzelnen Parteien zu analysieren, sondern vielmehr ihre Vorstellungen als Grundlage für ein mögliches Mindestlohnmodell für die Bundesrepublik Deutschland zu nehmen. Zentrale Fragestellung dabei ist, ob es überhaupt Sinn macht, einen gesetzlichen Mindestlohn festzulegen. Zur Beantwortung dieser Frage soll zunächst in einem theoretischen Teil geklärt werden, was ein Mindestlohn genau ist und wie er sich in der Theorie auf die Ökonomie eines Landes und auf dessen Arbeitsmarkt auswirkt. Im zweiten empirischen Teil soll das Mindestlohnmodell von drei Staaten untersucht und mit den Ergebnissen des Theorieteils verglichen werden. Diese Staaten sind Frankreich, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika. In jedem dieser Staaten gibt es einen gesetzlichen Mindestlohn, jedoch unterscheidet sich jedes Modell von dem der anderen Staaten. Jedes Mindestlohnmodell soll dahingehend untersucht werden, wie die Höhe des Mindestlohns zustande kommt und welche Auswirkungen er mit sich bringt. Im letzten Teil schließlich soll in einem Ausblick ein mögliches Modell für die Bundesrepublik skizziert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die sozialen Ziele des Mindestlohns
- Mindestlohnarbeitslosigkeit
- Alternative Wirkung des Mindestlohns – Kaufkraft der Löhne
- Zusammenfassung
- Länderuntersuchungen: USA, Großbritannien, Frankreich
- Einführung: Der Fair Labor Standard Act in den USA
- Höhe und Anpassung des Mindestlohns
- Kaitz Index und Lohngefüge der USA
- Die Verbreitung von working-poor Einkommen in den USA
- Paradigmenstreit: Der Einfluss der Studie von Card und Krueger
- Großbritannien
- Einführung
- Höhe und Anpassung des NMW in Großbritannien
- Auswirkungen des NMW
- Lohngefüge
- Arbeitslosenquote
- Armut und working poor
- Zusammenfassung GB
- Frankreich
- Einführung
- Höhe und Anpassung des SMIC
- Auswirkungen des SMIC
- Lohngefüge
- Tarifgefüge
- Arbeitslosenquote
- Armut und working poor
- Fazit Frankreich
- Zusammenfassung der Länderuntersuchung
- Gesamtfazit: Eingehen auf die Ausgangsfrage
- Der Deutsche Ist-Zustand
- Ein mögliches Modell für Deutschland
- Eine Alternative: Die Ausweitung der AVE
- Fazit: Mindestlohn ja oder nein?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Auswirkungen von Mindestlöhnen anhand von drei Ländern (USA, Großbritannien, Frankreich) und diskutiert die Übertragbarkeit der Ergebnisse auf Deutschland. Die zentrale Fragestellung ist, ob ein gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland sinnvoll ist. Die Arbeit analysiert verschiedene Mindestlohnmodelle, deren Auswirkungen auf Arbeitslosigkeit, Lohngefüge, Armut und die Kaufkraft.
- Auswirkungen von Mindestlöhnen auf die Arbeitslosigkeit
- Einfluss von Mindestlöhnen auf das Lohngefüge
- Zusammenhang zwischen Mindestlohn und Armut/working poor
- Vergleich verschiedener nationaler Mindestlohnmodelle
- Diskussion der Übertragbarkeit auf das deutsche System
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beleuchtet den politischen Kontext der Mindestlohndebatte in Deutschland im Jahr 2005, ausgehend von den Wahlprogrammen verschiedener Parteien und deren gegensätzlichen Positionen zum Thema. Sie führt die zentrale Forschungsfrage ein: Ist ein gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland sinnvoll? Die methodische Vorgehensweise, bestehend aus theoretischen Überlegungen und einem empirischen Vergleich dreier Ländermodelle, wird skizziert.
Die sozialen Ziele des Mindestlohns: Dieses Kapitel befasst sich mit den sozialen Zielen eines Mindestlohns und analysiert dessen theoretische Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. Es untersucht die potenzielle Mindestlohnarbeitslosigkeit und die alternative Wirkung auf die Kaufkraft der Löhne, um die komplexen Zusammenhänge zu beleuchten.
Länderuntersuchungen: USA, Großbritannien, Frankreich: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Mindestlohnmodelle der USA, Großbritanniens und Frankreichs. Es legt die jeweiligen Besonderheiten der Systeme dar und bereitet den Boden für detaillierte Analysen in den folgenden Kapiteln.
Großbritannien: Dieses Kapitel untersucht das britische Mindestlohnmodell (NMW), inklusive seiner Höhe, Anpassungsmechanismen und Auswirkungen auf Lohngefüge, Arbeitslosenquote, Armut und die Gruppe der "working poor". Die Analyse konzentriert sich auf die umfassenden Folgen des NMW für die britische Wirtschaft und Gesellschaft.
Frankreich: Das Kapitel analysiert den französischen Mindestlohn (SMIC), einschließlich seiner Festlegung, Anpassung und Auswirkungen auf das Lohngefüge (mit besonderem Fokus auf Tarifverträge), Arbeitslosigkeit, Armut und "working poor". Es bietet eine umfassende Bewertung der französischen Mindestlohnpolitik.
Zusammenfassung der Länderuntersuchung: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Ländervergleiche zusammen und stellt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der untersuchten Mindestlohnmodelle heraus. Es dient als Brücke zum abschließenden Kapitel.
Schlüsselwörter
Mindestlohn, Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit, Lohngefüge, Armut, working poor, Kaufkraft, USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Ländervergleich, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Fair Labor Standard Act, NMW, SMIC.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Auswirkungen von Mindestlöhnen
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Auswirkungen von Mindestlöhnen auf den Arbeitsmarkt, fokussiert auf die Fragen der Arbeitslosigkeit, des Lohngefüges, der Armut und der Kaufkraft. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob ein gesetzlicher Mindestlohn in Deutschland sinnvoll ist.
Welche Länder werden in der Studie verglichen?
Die Hausarbeit vergleicht die Mindestlohnmodelle der USA, Großbritanniens und Frankreichs, um Erkenntnisse für die deutsche Situation zu gewinnen.
Welche Aspekte der Mindestlohnmodelle werden analysiert?
Die Analyse umfasst die Höhe und Anpassung der Mindestlöhne, die Auswirkungen auf Arbeitslosigkeit, Lohngefüge (inkl. Tarifverträge in Frankreich), Armut (insbesondere "working poor") und die Kaufkraft. Es werden die jeweiligen Besonderheiten der Systeme in den einzelnen Ländern beleuchtet.
Wie ist die Hausarbeit strukturiert?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den politischen Kontext und die Forschungsfrage definiert. Es folgen Kapitel zu den sozialen Zielen des Mindestlohns, detaillierte Länderuntersuchungen zu USA, Großbritannien und Frankreich, eine Zusammenfassung der Ländervergleiche und schließlich ein Gesamtfazit mit Blick auf die deutsche Situation und mögliche Modelle (inkl. der Ausweitung der Arbeitslosenversicherung).
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Hausarbeit wichtig?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Mindestlohn, Arbeitsmarkt, Arbeitslosigkeit, Lohngefüge, Armut, working poor, Kaufkraft, USA, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Ländervergleich, Wirtschaftspolitik, Sozialpolitik, Fair Labor Standard Act, NMW, SMIC.
Welche konkreten Fragen werden in Bezug auf Deutschland diskutiert?
Die Hausarbeit diskutiert den deutschen Ist-Zustand im Jahr 2005 bezüglich der Mindestlohndebatte und schlägt ein mögliches Mindestlohnmodell für Deutschland vor, unter anderem auch die Ausweitung der Arbeitslosenversicherung als Alternative.
Welche methodische Vorgehensweise wird in der Hausarbeit angewendet?
Die Hausarbeit kombiniert theoretische Überlegungen mit einem empirischen Vergleich dreier Ländermodelle (USA, Großbritannien, Frankreich), um die Auswirkungen von Mindestlöhnen umfassend zu analysieren.
Welche Schlussfolgerung zieht die Hausarbeit bezüglich eines Mindestlohns in Deutschland?
Die abschließende Antwort auf die Frage, ob ein Mindestlohn in Deutschland sinnvoll ist, findet sich im Gesamtfazit. Die Hausarbeit präsentiert Argumente und bewertet verschiedene Modelle, um zu einer fundierten Schlussfolgerung zu gelangen.
- Quote paper
- Robert Schwanitz (Author), Florian Schwärzel (Author), 2005, Untersuchung dreier Länder und ihrer Regelung zum Mindestlohn – Ein Vorbild für Deutschland?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62568