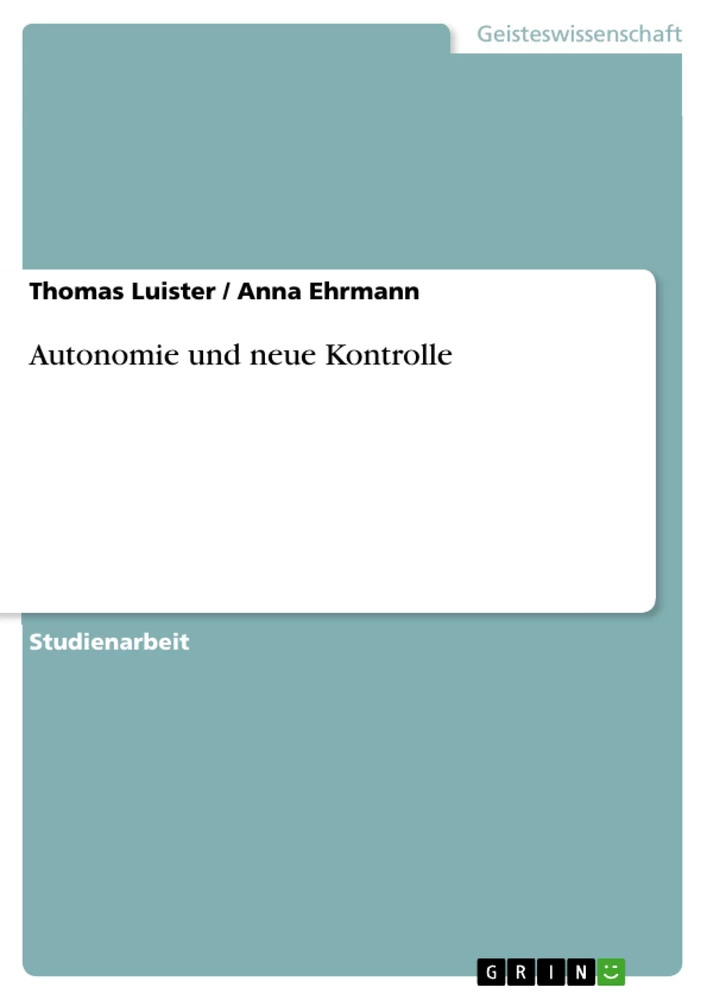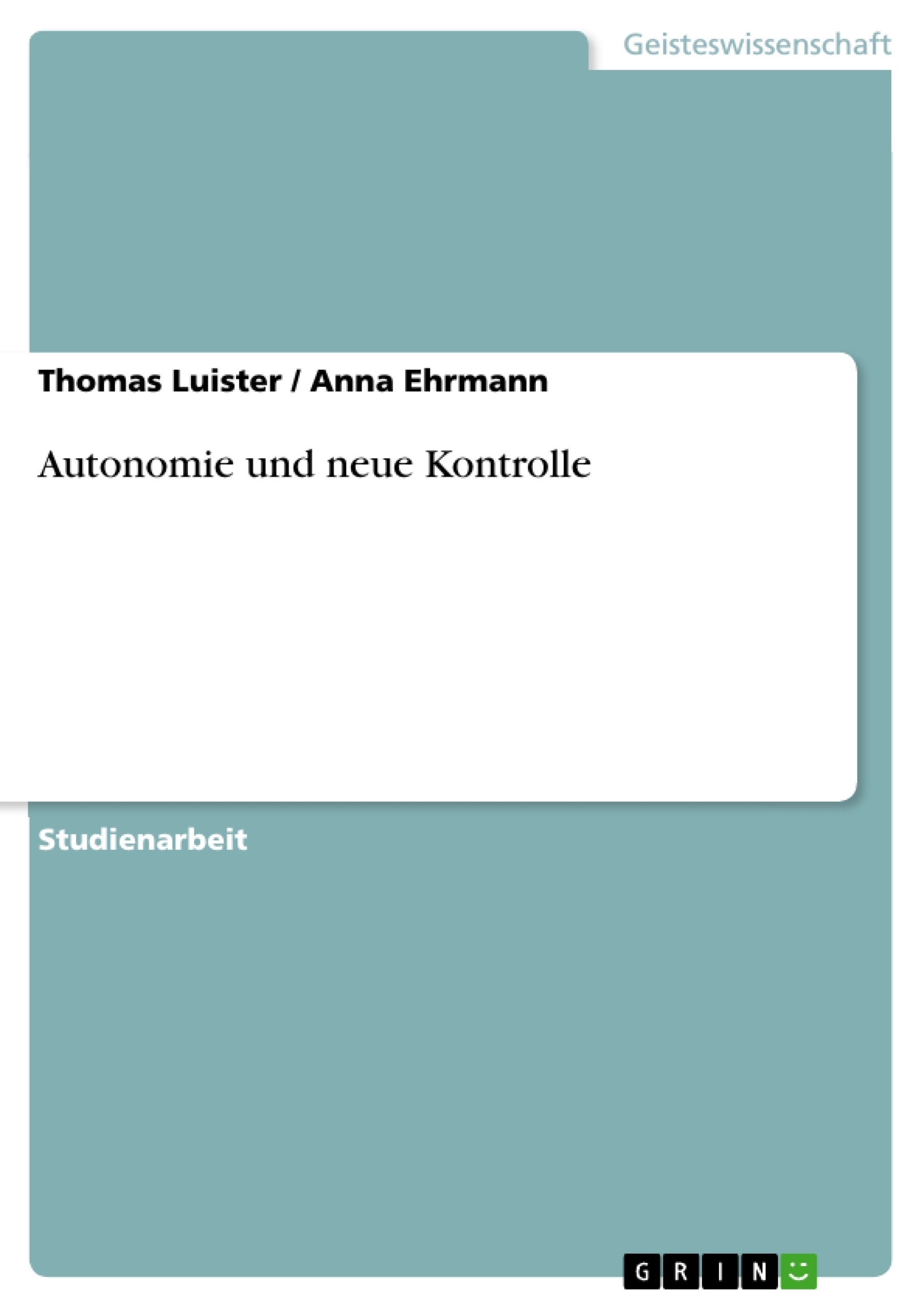In den letzten Jahrzehnten kam es in der Wirtschaft sowie auch der Gesellschaft durch die fortschreitende Dynamisierung, Flexibilisierung und Globalisierung zu einschneidenden Veränderungen. Die Komplexität von Arbeitstechniken/-systemen erhöhte sich und die Entwicklung von neuen Informations- und Kommunikationstechniken ermöglichte andere Formen der Steuerung und Kontrolle. All diese und weitere Veränderungen beeinflussten das Verständnis von Arbeit und tun dies immernoch. Arbeit als Phänomen bleibt dabei zwar das Gleiche, jedoch verändern sich die Anforderungen an den Einzelnen sowie die Bedingungen unter denen gearbeitet wird. Als Folge veränderte sich das, was unter dem Begriff Arbeit verstanden wird.
Innerhalb des Themenkomplexes der „Entwicklungsperspektiven von Arbeit“ werden wir uns in diesem Text mit dieser Veränderung des Verständnisses von Arbeit auseinandersetzen und vor allem betrachten, was diese Veränderungen für den Einzelnen für Folgen haben. Dabei werden wir den Taylorismus beziehungsweise Fordismus vorstellen und erläutern, inwiefern es dabei zu Diskrepanzen zwischen den Bedingungen dieser Theorien und den Anforderungen der Gegenwart gekommen ist. Des weiteren werden wir erörtern, inwiefern die Lösung der Diskrepanzen in der (Re-)Subjektivierung der Arbeit (v.a. auch von qualifizierter Arbeit) gesucht wurde, aber ebenfalls, und das wird ein Schwerpunkt dieser Arbeit sein, wie diese Subjektivierung nur scheinbar diese ist, da sie in großem Masse wiederum objektiviert wurde. Dieser Prozess der Objektivierung subjektivierter Arbeit, findet unter dem Deckmantel der Humanisierung (Subjektivierung) großen Anklang, da er in Konformität zu unserer wissenschaftlichen, rational denkenden Gesellschaft steht. Ebenso aber führt er zu neuen großen Konfliktfeldern, welche wir darzulegen versuchen werden.
Inhaltsverzeichnis
- I Einleitung
- II Subjektivierung der Arbeit
- II.1 Die Krise des Fordismus
- II.2 Krise des Kommandosystems
- II.2.1 Indirekte Steuerung
- II.2.2 Selbstorganisation
- II.2.3 Subjektivierung
- II.3 Die Ambivalenz der neuen Freiheit
- II.4 Der richtige Umgang mit der Paradoxie
- III Objektivierung subjektivierter Arbeit
- III.1 Objektivierendes Handeln
- III.2 Selbststeuerung nach objektiver Maßgabe
- III.2.1 Entwicklung von Informations- und Steuerungssystemen
- III.2.2 Steuerung über Kennzahlen
- III.3 Neue Formen der Kontrolle und Macht
- III.4 Verwissenschaftlichung handlungsleitender subjektiver Orientierungen
- III.5 Grenzen der Objektivierbarkeit
- IV Fazit
- V Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit analysiert die Veränderungen im Verständnis von Arbeit, die durch die zunehmende Dynamisierung, Flexibilisierung und Globalisierung der Wirtschaft und Gesellschaft entstanden sind. Insbesondere wird untersucht, wie die Krise des Fordismus und die Subjektivierung von Arbeit neue Formen der Kontrolle und Objektivierung schaffen.
- Krise des Fordismus und seine Folgen
- Subjektivierung von Arbeit als scheinbare Humanisierung
- Objektivierung subjektivierter Arbeit
- Neue Formen der Kontrolle und Macht
- Grenzen der Objektivierbarkeit
Zusammenfassung der Kapitel
I Einleitung
Die Einleitung führt in die Thematik der veränderten Anforderungen an Arbeit im Kontext der Globalisierung und Digitalisierung ein. Es wird die Bedeutung der Subjektivierung von Arbeit beleuchtet und gleichzeitig die ambivalente Entwicklung zur Objektivierung der Arbeit herausgestellt.
II Subjektivierung der Arbeit
Dieser Abschnitt analysiert die Krise des Fordismus und zeigt die Ursachen für das grundlegende Umdenken in der Arbeitsorganisation auf. Die Entwicklung neuer Strategien zur Bewältigung der Krise, wie Rationalisierung, Dezentralisierung und Selbstorganisation, wird beschrieben. Es wird zudem die Ambivalenz der neuen Freiheit durch Rollenüberlastung, Unterlaufung von Regeln und verschärfte Konkurrenzsituation thematisiert.
III Objektivierung subjektivierter Arbeit
In diesem Kapitel wird die Objektivierung subjektivierter Arbeit näher untersucht. Die Selbststeuerung nach objektiver Maßgabe und die Entwicklung von Informations- und Steuerungssystemen werden als Mittel der Kontrolle und Macht dargestellt. Die Grenzen der Objektivierbarkeit werden ebenfalls beleuchtet.
Schlüsselwörter
Subjektivierung von Arbeit, Objektivierung, Fordismus, Taylorismus, Dynamisierung, Flexibilisierung, Globalisierung, Kontrolle, Macht, Humanisierung, Informations- und Steuerungssysteme, Kennzahlen, Arbeitsorganisation, Arbeitsbeziehungen, Selbstorganisation, Rationalisierung, Dezentralisierung.
- Quote paper
- Thomas Luister (Author), Anna Ehrmann (Author), 2006, Autonomie und neue Kontrolle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62490