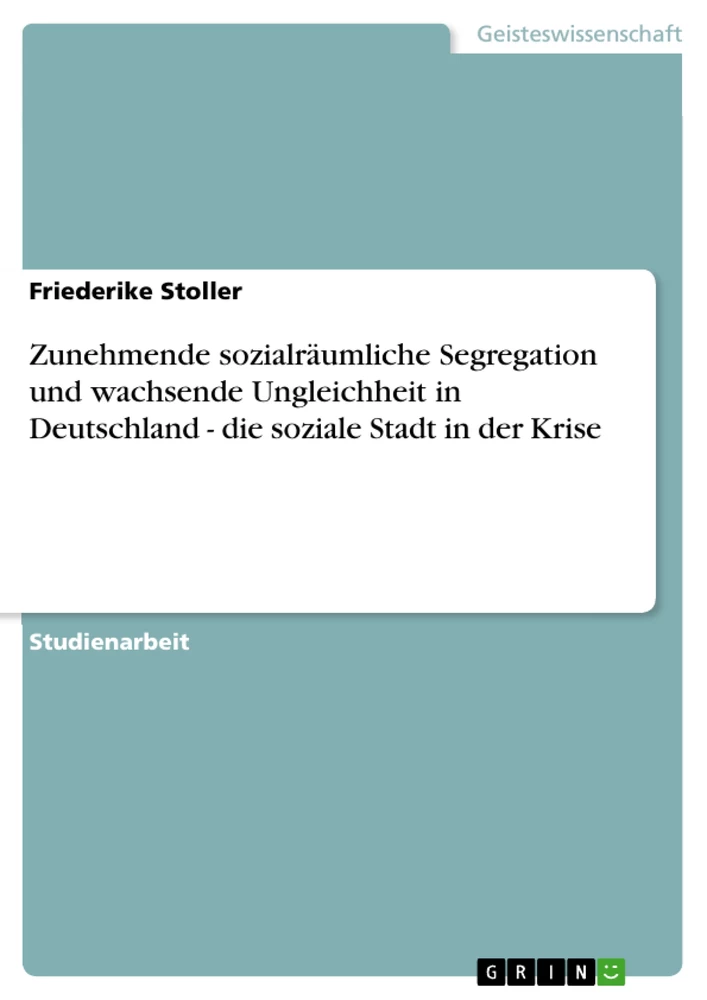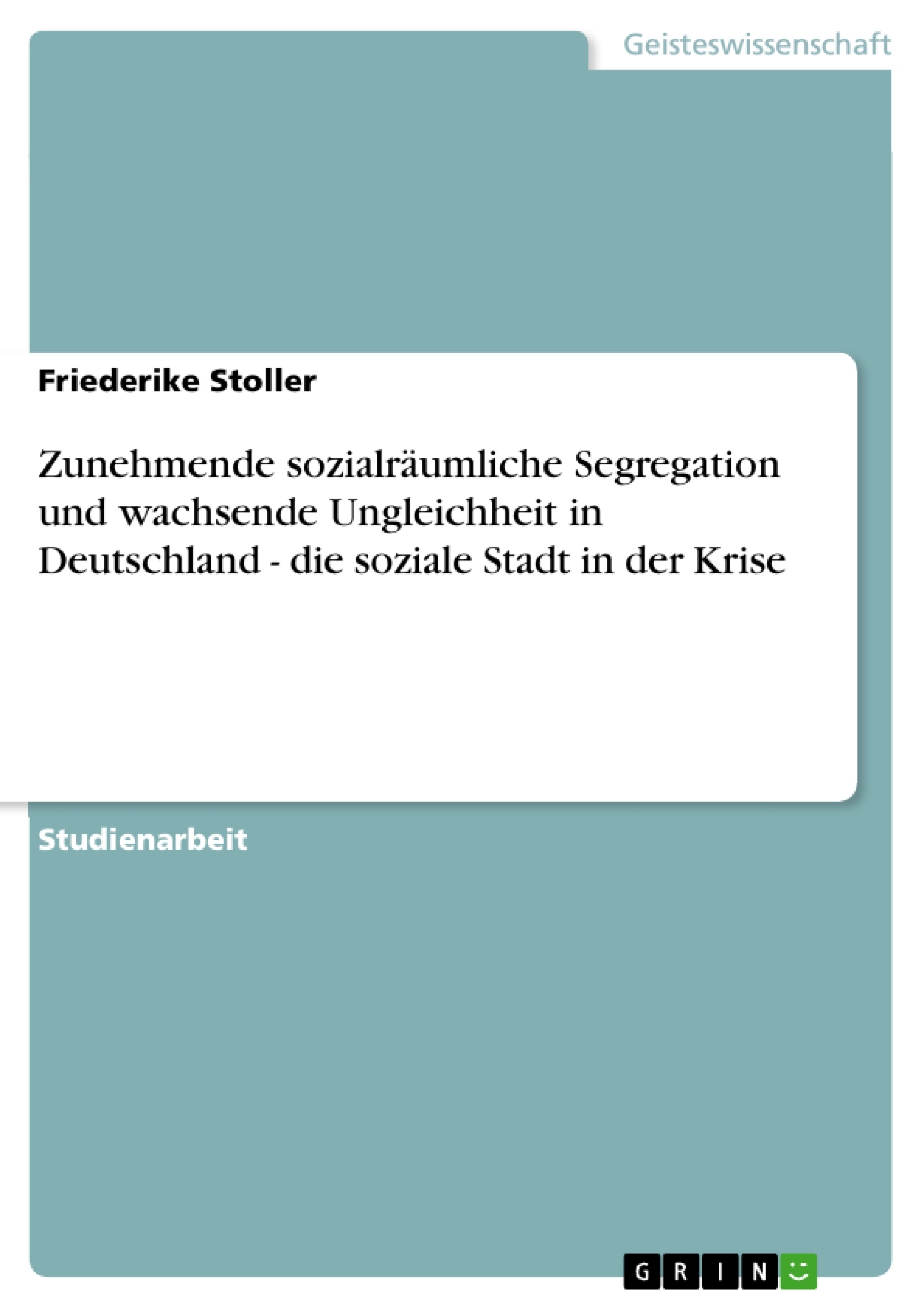In deutschen Städten nimmt seit dem Ende von Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung in den 1970er Jahren die soziale Ungleichheit und sozialräumliche Segregation beständig zu, und das Streben nach Wirtschaftlichkeit bestimmt mehr und mehr das politische Handeln. In den Städten ist dieser Trend ebenfalls zu spüren: immer mehr öffentliches Eigentum wird privatisiert. Davon sind in verstärktem Maße die städtischen Mietwohnungen betroffen; auch in Freiburg sollen alle stadteigenen Wohnungen an private Investoren verkauft werden. Soziale Zielsetzungen, die noch bis in die 1970er Jahre maßgebliche Handlungskoordinaten städtepolitischen Vorgehens waren, geraten damit zunehmend ins Hintertreffen zugunsten unternehmerischer Prioritäten.
In meiner Arbeit gehe ich der Frage nach, welche Folgen dieses Vorgehen für die Städte hat. Um die Frage beantworten zu können, zeichne ich im ersten Kapitel die Entwicklung und die Krise der sozialen Stadt nach. Entstanden in den 1920er Jahren, wurde das Konzept einer vorwiegend auf sozialen Ausgleich ausgerichteten Stadt durch wirtschaftliche Strukturkrisen und -veränderungen zunehmend in Frage gestellt. Folgen der ab diesem Zeitpunkt verstärkt auf wirtschaftliche Zielsetzungen fokussierten Politik ist eine zunehmende sozialräumliche Segregation in den Städten. Im zweiten Kapitel setze ich mich daher mit dem Phänomen der städtischen Segregation und deren Konsequenzen auseinander. Besonders interessiert mich dabei, ob die zunehmende sozialräumliche Segregation unvermeidlich negative Folgen für unterprivilegierte Bevölkerungsgruppen mit sich bringt und ein benachteiligtes Gebiet zwangsläufig auch zum benachteiligenden wird. Im letzten Kapitel befasse ich mich mit Lösungsstrategien, die einer Abwärtsentwicklung benachteiligter Stadtteile entgegenwirken können. Zunächst beschäftige ich mich dabei mit theoretischen Ausführungen und danach mit der Entwicklung von Weingarten-Ost, einem Freiburger Stadtteil, in dem überdurchschnittlich viele einkommensarme Haushalte leben.
Grundlegend ist in Anbetracht der heutigen Tendenzen die Frage, ob eine auf sozialen Ausgleich bedachte Stadtpolitik in Zeiten zunehmender sozialer Kürzungen seitens des Staates bei gleichzeitigem Anstieg von Armut noch verfolgt werden kann und ob eine solche sozialpolitische Zielsetzung überhaupt noch angestrebt wird. Mit anderen Worten: hat die soziale Stadt noch eine Zukunft?
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Die soziale Stadt
- 1.1. Die Geschichte der sozialen Stadt
- 1.2. Die Krise der sozialen Stadt
- 2. Städtische Segregation
- 2.1. Was ist Segregation in der Stadt?
- 2.2. Konsequenzen der sozialen Segregation
- 3. Lösungsansätze
- 3.1. Theorie
- 3.2. Praxis: Das Beispiel Weingarten-Ost
- 1. Die soziale Stadt
- III. Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Folgen zunehmender sozialräumlicher Segregation und wachsender Ungleichheit in deutschen Städten seit den 1970er Jahren. Sie analysiert die Krise des Konzepts der „sozialen Stadt“ im Kontext wirtschaftlicher Veränderungen und untersucht die Konsequenzen der städtischen Segregation für unterprivilegierte Bevölkerungsgruppen. Schließlich werden Lösungsansätze zur Bekämpfung der Abwärtsentwicklung benachteiligter Stadtteile diskutiert.
- Die Krise der sozialen Stadt und ihre historischen Wurzeln
- Das Phänomen der städtischen Segregation und deren Auswirkungen
- Die Frage nach der Unvermeidlichkeit negativer Folgen sozialräumlicher Segregation
- Theoretische und praktische Lösungsansätze zur Verbesserung benachteiligter Stadtteile
- Die Zukunftsfähigkeit einer auf sozialen Ausgleich bedachten Stadtpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Folgen zunehmender sozialräumlicher Segregation und Ungleichheit in deutschen Städten seit den 1970er Jahren. Sie skizziert den Zusammenhang zwischen dem Ende von Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung, der Privatisierung öffentlichen Eigentums, und dem Rückgang sozialer Zielsetzungen in der Städtepolitik. Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: die Entwicklung und Krise der sozialen Stadt, das Phänomen der städtischen Segregation mit ihren Konsequenzen, und schließlich Lösungsansätze zur Verbesserung benachteiligter Stadtteile. Die Einleitung endet mit der grundlegenden Frage nach der Zukunftsfähigkeit einer sozial ausgerichteten Stadtpolitik.
II. Hauptteil - 1. Die soziale Stadt: Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über das Konzept der sozialen Stadt und dessen Krise seit den 1970er Jahren. Es zeichnet die Entwicklung vom Hochmittelalter bis zur Gegenwart nach, wobei die soziale Funktion der Stadt im Vergleich zu ihrem Umland hervorgehoben wird. Die zunehmende soziale Ungleichheit während der Industrialisierung und ihre räumliche Manifestation in Segregation werden ebenso beleuchtet wie die städtereformerischen Bewegungen und die Bemühungen um sozialen Wohnungsbau in der Weimarer Republik und nach dem Zweiten Weltkrieg. Der Abschnitt über die Krise der sozialen Stadt analysiert die Auswirkungen des globalen und internen Strukturwandels sowie die zunehmende Konkurrenz um Produktionsstandorte. Die einsetzenden wirtschaftlichen Probleme führten zu einer Verlagerung der Prioritäten von sozialen hin zu wirtschaftlichen Zielsetzungen, was die Krise der sozialen Stadt verschärfte.
Schlüsselwörter
Soziale Segregation, soziale Stadt, Ungleichheit, Stadtentwicklung, Wirtschaftskrise, sozialer Wohnungsbau, Suburbanisierung, Lösungsansätze, Weingarten-Ost, Stadtpolitik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Folgen zunehmender sozialräumlicher Segregation und wachsender Ungleichheit in deutschen Städten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Folgen zunehmender sozialräumlicher Segregation und wachsender Ungleichheit in deutschen Städten seit den 1970er Jahren. Sie analysiert die Krise des Konzepts der „sozialen Stadt“, die Konsequenzen der städtischen Segregation für unterprivilegierte Bevölkerungsgruppen und diskutiert Lösungsansätze.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt die Krise der sozialen Stadt und ihre historischen Wurzeln, das Phänomen der städtischen Segregation und deren Auswirkungen, die Frage nach der Unvermeidlichkeit negativer Folgen sozialräumlicher Segregation, theoretische und praktische Lösungsansätze zur Verbesserung benachteiligter Stadtteile und die Zukunftsfähigkeit einer auf sozialen Ausgleich bedachten Stadtpolitik. Ein konkretes Beispiel, Weingarten-Ost, wird als Praxisbeispiel herangezogen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Eine Einleitung, einen Hauptteil und eine Schlussbemerkung. Der Hauptteil behandelt die Entwicklung und Krise der sozialen Stadt, das Phänomen der städtischen Segregation mit ihren Konsequenzen und Lösungsansätze zur Verbesserung benachteiligter Stadtteile.
Was wird in der Einleitung dargestellt?
Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach den Folgen zunehmender sozialräumlicher Segregation und Ungleichheit. Sie skizziert den Zusammenhang zwischen dem Ende von Wirtschaftswachstum und Vollbeschäftigung, der Privatisierung öffentlichen Eigentums und dem Rückgang sozialer Zielsetzungen in der Städtepolitik. Sie endet mit der Frage nach der Zukunftsfähigkeit einer sozial ausgerichteten Stadtpolitik.
Was wird im Kapitel "Die soziale Stadt" behandelt?
Dieses Kapitel bietet einen historischen Überblick über das Konzept der sozialen Stadt und dessen Krise seit den 1970er Jahren. Es zeichnet die Entwicklung vom Hochmittelalter bis zur Gegenwart nach und beleuchtet die zunehmende soziale Ungleichheit während der Industrialisierung und ihre räumliche Manifestation in Segregation. Die Auswirkungen des globalen und internen Strukturwandels und die Verlagerung der Prioritäten von sozialen hin zu wirtschaftlichen Zielsetzungen werden analysiert.
Was wird im Kapitel "Städtische Segregation" behandelt?
Dieses Kapitel befasst sich mit dem Phänomen der städtischen Segregation und ihren Konsequenzen für unterprivilegierte Bevölkerungsgruppen. Es analysiert "Was ist Segregation in der Stadt?" und die "Konsequenzen der sozialen Segregation".
Welche Lösungsansätze werden diskutiert?
Das Kapitel "Lösungsansätze" beinhaltet sowohl theoretische Überlegungen als auch ein Praxisbeispiel: Weingarten-Ost. Es werden verschiedene Strategien zur Verbesserung benachteiligter Stadtteile diskutiert.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Soziale Segregation, soziale Stadt, Ungleichheit, Stadtentwicklung, Wirtschaftskrise, sozialer Wohnungsbau, Suburbanisierung, Lösungsansätze, Weingarten-Ost, Stadtpolitik.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für ein akademisches Publikum bestimmt und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Art und Weise.
- Quote paper
- Friederike Stoller (Author), 2006, Zunehmende sozialräumliche Segregation und wachsende Ungleichheit in Deutschland - die soziale Stadt in der Krise, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62481