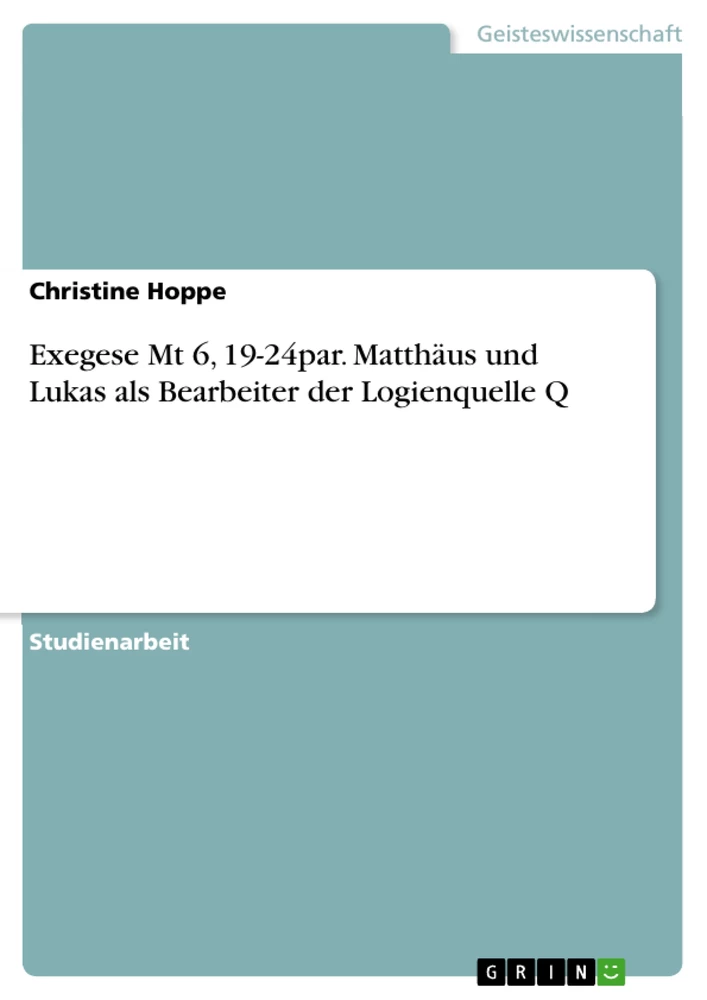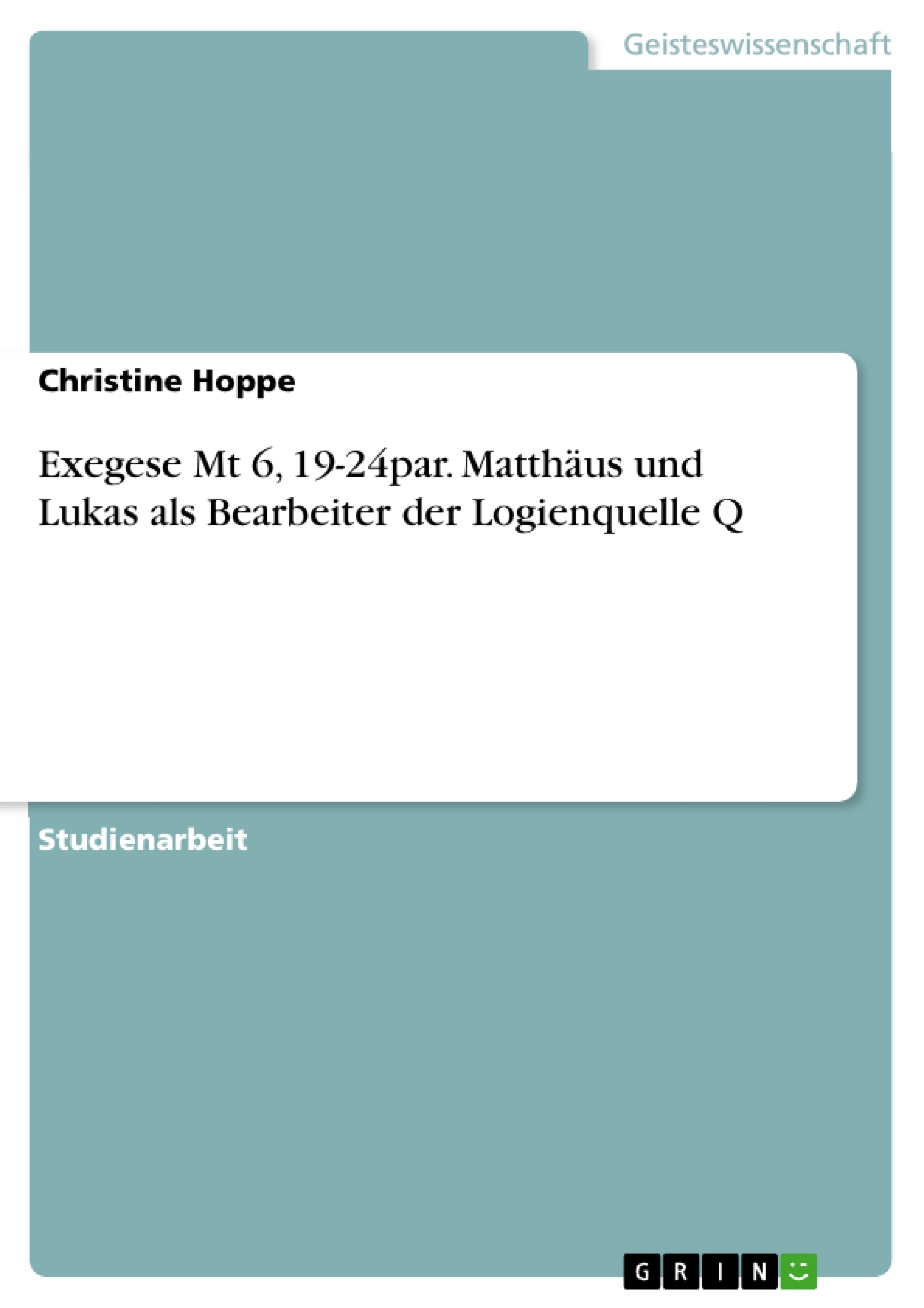Das 6. Kapitel des Matthäusevangeliums handelt hauptsächlich von der Warnung vor dem Streben nach irdischer Anerkennung. Die Komposition der Logien vom Schätze sammeln, vom Auge als Lampe des Leibes und vom Dienst zweier Herren folgt auf die Aufforderungen des Almosengebens, Fastens und Betens, in denen vor irdischer Anerkennung gewarnt wird. Inhaltlich beziehen sich die Logien auf die Warnung der vorausgehenden Verse, denn wer falsche Schätze sammelt, sein inneres Licht verdunkelt und versucht, zwei Herrn zu dienen, der versagt sich die Gnade Gottes. Dies wird im Anschluss an Vers 24 deutlich. Die Wendungδια τουτο λεγω υμινstellt den Bezug zu der Logiensammlung Mt 6,19-24 her und führt die Konsequenzen aus dem richtigen Handeln aus, nämlich dass derjenige, der nach dem Reich Gottes und Gottes Gerechtigkeit strebt, auch alle täglichen Bedürfnisse von Gott erfüllt bekommt.
Das 6. Kapitel des Matthäusevangeliums befindet sich innerhalb der Bergpredigt (Mt 5-7), in der im Sinne des Evangelisten die Lehre Jesu repräsentiert wird. Sie wird mit neun Seligpreisungen eröffnet, die in die beiden Bildworte vom Salz und Licht münden. Den Eingangsrahmen der Rede bilden 5,17-20. Die Forderung der besseren Gerechtigkeit (5,20) findet schließlich in den folgenden Antithesen exemplarisch Gestalt. Nach der Warnung vor irdischer Anerkennung folgt eine Warnung vor überheblichem Richten. Schließlich wird die Lehre der Bergpredigt mit der „goldenen Regel“ (7,12) zusammengefasst. Abschließend folgt noch eine Warnung vor „Pseudopropheten“ und das Doppelgleichnis vom Hausbau, welche das Tun der Worte Jesu einschärfen sollen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Übersetzung
- 1.1. Mt 6,19-24
- 1.2. Lk 12,33-34 (Mt 6,19-21par)
- 1.3. Lk 11,34-36 (Mt 6,22-23par)
- 1.4. Lk 16,13 (Mt 6,24par)
- 2. Die Spruchquelle Q
- 3. Textanalyse Mt 6,19-24
- 3.1. Abgrenzung des Textes und Kontextstellung
- 3.2. Textaufbau
- 4. Textanalyse Lk 12,33-34
- 4.1. Abgrenzung des Textes und Kontextstellung
- 4.2. Textaufbau
- 5. Textanalyse Lk 11,34-36
- 5.1. Abgrenzung des Textes und Kontextstellung
- 5.2. Textaufbau
- 6. Textanalyse Lk 16,13
- 6.1. Abgrenzung des Textes und Kontextanalyse
- 7. Synoptischer Vergleich
- 8. Interpretation von Mt 6,19-24
- 9. Interpretation von Lk 12,33-34 / Lk 11,34-36 / Lk 16,13
- 10. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert verschiedene Textpassagen aus den Evangelien nach Matthäus und Lukas, insbesondere die Parallelstellen zur Bergpredigt (Mt 6,19-24) und deren Beziehung zur hypothetischen Spruchquelle Q. Ziel ist es, die jeweiligen Textaufbauten, Kontexte und theologischen Implikationen zu untersuchen und einen synoptischen Vergleich durchzuführen. Die Interpretationen fokussieren auf die Bedeutung der jeweiligen Texte innerhalb des Gesamtkontextes der Evangelien.
- Analyse der Spruchquelle Q und ihrer Bedeutung für die Evangelien
- Vergleichende Textanalyse der Parallelstellen in Matthäus und Lukas
- Untersuchung der theologischen Aussagen in den ausgewählten Textpassagen
- Interpretation der zentralen Themen wie Reichtum, himmlischer Schatz und Gottesdienst
- Synoptische Betrachtung der verschiedenen Evangelien-Texte
Zusammenfassung der Kapitel
1. Übersetzung: Diese Einleitung präsentiert Übersetzungen der relevanten Passagen aus Matthäus (Mt 6,19-24) und Lukas (Lk 12,33-34; Lk 11,34-36; Lk 16,13), die die Grundlage der weiteren Analyse bilden. Der Fokus liegt auf der sprachlichen Präzision und der Vorbereitung für die anschließende textkritische und theologische Auseinandersetzung. Die verschiedenen Übersetzungen ermöglichen einen ersten Vergleich der jeweiligen Formulierungen und schaffen ein fundiertes Verständnis des Wortlauts. Die Auswahl der Verse dient der Vorbereitung der anschließenden Analyse der Spruchquelle Q und deren theologischen Implikationen.
2. Die Spruchquelle Q: Dieses Kapitel beschreibt die Spruchquelle Q, eine hypothetische Sammlung von Jesusworten, die sowohl Matthäus als auch Lukas verwendet haben. Die Diskussion konzentriert sich auf die Rekonstruktion von Q, seine theologischen Besonderheiten (z.B. das Fehlen von Leidens- und Auferstehungsberichten), seine Entstehungszeit und seinen möglichen Ursprungsort (Galiläa oder Jerusalem). Die unterschiedlichen Forschungsmeinungen zur Entstehung und Verbreitung von Q werden beleuchtet und deren Relevanz für das Verständnis der untersuchten Evangelien-Texte herausgestellt. Die eigenständige Theologie von Q und die Rolle der Wanderprediger werden ausführlich erörtert.
Schlüsselwörter
Bergpredigt, Matthäusevangelium, Lukasevangelium, Spruchquelle Q, Synoptische Evangelien, Textanalyse, Textvergleich, Theologie, Exegese, Reichtum, himmlischer Schatz, Gottesdienst, Mammon.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Analyse der Evangelien nach Matthäus und Lukas
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert verschiedene Textpassagen aus den Evangelien nach Matthäus und Lukas, insbesondere die Parallelstellen zur Bergpredigt (Mt 6,19-24) und deren Beziehung zur hypothetischen Spruchquelle Q. Der Fokus liegt auf der vergleichenden Textanalyse, der Untersuchung der theologischen Implikationen und der synoptischen Betrachtung der Texte.
Welche Textstellen werden untersucht?
Die Analyse umfasst die folgenden Textstellen: Mt 6,19-24; Lk 12,33-34; Lk 11,34-36; Lk 16,13. Diese Passagen werden einzeln und im Vergleich zueinander untersucht.
Welche Rolle spielt die Spruchquelle Q?
Ein wichtiger Aspekt der Arbeit ist die Untersuchung der hypothetischen Spruchquelle Q, einer Sammlung von Jesusworten, die sowohl Matthäus als auch Lukas verwendet haben sollen. Die Arbeit diskutiert die Rekonstruktion von Q, seine theologischen Besonderheiten, seine Entstehungszeit und seinen Ursprung. Die unterschiedlichen Forschungsmeinungen zur Entstehung und Verbreitung von Q und deren Relevanz für das Verständnis der untersuchten Evangelien-Texte werden beleuchtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel: Übersetzung der relevanten Textstellen, Analyse der Spruchquelle Q, detaillierte Textanalysen der einzelnen Evangelienabschnitte (einschließlich Abgrenzung des Textes, Kontextstellung und Textaufbau), ein synoptischer Vergleich der Texte und abschließende Interpretationen der einzelnen Texte sowie eine Zusammenfassung der Ergebnisse.
Welche Themen werden behandelt?
Zentrale Themen der Arbeit sind die Analyse der Spruchquelle Q, der vergleichende Textvergleich der Parallelstellen in Matthäus und Lukas, die Untersuchung der theologischen Aussagen in den ausgewählten Textpassagen, die Interpretation der zentralen Themen wie Reichtum, himmlischer Schatz und Gottesdienst und die synoptische Betrachtung der verschiedenen Evangelien-Texte.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bergpredigt, Matthäusevangelium, Lukasevangelium, Spruchquelle Q, Synoptische Evangelien, Textanalyse, Textvergleich, Theologie, Exegese, Reichtum, himmlischer Schatz, Gottesdienst, Mammon.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, die jeweiligen Textaufbauten, Kontexte und theologischen Implikationen der untersuchten Evangelienpassagen zu untersuchen und einen synoptischen Vergleich durchzuführen. Die Interpretationen sollen die Bedeutung der jeweiligen Texte innerhalb des Gesamtkontextes der Evangelien verdeutlichen.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet Methoden der Textanalyse, des Textvergleichs und der theologischen Interpretation. Die synoptische Methode spielt eine zentrale Rolle im Vergleich der parallelen Texte aus Matthäus und Lukas.
- Quote paper
- Christine Hoppe (Author), 2006, Exegese Mt 6, 19-24par. Matthäus und Lukas als Bearbeiter der Logienquelle Q, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62438