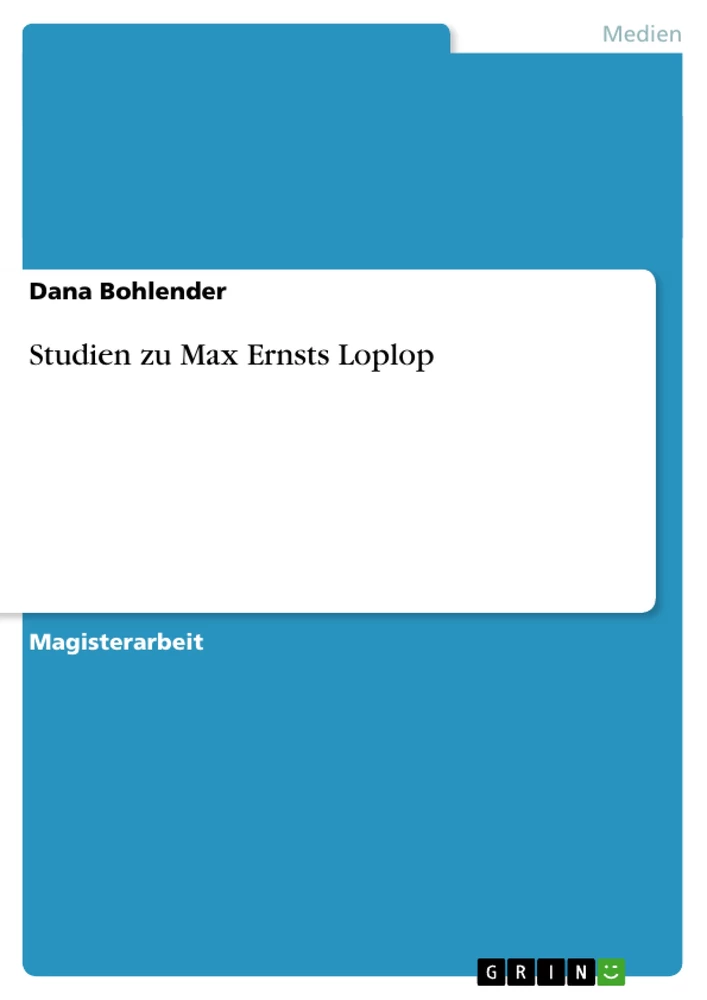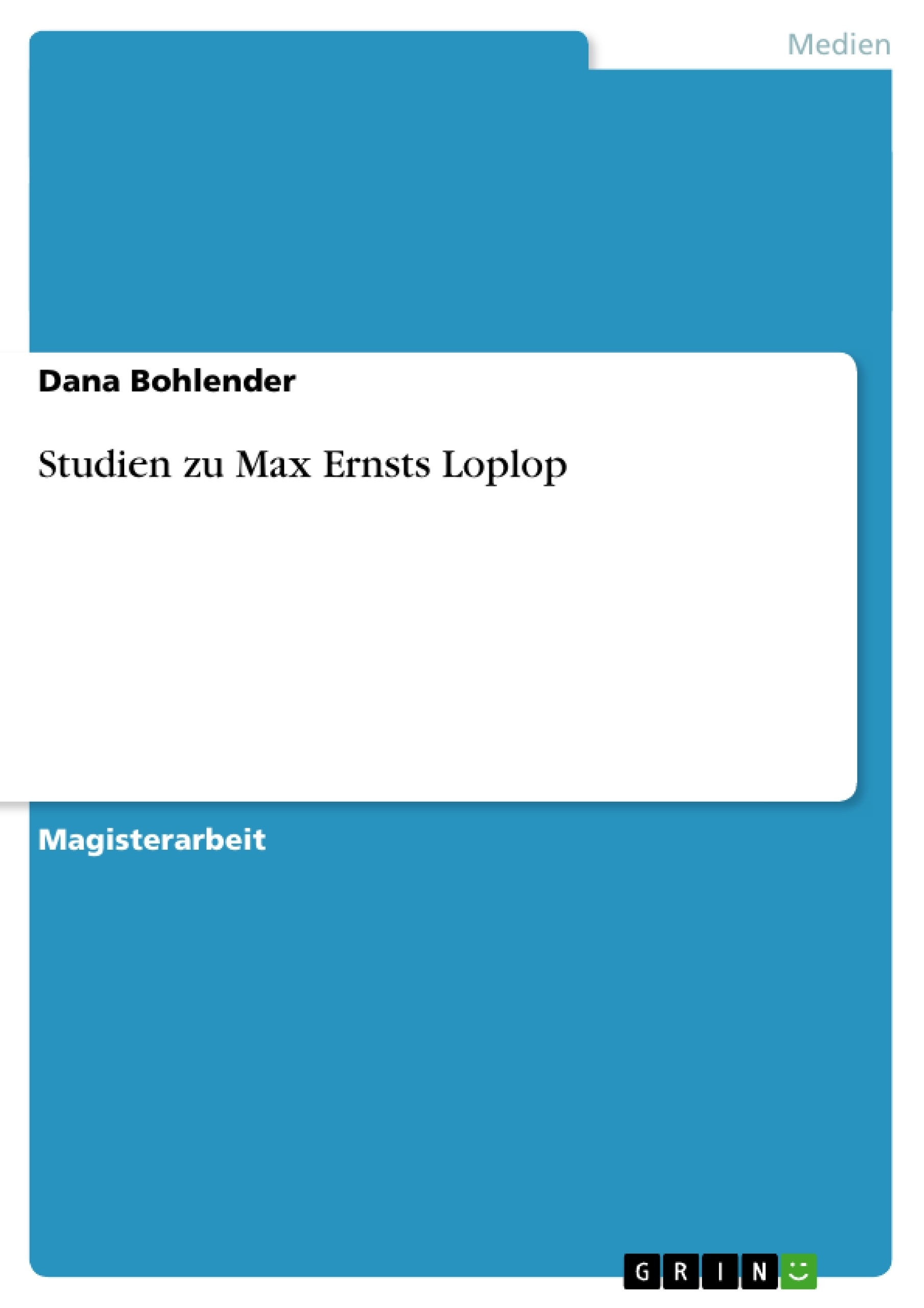Die in der Arbeit zu untersuchende Figur Loplop des Künstlers Max Ernst tritt als anthropomorphes Vogelwesen in seinem Werk auf und repräsentiert den Künstler selbst.
Schriften Ernsts berichten von Erlebnissen mit Vögeln, die dem Loplop eine biographische Bedeutung zukommen lassen und auf eine Identifikation mit der Vogelfigur hinweisen. Neben diesen biographischen Berichten hat sich Ernst nie konkret zu Loplop geäußert. Daher kursieren eine Fülle von Spekulationen über vermeintliche Quellen, die Ernst zu Loplop angeregt haben könnten und dessen Bedeutung und Funktion.
Die Vielschichtigkeit der möglichen Quellen zur Vogelfigur kann zurückgeführt werden auf Ernsts umfassende Bildung. Kenntnisse aus vielfältigen Wissensgebieten wie der Psychoanalyse, Mythologien unterschiedlicher Kulturen, aber auch Themen der Kunstgeschichte fanden Eingang in seine Kunst.
Diese Arbeit zeigt zunächst die Entwicklung der Identifikation des Künstlers mit dem Vogel in den biographischen Schriften von Ernst auf, dann den Identifikationsverlauf in seinem künstlerischen Werk von ersten Verwendungen des Vogelmotivs bis hin zum erstmalig namentlichen Auftauchen des Loplop.
Das Vogelwesen ist zudem Hauptfigur einer Serie mit dem Titel Loplop présente in den Jahren 1929 bis 1932, die hier auszugsweise vorgestellt wird.
Die Figur des Loplop taucht bemerkenswerterweise zu einer Zeit auf, da die surrealistische Gruppe, der Ernst angehörte, in einer Krise steckt. In dieser Zeit äußert sich Ernst zum ersten Mal mit theoretischen Schriften über seine künstlerischen Verfahrensweisen. Um zu einem umfassenderen Verständnis des Loplop und seiner Serie zu gelangen, ist es notwendig, diese Schriften zu untersuchen.
An diese Untersuchung schließt die Analyse der Funktion der Figur für das Werk des Künstlers an und die Rolle, die sie für seine künstlerische Selbstauffassung spielt. Eine zusätzliche Funktion ist im großen Kontext der Gruppe der Surrealisten zu sehen. Diese versuchten sich an der Erfindung kollektiver neuer Mythen. Einer dieser neuen Mythen, hier insbesondere der von der Gradiva, wurde von Salvador Dalí auf seine Frau Gala angewandt. Anhand der Gegenüberstellung von Gradiva und Loplop sollen die Gemeinsamkeiten dieser neuen Privatmythen aufgezeigt werden und ihre Rolle für die Surrealisten.
Ziel dieser Arbeit ist es, ein umfassendes Bild der komplexen Figur Loplop darzulegen, das die neuesten Entwicklungen der Forschung mit aufnimmt
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Forschungsstand
- Biographische Grundlagen zur Vogelidentifikation
- Vom Vogelmotiv zu Loplop
- Die Serie Loplop présente
- Technik und Material
- Thema der Serie
- Das Bild-im-Bild
- Erscheinungsformen des Loplop
- Collagen
- Gemalte Fassungen
- Quellen zu Loplop
- Mythologie
- Psychoanalyse
- Sigmund Freud: Eine Kindheitserinnerung des Leonardo da Vinci (1910)
- Sigmund Freud: Totem und Tabu (1912/1913)
- Carl Gustav Jung: Wandlungen und Symbole der Libido (1912)
- Theoretische Schriften Max Ernsts
- Funktion des Loplop
- im Œuvre
- als Privatmythos
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Figur des Loplop, die von dem Künstler Max Ernst geschaffen wurde. Sie beleuchtet die Entstehung dieser anthropomorphen Vogelfigur aus den biographischen Erfahrungen Ernsts und untersucht ihre Entwicklung in seinem künstlerischen Schaffen.
- Die Identifikation Ernsts mit dem Vogelmotiv und die Entstehung des Loplop.
- Die Serie Loplop présente als zentrale Darstellung der Figur.
- Die Analyse der Inspirationsquellen für Loplop in der Mythologie und Psychoanalyse.
- Die theoretischen Schriften Ernsts und ihre Bedeutung für das Verständnis des Loplop.
- Die Funktion des Loplop im Œuvre Ernsts und als Privatmythos.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Figur des Loplop und ihre Bedeutung im Werk Max Ernsts vor. Die Einleitung führt in den Forschungsstand zum Thema ein und zeigt die Vielschichtigkeit der möglichen Quellen auf.
- Forschungsstand: Dieses Kapitel zeichnet die Entwicklung der Identifikation Ernsts mit dem Vogel in seinen biographischen Schriften nach und beleuchtet die frühe Verwendung des Vogelmotivs in seinen Werken. Der Abschnitt diskutiert Spekulationen über die Herkunft des Namens "Loplop".
- Die Serie Loplop présente: Dieses Kapitel analysiert die Serie Loplop présente aus den Jahren 1929 bis 1932. Es werden die verschiedenen Techniken und Materialien, die Themen der Serie sowie die Verwendung des Bild-im-Bild-Motivs beleuchtet.
- Erscheinungsformen des Loplop: Dieses Kapitel untersucht die unterschiedlichen Erscheinungsformen des Loplop in Collagen und gemalten Fassungen. Es werden die verschiedenen Formen und Einflüsse auf die Figur anhand von Bildbeispielen verdeutlicht.
- Quellen zu Loplop: Dieses Kapitel analysiert die Quellen für die Loplop-Figur aus dem Bereich der ägyptischen und mexikanischen Mythologie sowie aus der Psychoanalyse. Im Fokus steht die Auseinandersetzung Ernsts mit den Schriften Sigmund Freuds und die mögliche Inspiration durch Carl Gustav Jung.
- Theoretische Schriften Max Ernsts: Dieses Kapitel untersucht die theoretischen Schriften Ernsts, die Einblicke in seine künstlerischen Verfahrensweisen bieten. Die Analyse der Schriften ermöglicht ein tieferes Verständnis des Loplop und seiner Serie.
- Funktion des Loplop: Dieses Kapitel beleuchtet die Funktion des Loplop im Werk Ernsts und analysiert die Rolle der Figur für seine künstlerische Selbstauffassung. Zusätzlich wird die Funktion des Loplop im Kontext der Surrealisten und der Entwicklung neuer Privatmythen betrachtet.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit konzentriert sich auf die Figur des Loplop, eine anthropomorphe Vogelfigur im Werk des Künstlers Max Ernst. Es werden zentrale Themenbereiche wie die Identifikation des Künstlers mit dem Vogelmotiv, die Serie Loplop présente, die Inspiration aus Mythologie und Psychoanalyse, die theoretischen Schriften Ernsts und die Funktion des Loplop im Kontext seines Œuvres und der surrealistischen Bewegung untersucht.
- Quote paper
- Dana Bohlender (Author), 2005, Studien zu Max Ernsts Loplop, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/62016