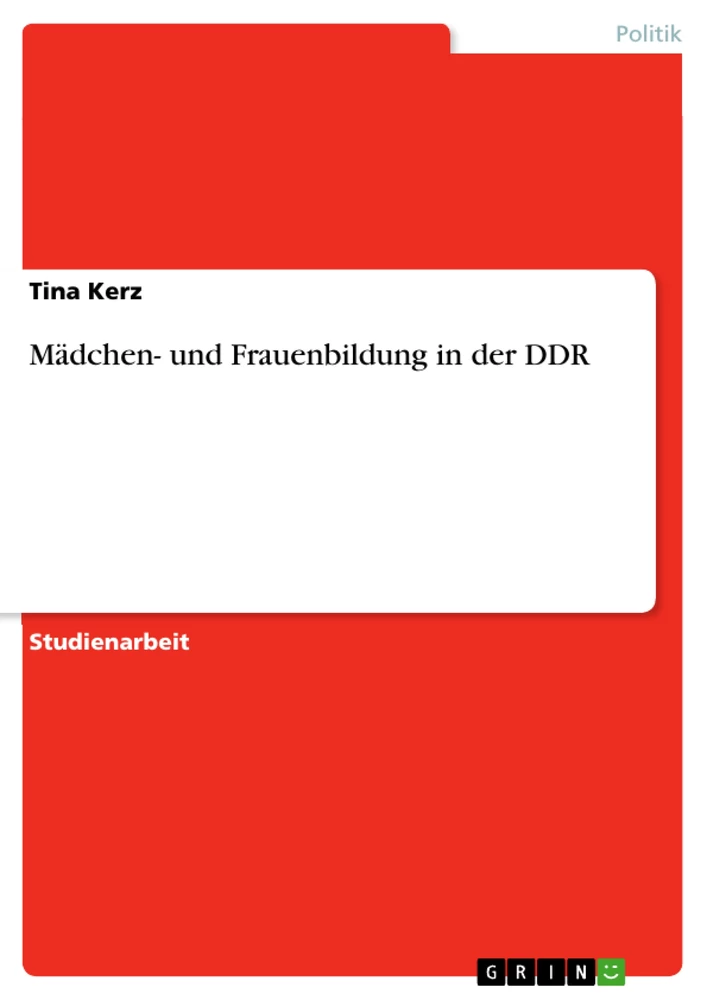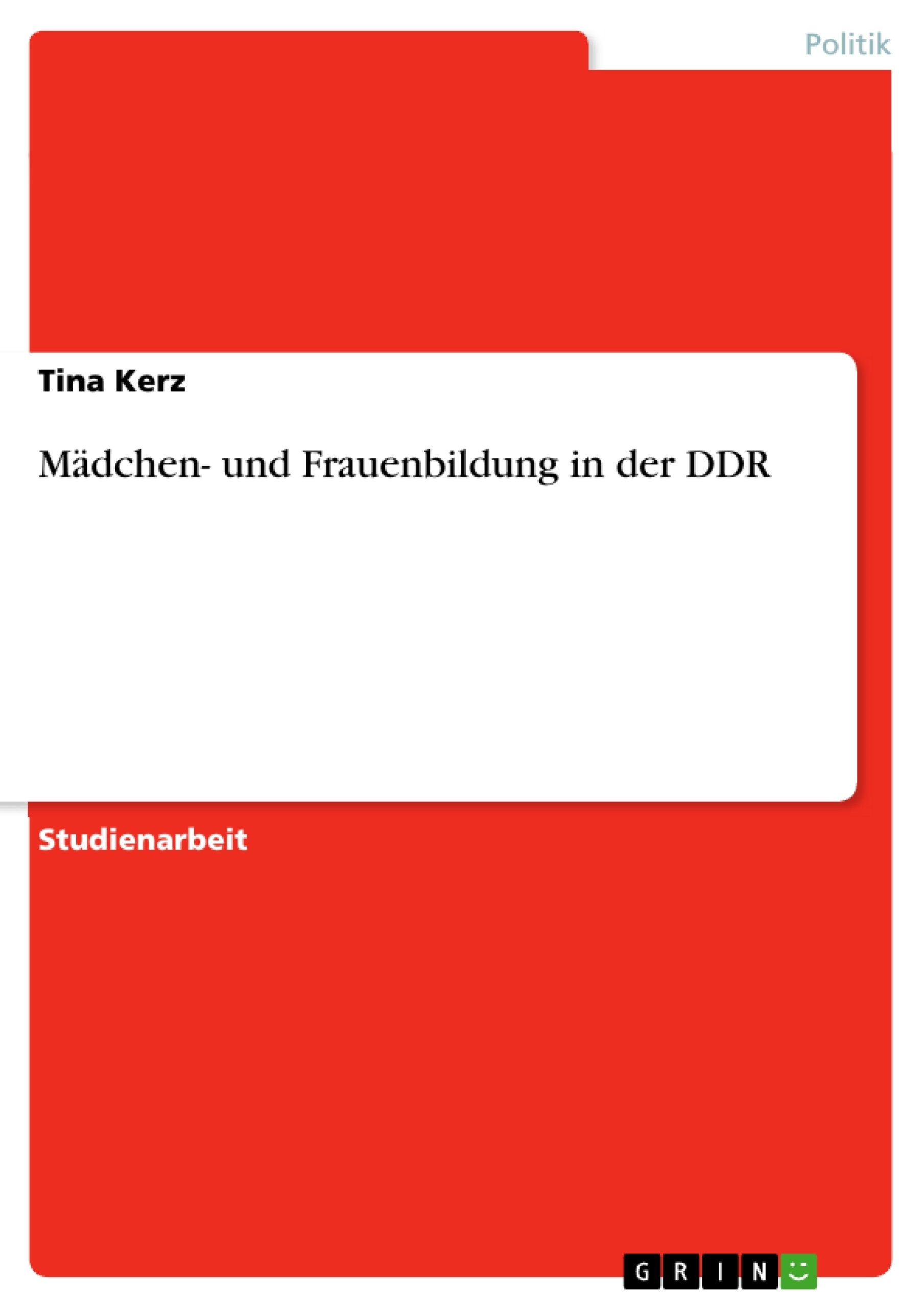In dem Buch der Tagesschausprecherin Eva Hermann, „Das Eva-Prinzip. Für eine neue Weiblichkeit“ (Hermann 2006), fordert die Autoren die Frauen auf, sich wieder mehr auf ihre Pflichten als Hausfrau und Mutter zu besinnen. Die Inhalte würden sich sicherlich nicht mit der Frauenpolitik der Staatspartei der Deutschen Demokratischen Republik (DDR), der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands (SED), vertragen. In ihrem politischen Programm versucht die SED die traditionellen Mädchen- und Weiblichkeitsbilder zu überwinden. Sie fordert auf Grund ihrer sozialistischen Ideologie eine gleichberechtigte Partizipation der Frauen am Arbeitsprozess, denn nur dadurch könnten sich die Frauen emanzipieren. Um dieses Ziel zu erreichen, erfordert es allerdings auch, die weibliche Bevölkerung gleichberechtigt an Bildung zu beteiligen. Ziel der SED ist folglich, den Mädchen und Frauen gleiche Bildungschancen wie den Jungen und Männern einzuräumen, nicht nur in der allgemeinen Grundbildung, sondern vor allem auch in weiterführenden schulischen sowie in der beruflichen Aus- und Weiterbildung.
Thema dieser Arbeit ist die Mädchen- und Frauenbildung in der DDR. Dabei soll vor allem im Fokus der Betrachtungen stehen, ob das von der SED postulierte Ziel, der gleichberechtigten Beteiligung der Frauen an der schulischen und beruflichen Bildung, erreicht wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- SED-Frauenpolitik
- Prinzip der Koedukation
- Frauen im Bildungswesen der DDR
- Polytechnische allgemeine Bildung
- Lehrausbildung
- Hochschulbildung
- Berufliche Aus- und Weiterbildung
- Blick in die Praxis
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Mädchen- und Frauenbildung in der DDR und analysiert, ob das von der SED postulierte Ziel der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen an schulischer und beruflicher Bildung erreicht wurde. Die Arbeit beleuchtet die Frauenpolitik der SED, das Prinzip der Koedukation und die Bildungschancen von Frauen in verschiedenen Bereichen des ostdeutschen Bildungssystems.
- SED-Frauenpolitik und ihre Ziele bezüglich der Gleichberechtigung von Frauen
- Umsetzung des Prinzips der Koedukation im Bildungssystem der DDR
- Analyse der Bildungschancen von Frauen in der polytechnischen allgemeinen Bildung, Lehrausbildung, Hochschulbildung und beruflichen Aus- und Weiterbildung
- Bewertung der tatsächlichen Gleichberechtigung im Bildungsbereich
- Praxisbezogene Betrachtung der Thematik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung setzt die Arbeit in den Kontext der Debatte um die Rolle der Frau in der Gesellschaft, kontrastiert die Positionen Eva Hermanns mit der Frauenpolitik der SED und formuliert die Forschungsfrage nach dem tatsächlichen Erfolg der SED-Bemühungen um Gleichberechtigung im Bildungsbereich für Frauen. Die methodische Vorgehensweise der Arbeit wird skizziert, die einzelnen Kapitel werden kurz angekündigt.
SED-Frauenpolitik: Dieses Kapitel beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der SED-Frauenpolitik, ausgehend von den unmittelbaren Nachkriegsjahren bis in die Zeit der DDR. Es werden die sozioökonomischen und ideologischen Hintergründe der SED-Frauenpolitik erläutert, unter Berücksichtigung des hohen Männerverlusts im Krieg und der marxistisch-leninistischen Ideologie, die die Emanzipation der Frau durch die Beteiligung am Produktionsprozess forderte. Die vier Phasen der SED-Frauenpolitik werden beschrieben und konkrete Maßnahmen zur Förderung der Frauen, wie z.B. die Antifaschistischen Frauenausschüsse, der Befehl Nr. 253 der SMAD und die Resolution zur Frauenfrage von 1947, werden als Beispiele genannt.
Prinzip der Koedukation: Dieses Kapitel behandelt das in der DDR propagierte Prinzip der Koedukation, die gemeinsame und gleiche Bildung von Mädchen und Jungen. Es untersucht die Bedeutung dieses Prinzips im Kontext der SED-Frauenpolitik und analysiert dessen praktische Umsetzung im Bildungssystem der DDR. Die Bedeutung der Gleichberechtigung im Bildungsbereich im Hinblick auf die spätere Erwerbstätigkeit und die ökonomische Unabhängigkeit der Frauen wird hervorgehoben.
Frauen im Bildungswesen der DDR: Dieses Kapitel analysiert die Bildungschancen von Frauen in den verschiedenen Bereichen des ostdeutschen Bildungssystems. Es werden die polytechnische allgemeine Bildung, die Lehrausbildung, die Hochschulbildung und die berufliche Aus- und Weiterbildung untersucht, wobei der Fokus auf der Umsetzung des koedukativen Prinzips und den tatsächlichen Bildungschancen und Fördermaßnahmen für Frauen liegt. Es werden die Unterschiede zwischen der Theorie der Gleichberechtigung und der tatsächlichen Situation beleuchtet.
Blick in die Praxis: Dieses Kapitel bietet eine praxisbezogene Betrachtung der Thematik, indem es konkrete Beispiele und Fallstudien aus der DDR-Zeit präsentiert. Es ergänzt die theoretischen Ausführungen der vorherigen Kapitel durch reale Erfahrungen von Frauen und beleuchtet etwaige Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis der Gleichberechtigung im Bildungssystem. Es dient der Veranschaulichung der theoretischen Ergebnisse.
Schlüsselwörter
Mädchenbildung, Frauenbildung, DDR, SED-Frauenpolitik, Koedukation, Gleichberechtigung, Bildungssystem, Polytechnische Oberschule, Lehrausbildung, Hochschulbildung, Berufsausbildung, Sozialismus, Emanzipation, Frauenarbeit.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Mädchen- und Frauenbildung in der DDR
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Mädchen- und Frauenbildung in der DDR und analysiert, ob das von der SED postulierte Ziel der gleichberechtigten Beteiligung von Frauen an schulischer und beruflicher Bildung erreicht wurde. Die Arbeit beleuchtet die Frauenpolitik der SED, das Prinzip der Koedukation und die Bildungschancen von Frauen in verschiedenen Bereichen des ostdeutschen Bildungssystems.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit umfasst die SED-Frauenpolitik und ihre Ziele, die Umsetzung der Koedukation im DDR-Bildungssystem, eine Analyse der Bildungschancen von Frauen in verschiedenen Bildungsbereichen (polytechnische allgemeine Bildung, Lehrausbildung, Hochschulbildung, berufliche Aus- und Weiterbildung), eine Bewertung der tatsächlichen Gleichberechtigung und eine praxisbezogene Betrachtung der Thematik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zur SED-Frauenpolitik, zum Prinzip der Koedukation, zu Frauen im Bildungswesen der DDR (mit Unterkapiteln zu den verschiedenen Bildungsbereichen), einen Blick in die Praxis und ein Fazit. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung stellt die Arbeit in den Kontext der Debatte um die Rolle der Frau in der Gesellschaft, kontrastiert die Positionen Eva Hermanns mit der Frauenpolitik der SED und formuliert die Forschungsfrage nach dem tatsächlichen Erfolg der SED-Bemühungen um Gleichberechtigung im Bildungsbereich für Frauen. Die methodische Vorgehensweise und die einzelnen Kapitel werden kurz vorgestellt.
Was ist der Inhalt des Kapitels zur SED-Frauenpolitik?
Dieses Kapitel beleuchtet die geschichtliche Entwicklung der SED-Frauenpolitik von den Nachkriegsjahren bis zur DDR-Zeit. Es erläutert sozioökonomische und ideologische Hintergründe, unter Berücksichtigung des Männerverlusts im Krieg und der marxistisch-leninistischen Ideologie. Die vier Phasen der SED-Frauenpolitik werden beschrieben, und konkrete Maßnahmen zur Förderung der Frauen werden als Beispiele genannt.
Was wird im Kapitel zum Prinzip der Koedukation behandelt?
Dieses Kapitel behandelt das in der DDR propagierte Prinzip der Koedukation (gemeinsame Bildung von Mädchen und Jungen). Es untersucht dessen Bedeutung im Kontext der SED-Frauenpolitik und die praktische Umsetzung im Bildungssystem der DDR. Die Bedeutung der Gleichberechtigung im Bildungsbereich für die spätere Erwerbstätigkeit und ökonomische Unabhängigkeit der Frauen wird hervorgehoben.
Worauf konzentriert sich das Kapitel "Frauen im Bildungswesen der DDR"?
Dieses Kapitel analysiert die Bildungschancen von Frauen in der polytechnischen allgemeinen Bildung, Lehrausbildung, Hochschulbildung und beruflichen Aus- und Weiterbildung. Der Fokus liegt auf der Umsetzung des koedukativen Prinzips und den tatsächlichen Bildungschancen und Fördermaßnahmen für Frauen. Unterschiede zwischen Theorie und Praxis der Gleichberechtigung werden beleuchtet.
Was beinhaltet der "Blick in die Praxis"?
Dieses Kapitel bietet eine praxisbezogene Betrachtung anhand konkreter Beispiele und Fallstudien aus der DDR-Zeit. Es ergänzt die theoretischen Ausführungen durch reale Erfahrungen von Frauen und beleuchtet Diskrepanzen zwischen Theorie und Praxis der Gleichberechtigung im Bildungssystem.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Mädchenbildung, Frauenbildung, DDR, SED-Frauenpolitik, Koedukation, Gleichberechtigung, Bildungssystem, Polytechnische Oberschule, Lehrausbildung, Hochschulbildung, Berufsausbildung, Sozialismus, Emanzipation, Frauenarbeit.
- Quote paper
- Tina Kerz (Author), 2006, Mädchen- und Frauenbildung in der DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61986