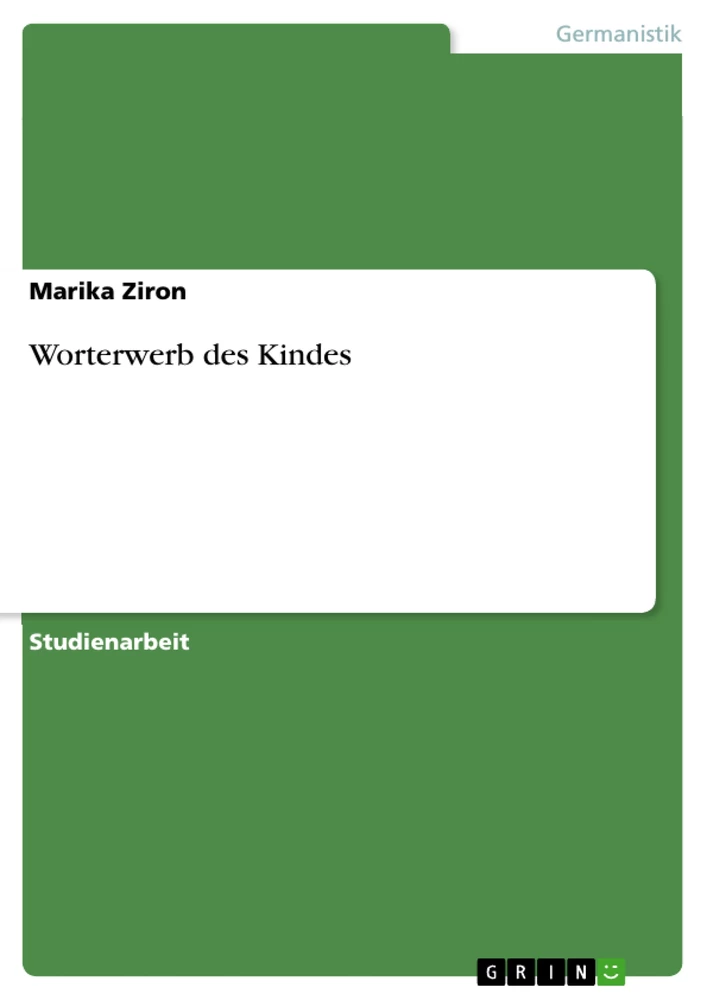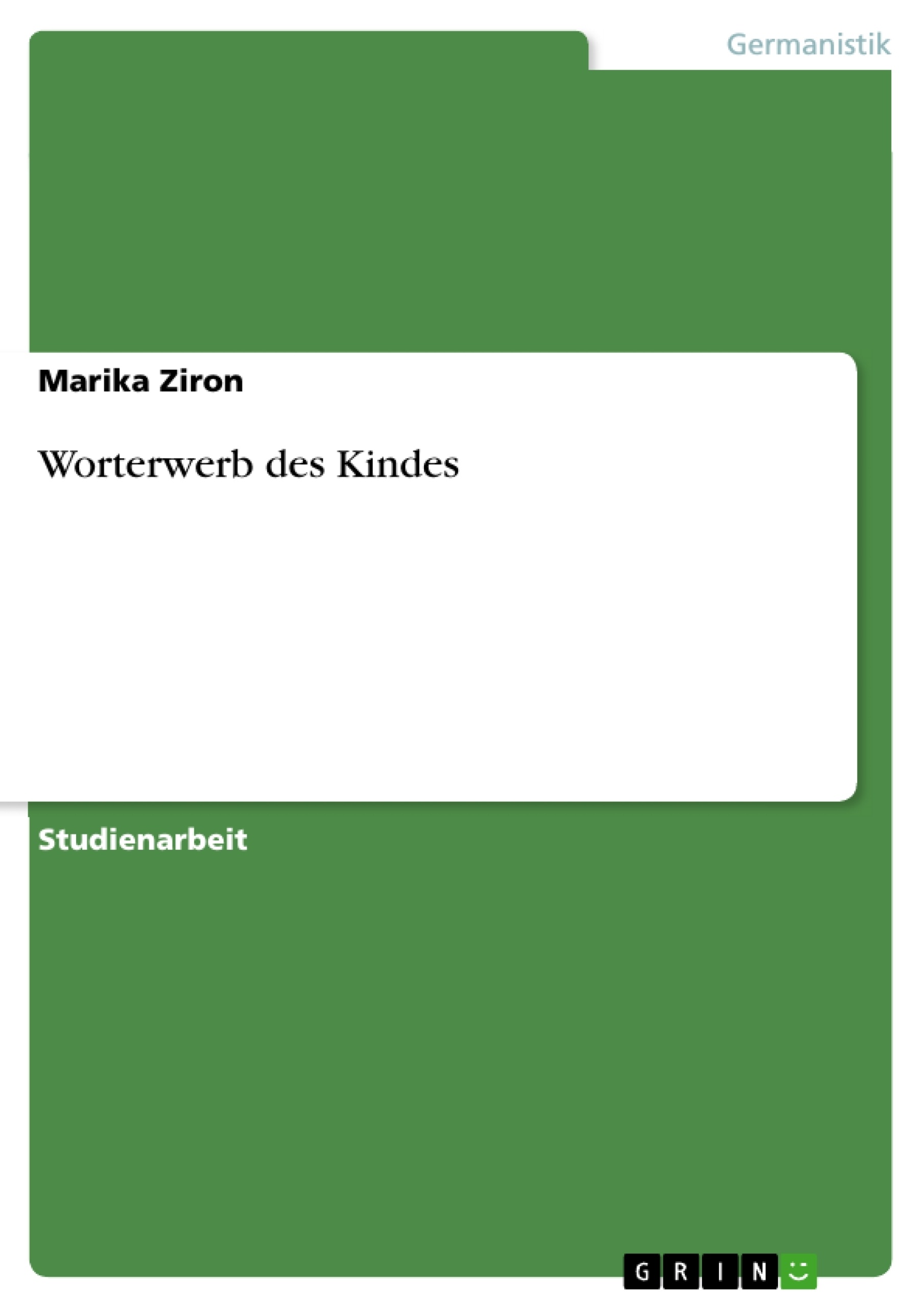„When people speak in language, that is totally unfamiliar to us, we have no way of understanding what they are trying to say. Prelinguistik infants are in an even worse situation. Not only do they not know what adults are trying to say, they do not even know that adults are trying to say something.”
Das ist die Situation, in der sich Kinder befinden. Sie werden in eine Welt hinein geboren, in der Kommunikation fast ausschließlich durch Sprache funktioniert, ohne zu wissen, was Sprache überhaupt ist. Ohne eine Idee von sprachlichen Zeichen ist jedes Wort, jeder Satz und jede Äußerung eines Erwachsenen nur ein Geräusch ohne Inhalt.
Doch Kinder erlernen Sprache sehr schnell, schon in der Phase zwischen dem ersten und dem zweiten Lebensjahr beginnen sie mit anderen über Sprache zu kommunizieren. Aber wie kann dies geschehen? Dazu gibt es in der Wissenschaft verschiedenste Theorien, die auf verschiedenste Voraussetzungen zurückgehen. Da gibt es zum Beispiel die Vertreter der generativen Grammatik, die von einer angeborenen Universalgrammatik ausgehen. Sie formulieren die These, dass wenn etwas partout nicht rein durch input erlernt werden kann, es von Anfang an da gewesen sein muss. Neben vielen weiteren Theorien, von denen ich mich in dieser Arbeit mit zweien näher beschäftigen möchte, existiert auch die Theorie des Lexikonerwerbs, der vorrangig von der sozialen Lernumgebung und pragmatischen Prinzipien bestimmt wird. In den letzen Jahren erregt diese Theorie in der Wissenschaft immer mehr Aufsehen und findet Zuspruch. Von welchen Voraussetzungen dieser Ansatz ausgeht, wie er den Erwerb von sprachlichen Zeichen erklärt und welche Vor- und Nachteile er gegenüber anderen Theorien besitzt, möchte ich im Rahmen dieser Arbeit klären.
Ich beginne zunächst mit einer Darstellung der Besonderheiten der menschlichen Sprache gegenüber Kommunikationsformen nicht menschlicher Individuen.
Um den Spracherwerb zu erklären, muss zunächst untersucht werden, wann Sprache als aktiver Teil in das Leben des Kindes tritt, und wie ihr Verlauf sich in den ersten Lebensjahren darstellt. Zu diesem Zweck möchte ich kurz den Verlauf des Worterwerbs in der Ontogenese des Kindes skizzieren, bevor ich zu der Vorstellung der drei heute am meisten in der Diskussion stehenden Erklärungsversuche des Lexikonerwerbs übergehe. Dabei möchte ich versuchen, die für die einzelnen Theorien jeweils relevantesten Annahmen herauszufiltern und diese gegenüber zu stellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hauptteil
- Besonderheiten menschlicher Kommunikation durch Sprache
- Erwerb des kindlichen Lexikons
- Die vorsprachliche Phase
- Verlauf des Worterwerbs in der Ontogenese
- Theorien des Worterwerbs
- Lerntheorie
- Constraints and Principles
- Kritik an der Theorie der Constraints und Principles
- Sozial-Pragmatische Theorie
- Schluss
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Erwerb des kindlichen Lexikons und analysiert verschiedene Theorien, die diesen Prozess erklären. Der Fokus liegt insbesondere auf der Sozial-Pragmatischen Theorie, die den Erwerb von sprachlichen Zeichen aus der sozialen Lernumgebung und pragmatischen Prinzipien ableitet. Die Arbeit beleuchtet die Voraussetzungen dieser Theorie, erklärt, wie sie den Erwerb von sprachlichen Zeichen erklärt, und vergleicht sie mit anderen Theorien.
- Besonderheiten der menschlichen Sprache im Vergleich zu tierischer Kommunikation
- Verlauf des Worterwerbs in der Ontogenese des Kindes
- Vorstellung verschiedener Theorien zum Lexikonerwerb
- Analyse und Vergleich der Theorien
- Bewertung der Sozial-Pragmatischen Theorie
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Spracherwerbs ein und stellt die Situation des Kindes dar, das in eine Welt geboren wird, in der Kommunikation fast ausschließlich durch Sprache funktioniert. Die Arbeit behandelt verschiedene Theorien, die den Spracherwerb erklären, wobei der Fokus auf der Sozial-Pragmatischen Theorie liegt.
Im Hauptteil werden zunächst die Besonderheiten der menschlichen Sprache im Vergleich zu tierischer Kommunikation beleuchtet. Anschließend wird der Verlauf des Worterwerbs in der Ontogenese des Kindes skizziert. Es folgt die Vorstellung von drei heute am häufigsten diskutierten Erklärungsversuchen des Lexikonerwerbs: die Lerntheorie, die Theorie der Constraints and Principles und die Sozial-Pragmatische Theorie. Die Arbeit analysiert und vergleicht diese Theorien, wobei sie die relevantesten Annahmen herausfiltert.
Schlüsselwörter
Spracherwerb, Lexikonerwerb, Ontogenese, Universalgrammatik, Constraints and Principles, Sozial-Pragmatische Theorie, Kommunikation, tierische Kommunikation, menschliche Sprache, Referentialität, Symbole, soziale Lernumgebung, pragmatische Prinzipien.
- Quote paper
- Marika Ziron (Author), 2006, Worterwerb des Kindes, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61890