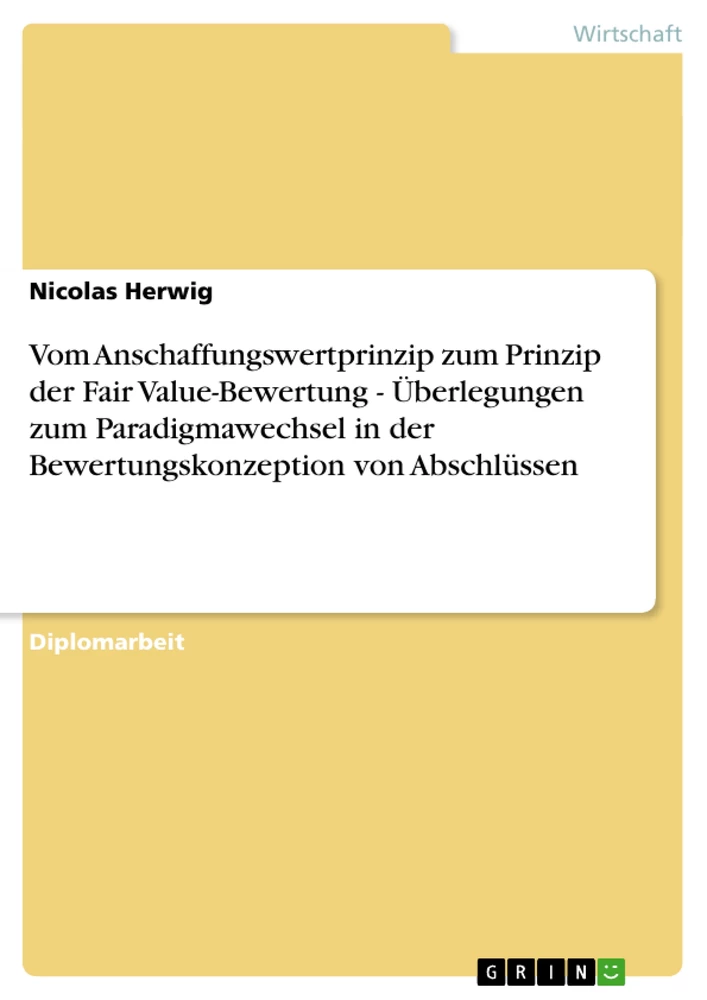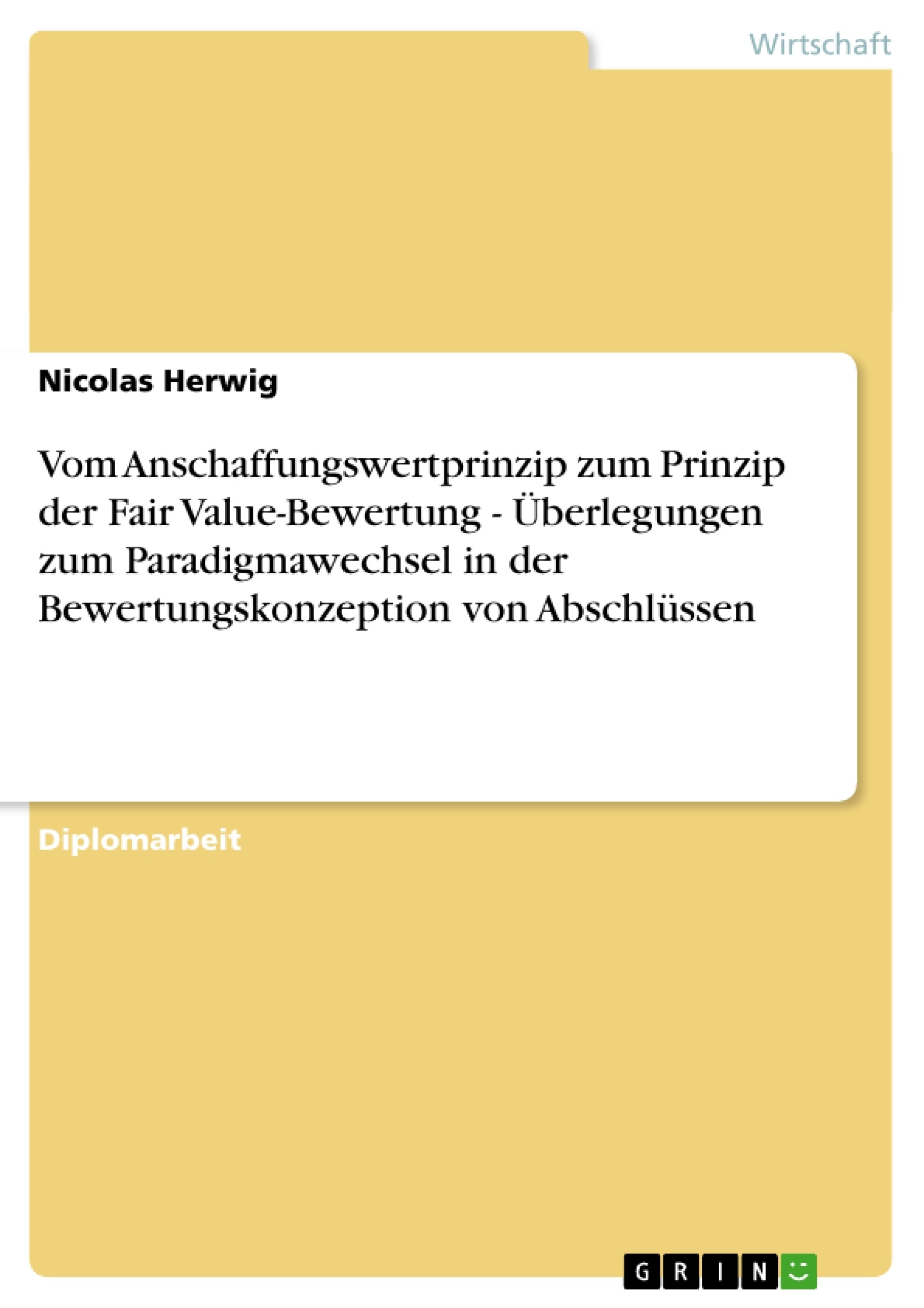1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
Angesichts der zunehmenden Globalisierung der Güter- und Kapitalmärkte befinden sich die Rechnungslegungsnormen seit einigen Jahren im Umbruch. Die Investoren verlangen als Folge dieser Globalisierung eine international vergleichbare Rechnungslegung, die ihnen als Informationsinstrument für ihre Investitionsentscheidungen zur Verfügung steht. In diesem Zusammenhang wird einer internationalen Rechnungslegung eine zunehmende Bedeutung zuteil.
Die gesetzlichen Rahmenbedingung zur Umstellung auf International Financial Reporting Standards (IFRS) wurden von Parlament und Ministerrat der Europäischen Union (EU) am 19.7.2002 durch die sog. IAS-Verordnung1 geschaffen. Danach werden sämtliche kapitalmarktorientierte Unternehmen verpflichtet ihre Konzernabschlüsse ab dem 01.01.2005 bzw. 01.01.2007 nach den geltenden internationalen Rechnungslegungsstandards aufzustellen. In Deutschland sind etwa 1340 Unternehmen2 (ca. 1010 Unternehmen2 davon mit Sitz in Deutschland) betroffen, da ihre Wertpapiere auf einem geregelten Markt zugelassen sind.3 Nach Schätzung der Europäischen Kommission sind seit 2005 europaweit 7000 Unternehmen von dieser Regelung betroffen.4
Den Mitgliedstaaten wurde darüber hinaus ein Wahlrecht eingeräumt, die IFRS sowohl im Einzelabschluss als auch für nicht-kapitalmarktorientierte Gesellschaften anzuwenden. Seit der Verabschiedung des Bilanzrechtsreformgesetzes (BilReG) im Dezember 2004 dürfen Große Kapitalgesellschaften i. S. des § 267 Abs. 3 HGB ihre Einzelabschlüsse gem. § 325 Abs. 2a HGB zu Informationszwecken auch nach IFRS veröffentlichen.5
Neben den Unternehmen, denen die Umstellung auf die IFRS durch den europäischen Gesetzgeber verordnet wurde, gibt es allerdings auch Unternehmen, die aus Eigeninteresse beabsichtigen ihre Rechnungslegung auf die IFRS-Rechnungslegung umzustellen oder diese bereits umgestellt haben. Die Gründe hierfür liegen insbesondere in der Herstellung einer besseren Vergleichbarkeit mit anderen Konzernen und in den gestiegenen Anforderungen internationaler Fremd- und Eigenkapitalgeber. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung und Zielsetzung der Arbeit
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2 Konzeptionelle Grundlagen eines handelsrechtlichen Jahresabschlusses
- 2.1 Kontinentaleuropäisches Normensystem
- 2.2 Zwecke und Grundsätze einer Rechnungslegung nach dem HGB
- 2.2.1 Buchführungs- und Jahresabschlusszwecke des HGB
- 2.2.2 Rechtsnatur, Entstehung und Ableitung von Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung
- 2.2.3 Exkurs: True and Fair View i. S. d. § 264 Abs. 2 HGB
- 2.3 Funktionen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses
- 2.4 Grundlagen der Bewertungskonzeption des HGB
- 2.4.1 Vorbemerkungen
- 2.4.2 Das Anschaffungswertprinzip
- 2.4.3 Die Besonderheiten bei der Ausgestaltung des Bewertungsrechts nach § 252 Abs. 1 Nr. 4 HGB
- 2.4.4 Ausgewählte Einzelvorschriften der Bewertung
- 2.5 Zwischenergebnis
- 3 Konzeptionelle Grundlagen der IFRS
- 3.1 Das Anglo-Amerikanische Normensystem
- 3.2 Institutioneller Rahmen - Ziele, Entwicklung und Bedeutung
- 3.3 Das Framework
- 3.3.1 Vorbemerkungen
- 3.3.2 Zwecke, Ziele und Adressaten von IFRS-Abschlüssen
- 3.3.3 Grundlegende Anforderungen an die Rechnungslegung
- 3.3.4 Die Generalnorm der Fair Presentation
- 3.3.5 Kapitalkonzeptionen
- 3.4 Das Konzept der Fair Value-Bewertung
- 3.5 Ausprägungen der Fair Value-Bewertung in ausgewählten Standards
- 3.6 Das Prinzip der Ertragsrealisation und weitere grundlegende Anforderungen
- 3.7 Zwischenergebnis
- 4 Überlegungen zu einem möglichen Paradigmawechsel
- 4.1 Allgemeine Voraussetzungen für einen Paradigmawechsel
- 4.2 Auslöser eines Paradigmawechsels
- 4.2.1 Internationalisierung und Harmonisierung der Rechnungslegung
- 4.2.2 Internationalisierung der Rechnungslegungsvorschriften des HGB
- 4.3 Die Bedeutung des Paradigmawechsels für die Rechnungslegung
- 4.4 Der Wechsel des Rechnungslegungssystems als Erscheinungsform eines Paradigmawechsels
- 4.4.1 Die IFRS als maßgebendes Rechnungslegungssystems
- 4.4.2 Die Zweckmäßigkeit einer Fair Value-Bewertung
- 4.4.3 Die Gewährleistung des Gläubigerschutzes im Rahmen eines Paradigmawechsels
- 4.4.4 Zwischenergebnis und Ausblick
- 4.5 Der Wechsel der Bewertungskonzeption als Erscheinungsform eines Paradigmawechsels
- 4.5.1 Möglichkeiten und Probleme einer Fair Value-Bewertung nach HGB
- 4.5.2 Lösungsmöglichkeiten für die Zahlungsbemessung im Rahmen eines Paradigmawechsels
- 4.5.3 Zwischenergebnis und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Paradigmawechsel in der Bewertungskonzeption von Abschlüssen und untersucht die Auswirkungen der zunehmenden Bedeutung der Fair Value-Bewertung im Kontext des handelsrechtlichen Jahresabschlusses. Ziel ist es, die konzeptionellen Grundlagen des Anschaffungswertprinzips und der Fair Value-Bewertung zu beleuchten und die Herausforderungen und Chancen eines möglichen Paradigmawechsels zu analysieren.
- Entwicklung und Bedeutung des Anschaffungswertprinzips im deutschen Handelsrecht
- Konzeptionelle Grundlagen der Fair Value-Bewertung im internationalen Kontext
- Internationalisierung und Harmonisierung der Rechnungslegung
- Auswirkungen eines möglichen Paradigmawechsels auf die Rechnungslegung
- Chancen und Risiken einer Fair Value-Bewertung im deutschen Kontext
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1 führt in die Problemstellung der Arbeit ein und beschreibt die Zielsetzung sowie den Gang der Untersuchung.
- Kapitel 2 beleuchtet die konzeptionellen Grundlagen des handelsrechtlichen Jahresabschlusses nach dem HGB, insbesondere die Zwecke und Grundsätze der Rechnungslegung sowie die Grundlagen der Bewertungskonzeption.
- Kapitel 3 untersucht die konzeptionellen Grundlagen der IFRS, insbesondere das Framework, die Fair Value-Bewertung und die Anforderungen an die Rechnungslegung.
- Kapitel 4 analysiert die Voraussetzungen, Auslöser und Auswirkungen eines möglichen Paradigmawechsels in der Bewertungskonzeption von Abschlüssen. Der Fokus liegt dabei auf der Internationalisierung und Harmonisierung der Rechnungslegung, der Bedeutung der Fair Value-Bewertung und den Chancen und Risiken eines Wechsels zu einem Fair Value-basierten Rechnungslegungssystem.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind das Anschaffungswertprinzip, die Fair Value-Bewertung, der Paradigmawechsel in der Bewertungskonzeption von Abschlüssen, die Internationalisierung und Harmonisierung der Rechnungslegung sowie der Gläubigerschutz im Rahmen eines möglichen Wechsels zu einem Fair Value-basierten Rechnungslegungssystem.
- Citation du texte
- Diplom-Kaufmann Nicolas Herwig (Auteur), 2005, Vom Anschaffungswertprinzip zum Prinzip der Fair Value-Bewertung - Überlegungen zum Paradigmawechsel in der Bewertungskonzeption von Abschlüssen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61663