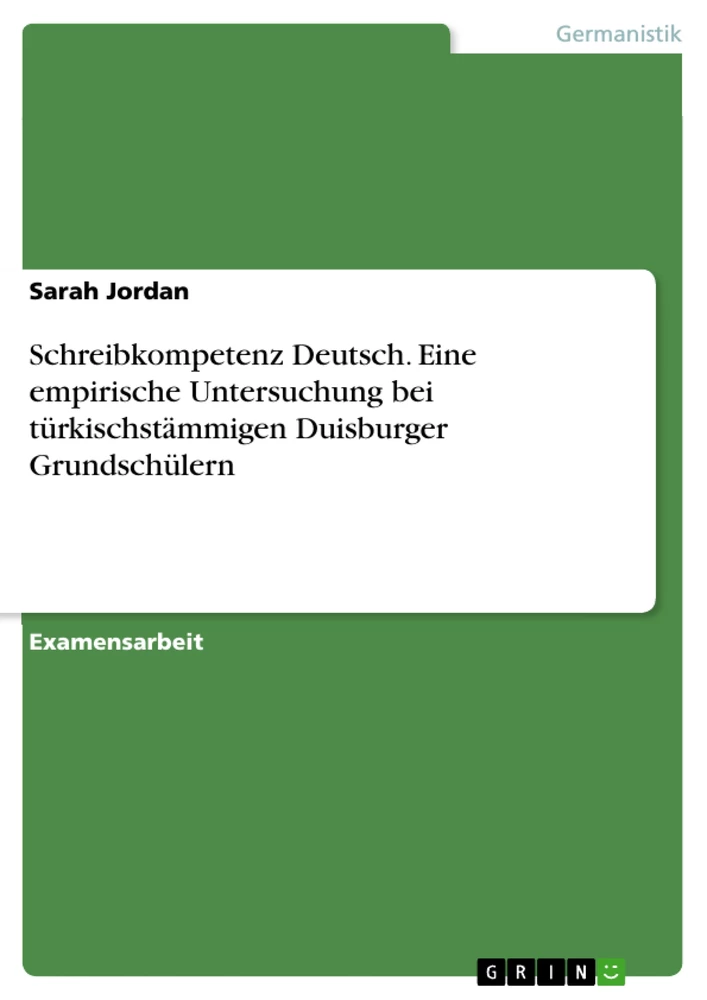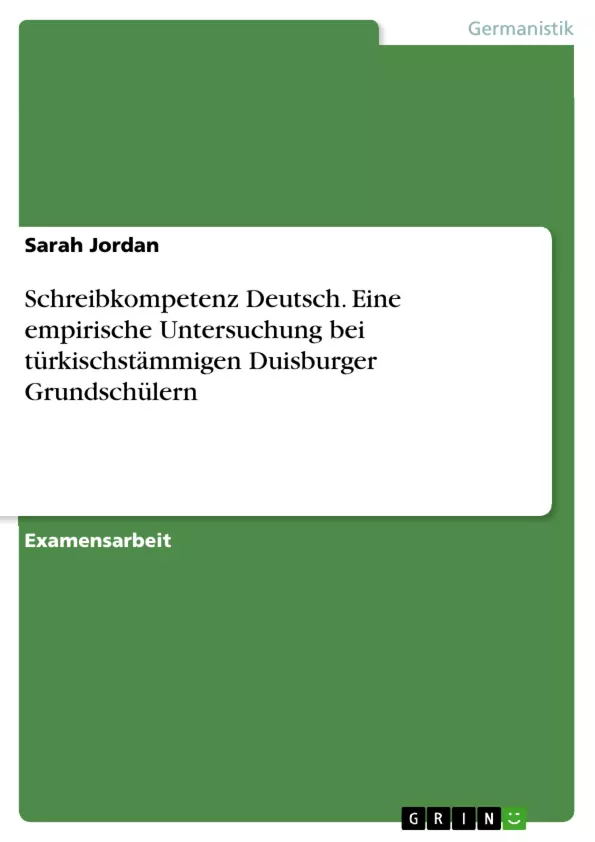In Deutschland leben derzeit etwa 7,3 Millionen Ausländer, darunter über 1,7 Millionen türkischstämmige Menschen. Über 411 000 Schüler mit türkischem Hintergrund besuchen allgemein bildende deutsche Schulen. In Nordrhein-Westfalen beträgt der Anteil von Kindern und Jugendlichen mit Migrationshintergrund in den Schulen rund ein Drittel und wird Prognosen zufolge insbesondere in städtischen Kerngebieten in den nächsten 10 bis 15 Jahren auf 50 Prozent und mehr ansteigen.
Wie deutsche Kinder werden auch Kinder mit Migrationshintergrund in der Schule vor die Herausforderung gestellt, sich in der deutschen Sprache mündlich und schriftlich adäquat auszudrücken, da dies zur erfolgreichen Teilnahme am Unterricht unerlässlich ist. Die genannten Zahlen über den Anteil an Migranten in deutschen Schulen und die Tatsachen, dass überdurchschnittlich viele Schüler mit Migrationshintergrund die Schule ohne einen Abschluss verlassen und viele andere nur niedrige Abschlüsse erreichen, zeigen, wie dringend notwendig es ist, die deutsche Sprache bei Kindern mit Migrationshintergrund zu fördern. Das Erlernen der deutschen Sprache und Schrift ist nämlich nicht nur ein wichtiger Faktor zur gesellschaftlichen Integration, sondern ebenso der Schlüssel zur Bildung, denn es ist unbestreitbar, dass Bildungschancen zwingend an die Beherrschung der Sprache – und besonders der Schriftsprache – gekoppelt sind.
Doch wie gut sind die Deutschkenntnisse von Migrantenkindern?
Diese Arbeit erhebt die Schreibkompetenz von Primarstufenschülern mit Migrationshintergrund am Beispiel von türkischstämmigen Schülern, da diese in deutschen Klassen mit circa 17 Prozent im Verhältnis zur Gesamtschülerzahl einen enormen Anteil stellen. Es wird eine Analyse und Einschätzung der derzeitigen Schreibkompetenz zweier türkischer Gruppen in der deutschen Sprache vorgenommen. Zudem werden die Texte der türkischen Kinder mit Texten von deutschen Kindern verglichen, wodurch mögliche Ursachen für Fehler abgeleitet werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Sprache und Schrift bei Bilingualität
- 1.1 Aspekte der Sprachlichkeit
- 1.1.1 Muttersprache – Erstsprache
- 1.1.2 Zweitsprache
- 1.1.3 Bilingualität
- 1.2 Aspekte der Schriftlichkeit
- 1.2.1 Prozesse beim Erwerb des Schreibens
- 1.2.2 Bedingungen des Schreiberwerbs bei Bilingualität
- 1.2.3 Ursachen für Probleme und Fehler des Schreiberwerbs unter Bedingung von Bilingualität
- 2 Sprachstandsdiagnostik
- 2.1 Stand der Forschung
- 2.2 Indikatoren zur Auswertung von Sprachstandserhebungen
- 2.3 Indikatoren dieser Untersuchung
- 2.3.1 Wortschatz
- 2.3.2 Nomen
- 2.3.3 Verben
- 2.3.4 Syntax
- 2.4 Fazit
- 3 Analyse des Umfelds und der sprachlichen Voraussetzungen der Untersuchungsgruppe
- 3.1 Zur Auswahl der Grundschulen
- 3.2 Einverständnis der Eltern
- 3.3 Beschreibung der Test- und Vergleichsgruppen
- 3.4 Analyse der sprachlichen Voraussetzungen der Testgruppe
- 3.5 Ableitung möglicher Ursachen für Fehler und Probleme beim Schreiben
- 4 Testkonzeption
- 4.1 Testmaterial
- 4.2 Lernvoraussetzungen der Testklassen
- 4.3 Konzeptionelle und didaktische Konsequenzen
- 5 Auswertung
- 5.1 Wortschatz
- 5.1.1 Wortschatzgröße
- 5.1.2 Wortschatzqualität
- 5.1.3 Fazit
- 5.2 Nomen
- 5.2.1 Genusselektion
- 5.2.2 Nominalflexion
- 5.2.3 Fazit
- 5.3 Verben
- 5.3.1 Verbflexion
- 5.3.2 Verbarten
- 5.3.3 Fazit
- 5.4 Syntax
- 5.4.1 Satzformen
- 5.4.2 VE-, VL-Sätze und fehlerhafte Syntax
- 5.4.3 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse der Schreibkompetenz von türkischstämmigen Grundschülern in Duisburg. Sie analysiert die sprachlichen Voraussetzungen dieser Schüler und untersucht, welche Faktoren ihre Schreibkompetenz beeinflussen.
- Sprachliche Herausforderungen von bilingualen Kindern im Schreiberwerb
- Analyse der Schreibkompetenz anhand von Sprachstandserhebungen
- Faktoren, die den Schreiberwerb von türkischstämmigen Grundschülern beeinflussen
- Empirische Untersuchung der Schreibkompetenz anhand von Testdaten
- Ableitung von didaktischen Konsequenzen für den Deutschunterricht
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den Rahmen für die Untersuchung dar, indem sie die Bedeutung des Themas und den aktuellen Stand der Forschung beleuchtet. Kapitel 1 befasst sich mit den Aspekten der Sprachlichkeit und Schriftlichkeit bei Bilingualität und beleuchtet die Herausforderungen für den Schreiberwerb. Kapitel 2 analysiert den Stand der Forschung zur Sprachstandsdiagnostik und beschreibt die verwendeten Indikatoren. Kapitel 3 befasst sich mit der Analyse des Umfelds und der sprachlichen Voraussetzungen der Untersuchungsgruppe. Kapitel 4 erläutert die Konzeption des verwendeten Tests. Kapitel 5 präsentiert die Ergebnisse der Auswertung der Testdaten.
Schlüsselwörter
Schreibkompetenz, Bilingualität, Deutsch als Zweitsprache, Sprachstandsdiagnostik, türkischstämmige Grundschüler, empirische Untersuchung, didaktische Konsequenzen
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die Schreibkompetenz von Migrantenkindern erhoben?
Die Arbeit nutzt Sprachstandsdiagnostik und analysiert Wortschatz, Nomen, Verben und Syntax in den Texten türkischstämmiger Grundschüler.
Welche Probleme treten beim Schreiberwerb unter Bilingualität auf?
Häufige Ursachen für Fehler sind Transferleistungen aus der Erstsprache, Schwierigkeiten bei der Genusselektion (der/die/das) und komplexe Satzstrukturen im Deutschen.
Warum ist die Beherrschung der Schriftsprache so wichtig?
Schriftsprache ist der Schlüssel zur Bildung und gesellschaftlichen Integration, da Bildungschancen in Deutschland eng an sprachliche Kompetenzen gekoppelt sind.
Was sind die Indikatoren für die Sprachstandserhebung?
Untersucht werden die Wortschatzgröße und -qualität, die korrekte Nominalflexion sowie die Verwendung verschiedener Satzformen (Syntax).
Welche didaktischen Konsequenzen ergeben sich für den Unterricht?
Notwendig ist eine gezielte Förderung des Wortschatzes und der Grammatik, die auf die spezifischen Lernvoraussetzungen bilingualer Kinder eingeht.
- Quote paper
- Sarah Jordan (Author), 2006, Schreibkompetenz Deutsch. Eine empirische Untersuchung bei türkischstämmigen Duisburger Grundschülern, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61489