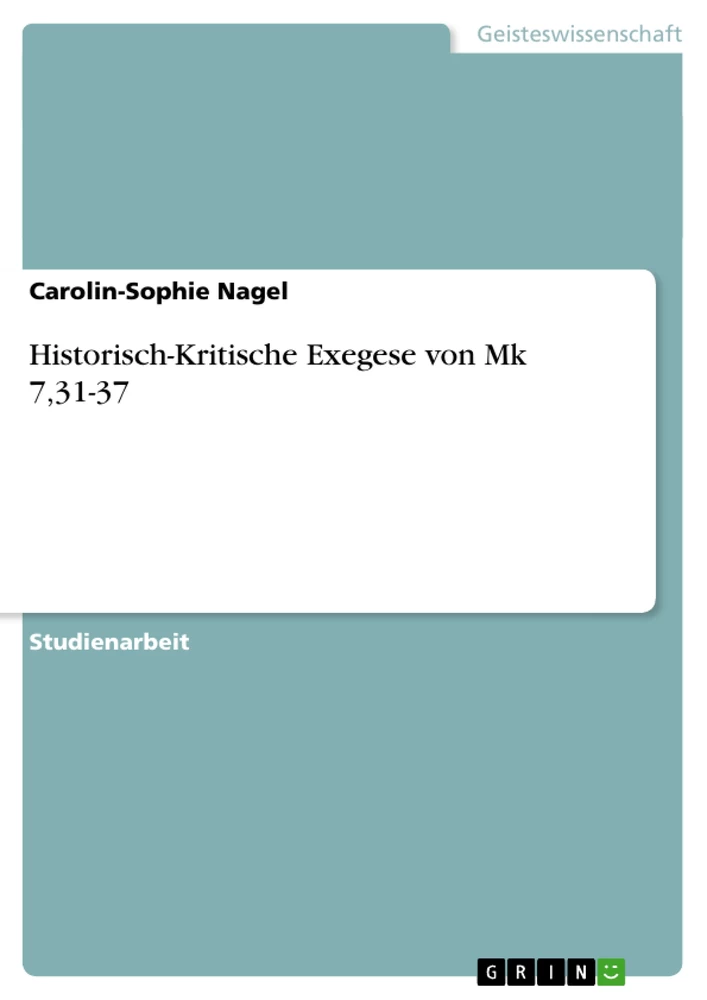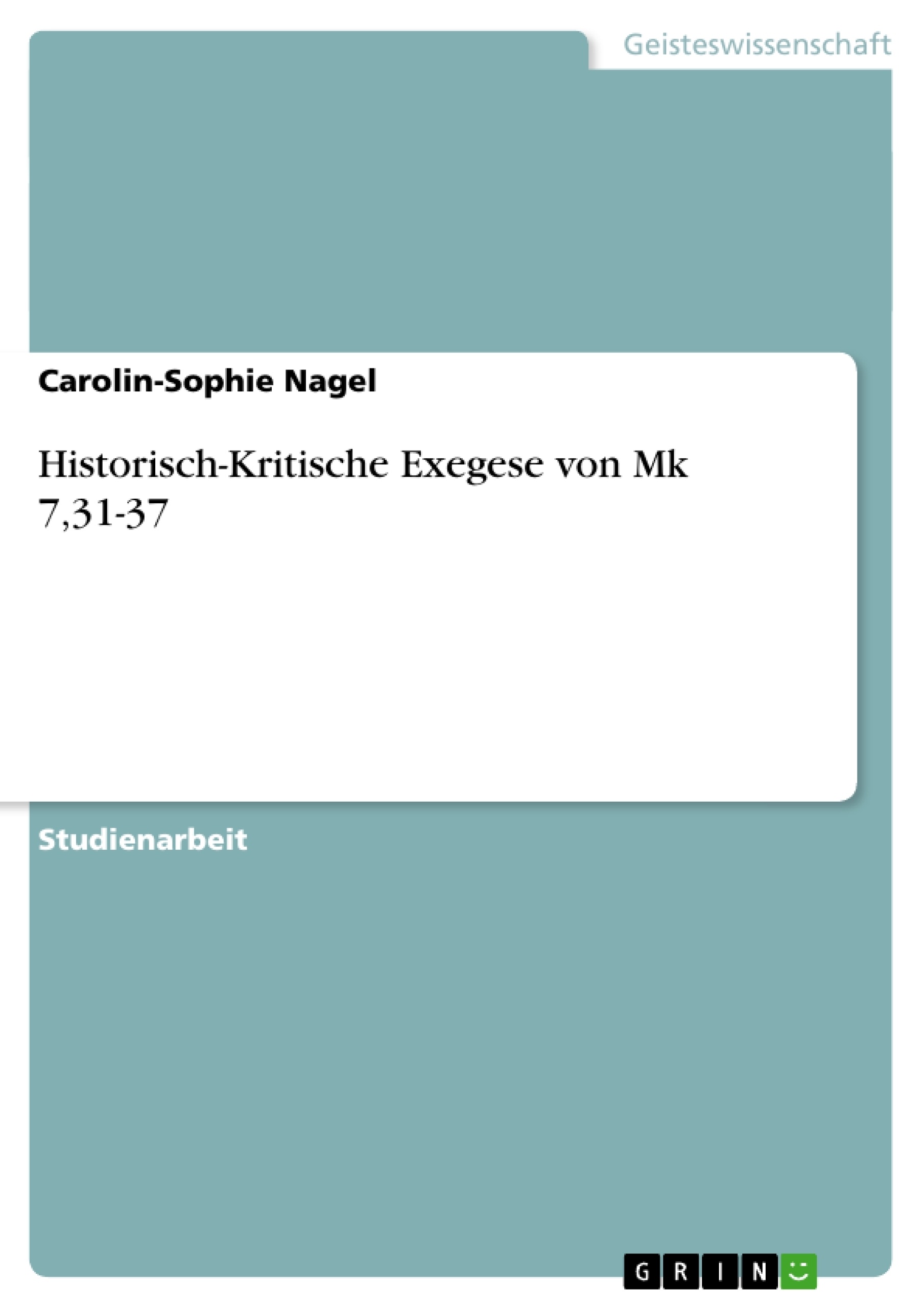Wer einen neutestamentlichen Text auslegen möchte, sollte ihn - wie jeden antiken Text - zunächst als historisches Dokument ernst nehmen. Im Bereich der Wissenschaft ist die sog. historisch - kritische Methode der Versuch, dies in angemessener Weise zu berücksichtigen. "`Historisch` muss diese Methode vorgehen, weil die biblischen Texte in einer weit zurückliegenden Zeit und unter Bedingungen einer vergangenen Epoche entstanden sind. `Kritisch` will sie sein nicht im Sinne des Besserwissens und aufgrund von Vorurteilen, sondern im Sinne des griechischen Wortes krinein, d.h. um unterscheiden zu können - unterscheiden zwischen damaligen und heutigen Verstehensbedingungen,... unterscheiden (aber) auch zwischen den verschiedenen Teilen und Schriften der Bibel, um sie je in ihrer Besonderheit zu erfassen."
Um ihr Ziel zu erreichen, d.h. eine Einzelschrift in seiner spezifischen Aussageintention so exakt wie möglich zu erfassen, gliedert sich die historisch - kritische Methode auf in mehrere Methodenschritte, die den Text je aus ihrer Perspektive untersuchen will (z.B. formgeschichtlich, literargeschichtlich etc.), um sozusagen Schritt für Schritt zum Verständnis des Textes beizutragen. Intersubjektiv nachvollziehbar wird ein solches methodengeleitetes Vorgehen jedoch meines Erachtens nur dann, wenn diese Perspektive, aus der heraus argumentiert wird, stets ganz deutlich ist. Daher werden in der folgenden Arbeit z.B. formgeschichtliche Schlüsse möglichst nur aus formgeschichtlichen Beobachtungen gezogen. Freilich ist dies nicht immer möglich; dort aber, wo die Perspektive wechseln muss, wird auf den Übergang zu anderen Methodenschritten hingewiesen. Wichtig ist: Der Zusammenhang zwischen einer Beobachtung und ihrem exegetischen "Ertrag" muss klar sein. Um diesem Anspruch möglichst gerecht zu werden, wird in dieser Arbeit der Weg eines methodischen "Nacheinander" gegangen, d.h. erst folgt die synchrone, dann die diachrone, erst die litergeschichtliche, dann die redaktionsgeschichtliche Analyse etc.. Es möge dem Leser überlassen bleiben, auch in diesem Vorgehen noch das Ineinandergreifen der verschiedenen exegetischen Werkzeuge, ja vielleicht auch die fortlaufende Argumentationslinie in dieser zunächst streng gegliedert scheinenden Auslegung zu entdecken.
Ein Wort noch zu der Quellenangabe. Als Hauptquelle dient mir die Bibel in ihrer Einheitsübersetzung und wird daher auch nicht weiter in den Fußnoten angemerkt.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1.0 Einleitung
- 1.1 Aufbau der Historisch-Kritischen Exegese
- 1.2 Gliederung des Textes
- 2.0 Hauptteil
- 2.1 Literarkritik – Die Frage nach dem historischen Wachstum des Textes
- 2.1.1 Kontextanalyse
- 2.1.2 Kohärenz- und Inkohärenzkriterien
- 2.1.3 Synoptischer Vergleich
- 2.2 Linguistik – Die Frage nach dem grammatischen Aufbau, den inhaltlichen Aussagen und den beabsichtigten Wirkungen des Textes
- 2.2.1 Syntaktische Analyse
- 2.2.2 Semantische Analyse
- 2.2.3 Pragmatische Analyse
- 2.2.4 Narrative Analyse
- 2.3 Formgeschichte – Die Frage nach der Gemeinde Hinter den einzelnen Texten einer Gattung
- 2.3.1 Gattung
- 2.3.2 Der „Sitz im Leben“
- 2.4 Traditionsgeschichte – Die Frage nach der außer- und innergemeindlichen Tradition des Textes
- 2.5 Redaktions- und Kompositionskritik – Die Frage Nach dem Autor/dem Redaktor eines Textes
- 3.0 Schlussteil
- 3.1 Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der historisch-kritischen Exegese des neutestamentlichen Textes Mk 7,31-37. Ziel ist es, durch die Anwendung verschiedener exegetischer Methoden einen umfassenden Einblick in den Text zu gewinnen und seine Aussageintention zu verstehen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Entstehung des Textes, seine sprachliche Struktur, seine gattungsgeschichtliche Einordnung und seine Rezeption innerhalb der christlichen Tradition beleuchtet.
- Historisch-kritische Analyse des Textes Mk 7,31-37
- Anwendung verschiedener exegetischer Methoden (Literarkritik, Linguistik, Formgeschichte, Traditionsgeschichte, Redaktionskritik)
- Rekonstruktion der Entstehung und Entwicklung des Textes
- Analyse der sprachlichen und literarischen Struktur des Textes
- Einordnung des Textes in die Gattung der Wundergeschichten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Aufbau der historisch-kritischen Exegese erläutert und die Gliederung des Textes vorstellt. Der Hauptteil beschäftigt sich mit der Anwendung verschiedener exegetischer Methoden auf den Text Mk 7,31-37. Zunächst wird die Literarkritik angewendet, um die Frage nach dem historischen Wachstum des Textes zu untersuchen. Dabei werden verschiedene Aspekte wie die Kontextanalyse, die Kohärenz- und Inkohärenzkriterien sowie der synoptische Vergleich betrachtet. Die Linguistik beschäftigt sich mit der Frage nach dem grammatischen Aufbau, den inhaltlichen Aussagen und den beabsichtigten Wirkungen des Textes. Hier werden die syntaktische Analyse, die semantische Analyse, die pragmatische Analyse und die narrative Analyse durchgeführt. Die Formgeschichte untersucht die Frage nach der Gemeinde hinter den einzelnen Texten einer Gattung. In diesem Zusammenhang werden die Gattung des Textes und sein „Sitz im Leben“ analysiert. Die Traditionsgeschichte befasst sich mit der Frage nach der außer- und innergemeindlichen Tradition des Textes. Schließlich untersucht die Redaktions- und Kompositionskritik die Frage nach dem Autor/dem Redaktor eines Textes. Der Schlussteil der Arbeit fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Schlüsselwörter
Historisch-kritische Exegese, Mk 7,31-37, Literarkritik, Linguistik, Formgeschichte, Traditionsgeschichte, Redaktionskritik, Kontextanalyse, Kohärenz- und Inkohärenzkriterien, Synoptischer Vergleich, Syntaktische Analyse, Semantische Analyse, Pragmatische Analyse, Narrative Analyse, Gattung, Sitz im Leben, Wundergeschichte.
- Quote paper
- Carolin-Sophie Nagel (Author), 2001, Historisch-Kritische Exegese von Mk 7,31-37, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6138