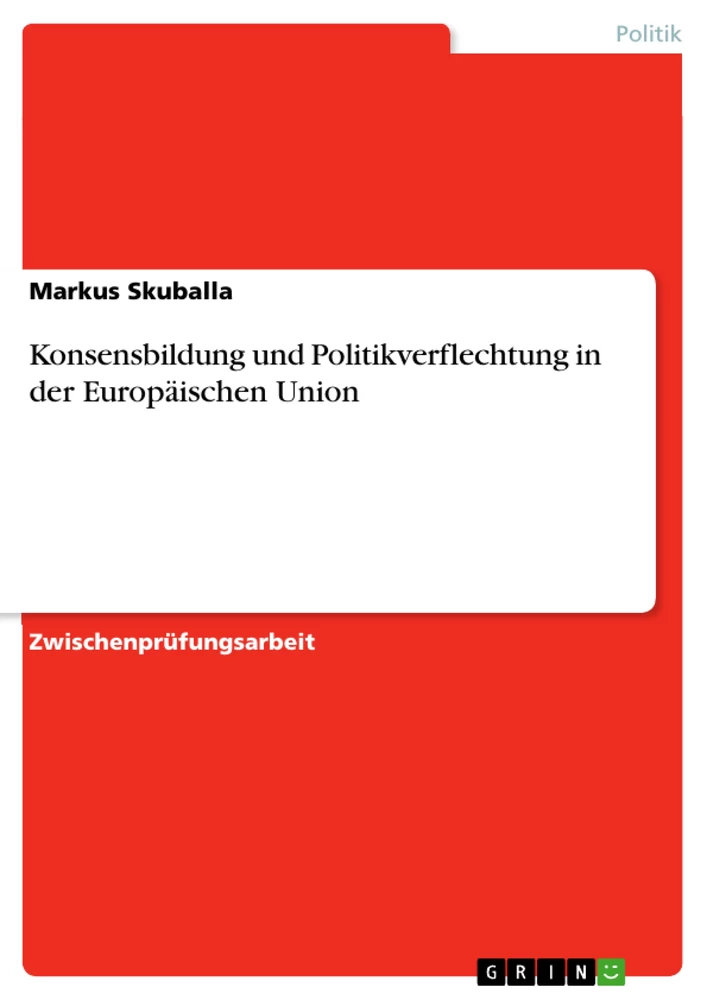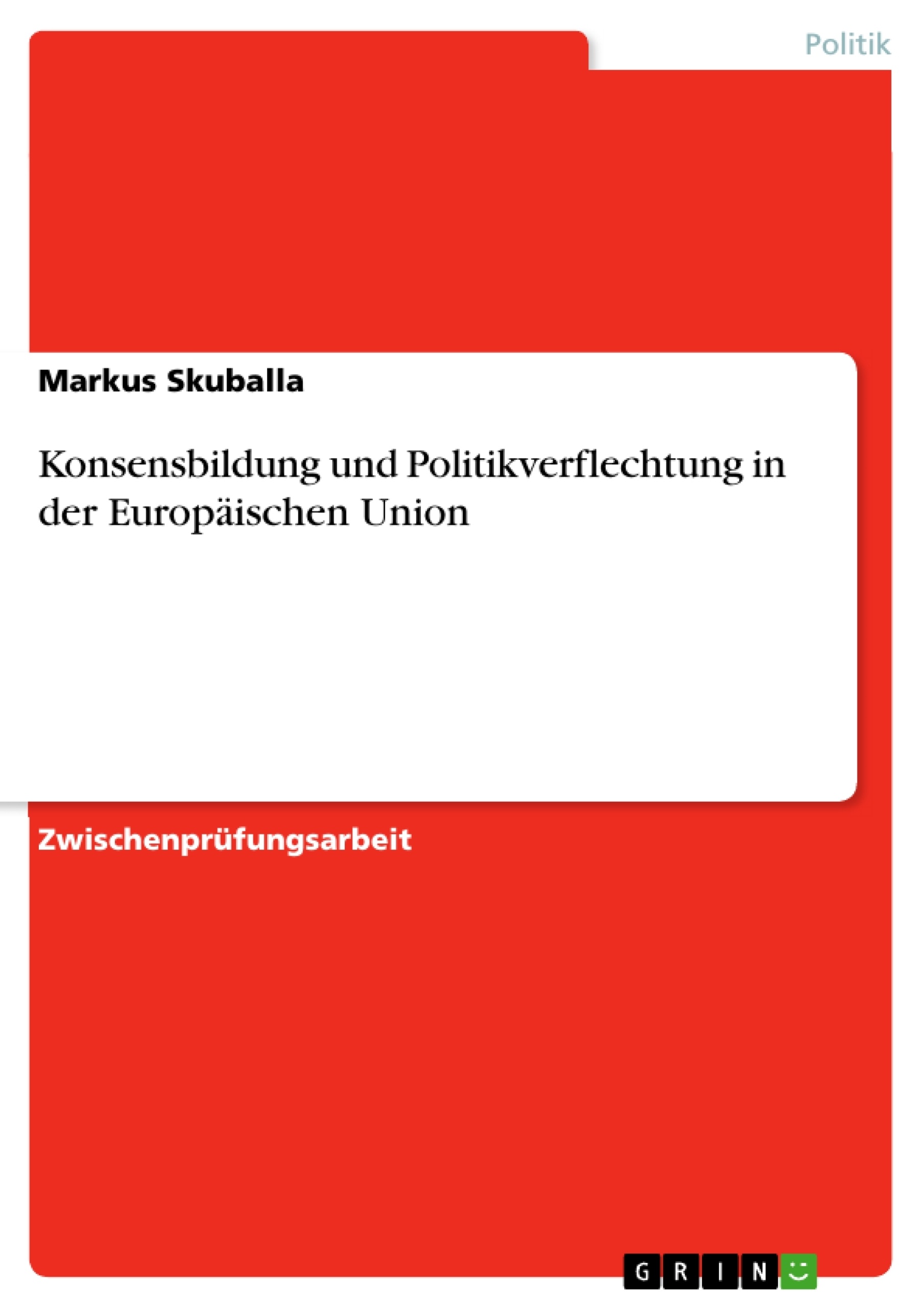Mit der Einführung des EURO als gemeinsame Währung für ein Großteil der Unionsmitglieder im Jahr 2002 und den momentan stattfindenden Verhandlungen mit mittel- und osteuropäischen Staaten (MOE- Staaten) im Zuge einer Osterweiterung der Europäischen Union stehen weitreichende Veränderungen für die Bürger der EU an. Die Entscheidungen, welche von den Mitgliedern der EU- Institutionen getroffen werden und hier insbesondere die des Rates der Europäischen Union, wirken sich direkt und indirekt auf mehrere hundert Millionen europäische Bürger aus. Dies vorangeschickt stellt sich die Frage nach dem Zustandekommen derart weitreichender Entscheidungen und ihrer demokratischen Legitimation. In welchem Verhältnis stehen die tatsächlich getroffenen Entscheidungen zu den eigentlichen Zielen der EU? Wie weitreichend beeinflussen die nationalen Eigeninteressen diese Entscheidungen und welche Verflechtungen entstehen daraus bzw. wie wirken sich bestehende Verflechtungen auf die Konsensbildung aus.
Um diese Fragen zu bearbeiten sollen im ersten Teil dieser Abhandlung zunächst die Ähnlichkeiten des deutschen und europäischen Föderalismus- Modells betrachtet werden. Als Basis zu den angestellten Überlegungen dienten die Publikationen von Fritz W. Scharpf zu den Themen der Politikverflechtung in föderalen Systemen sowie seine Aufsätze zum Thema der Politikverflechtungs-Falle. Der Begriff der Politikverflechtungs-Falle wurde von Fritz W. Scharpf geprägt. In seiner Abhandlung „Die Politikverflechtungs-Falle: Europäische Integration und deutscher Föderalismus im Vergleich“1 aus dem Jahre 1985 bezeichnet Scharpf damit vor allem die auftretenden Kompetenzprobleme durch horizontale und vertikale Politikverflechtung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Politikverflechtung
- Verflechtungsarten
- Horizontale Verflechtung
- Hierarchische Verflechtung
- Das europäische Föderalismus-Modell
- Modalitäten der Konsensbildung
- Verflechtungsarten
- Politikverflechtung in der Europäischen Union
- Die EU-Osterweiterung und ihre Beitrittsverhandlungen
- Einschränkung der Freizügigkeit
- Erfahrungen durch die Süderweiterung
- Horizontale Politikverflechtung und Konsensbildung
- Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung befasst sich mit der Konsensbildung und Politikverflechtung in der Europäischen Union, insbesondere am Beispiel der EU-Beitrittsverhandlungen. Ziel ist es, die Funktionsweise der Entscheidungsfindungsprozesse in der EU zu analysieren und die Rolle nationaler Interessen in diesem Kontext zu beleuchten. Dabei werden die Modalitäten der Konsensbildung sowie die Auswirkungen von horizontaler und hierarchischer Politikverflechtung auf die Entscheidungsfindung untersucht.
- Analyse der Konsensbildungsprozesse in der EU
- Die Bedeutung von nationalem Eigeninteresse bei EU-Entscheidungen
- Untersuchung der Politikverflechtung in föderalen Systemen
- Die Rolle von Verhandlungen und Vereinbarungen in der Entscheidungsfindung
- Das europäische Föderalismusmodell im Vergleich zum deutschen Modell
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt die Relevanz von EU-Entscheidungen für die Bürger und die damit verbundenen Fragen nach Konsensbildung und demokratischer Legitimation in den Vordergrund. Sie skizziert den Forschungsfokus auf die Politikverflechtung in föderalen Systemen und die Modalitäten der Konsensbildung in der EU.
- Politikverflechtung: Dieses Kapitel beschäftigt sich mit den Funktionsbedingungen und Entscheidungsstrukturen des Föderalismus. Es erläutert die Unterscheidung zwischen horizontaler und hierarchischer Politikverflechtung und führt den Begriff der Politikverflechtungs-Falle von Fritz W. Scharpf ein.
- Politikverflechtung in der Europäischen Union: Dieses Kapitel untersucht die EU-Osterweiterung und ihre Beitrittsverhandlungen als konkretes Beispiel für die Politikverflechtung in der EU. Es analysiert die Rolle nationaler Interessen, wie beispielsweise der deutschen Forderung nach Einschränkung der Freizügigkeit und der spanischen Forderung nach EU-Fördermitteln.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Themen der Konsensbildung und Politikverflechtung in der Europäischen Union. Sie fokussiert auf die EU-Beitrittsverhandlungen und die Rolle nationaler Interessen bei der Entscheidungsfindung. Wichtige Schlüsselwörter sind daher: EU-Osterweiterung, Politikverflechtung, horizontale Verflechtung, hierarchische Verflechtung, Konsensbildung, Föderalismus, nationale Interessen, Entscheidungsfindung, Verhandlungen.
- Arbeit zitieren
- M.A. Markus Skuballa (Autor:in), 2001, Konsensbildung und Politikverflechtung in der Europäischen Union, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61376