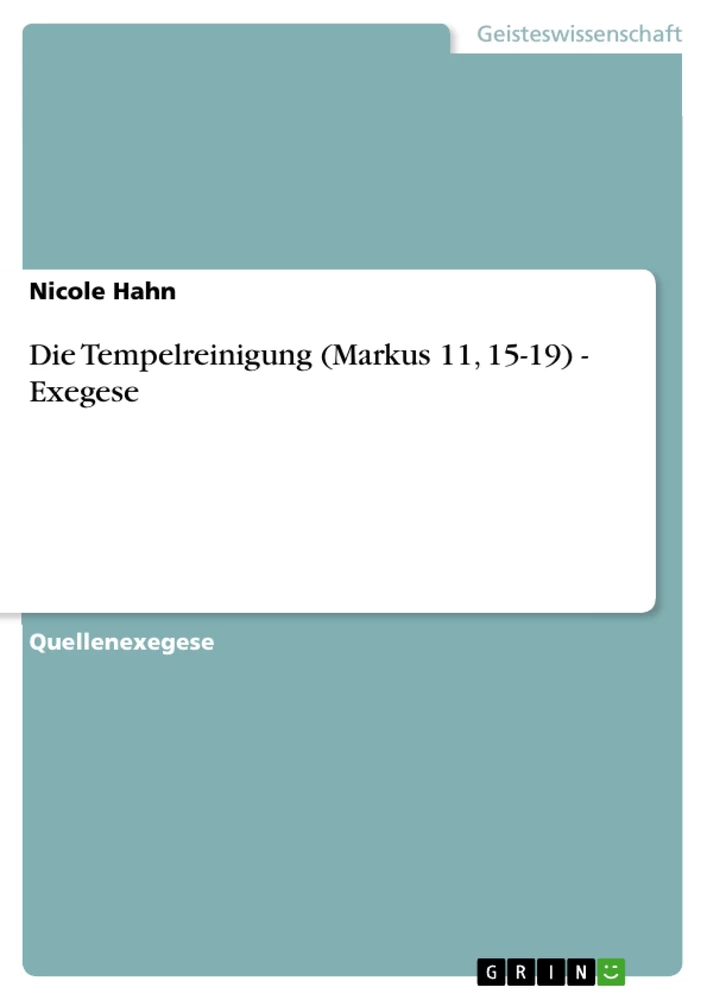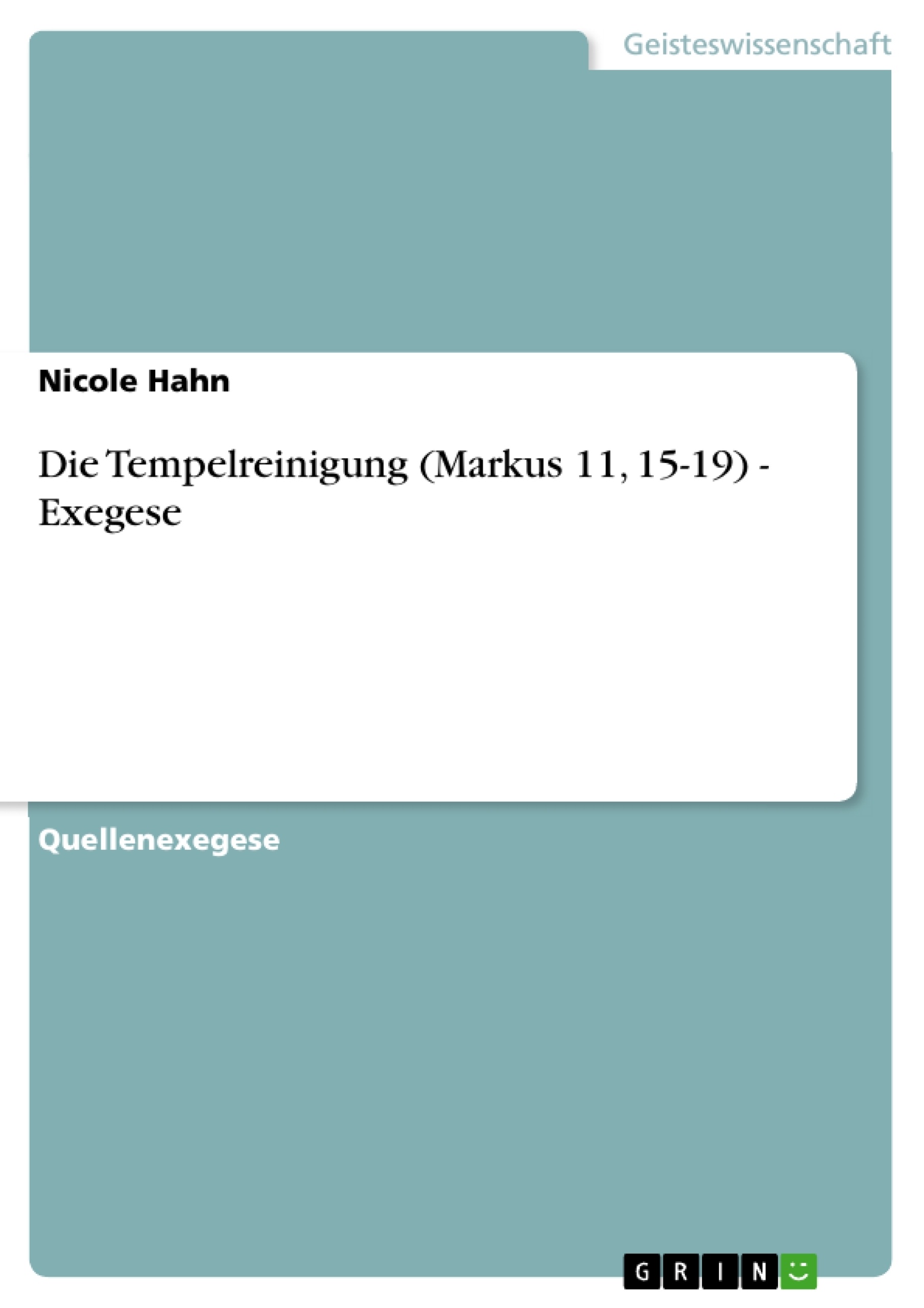Die vorliegende Exegese über Jesu Tempelreinigung in Jerusalem erarbeite ich im Rahmen des Seminars Grundwissen Neues Testament. Der Text ist mir bereits aus meiner Jungscharzeit bekannt: Dort hatten wir Jesu wütende Reaktion auf die Händler im Tempel nachgespielt. Diese erste Begegnung mit dem Text führt mich jetzt wieder auf die Frage zurück, warum die Situation im Tempel so starke Emotionen in Jesus auslöst, da dies die einzige Bibelstelle im Neuen Testament ist, in der Jesus derartig aggressiv auftritt. Meine weiteren Fragen an den Text sind vor allem sozialgeschichtlicher Art: Welche Rolle spielen die „Geldwechsler“, wieso werden diese von den eigentlichen Tempelvorstehern - den Priestern und Gesetzeslehrern – geduldet, welche Rolle spielt der Tempel zu dieser Zeit in Jerusalem überhaupt? Und was bedeutet es letztlich theologisch, dass Jesus sich berechtigt sieht, den Tempel zu reinigen?
Alle Auslegungen sind sich darüber einig, dass Jesus den Tempel zweimal gereinigt hat und sein Handeln gegen den unwürdigen Gebrauch des Tempels gerichtet war.1 Die älteren Markusinterpreten vertreten die Meinung, dass diese Tempelreinigung gegen den alttestamentlichen Tempelkult gerichtet war; dass Jesu „Aktion letztlich auf Abschaffung des Kultes hätte gerichtet sein können“ steht man aber eher „ängstlich“ gegenüber.2 Die Tempelreinigung als moralische Erziehungsmaßnahme zu sehen, der Tempelbesucher soll sich benehmen, wenn er den Tempel betritt, ist nicht lange argumentativ aufrecht zu erhalten, da dies eine sehr oberflächliche Betrachtung der Perikope gleich käme. Interessanter erscheint die zelotische Interpretation: In der Perikope ist Jesu gewaltsame Besetzung des Tempels festgehalten. Dies rückt das Ereignis ins Licht der Zerstörung des kapitalistischen Wesens der Tempelbank und der zelotischen Revolte gegen die Schuldverschreibungen der Geldwechsler 66 n.Chr.
Inhaltsverzeichnis
- Vorüberlegung und Textsicherung
- Wirkungsgeschichtliche Reflexion
- Abgrenzung der Perikope
- Sprachlich-sachliche Analyse (synchron)
- Textlinguistische Fragestellungen
- Sozialgeschichtliche und historische Fragen, Realien
- Frage nach der Aussageabsicht
- Formkritik
- Pragmatische Analyse
- Kontextuelle Analyse/das innovative Potential (diachron)
- Traditionsgeschichte
- Religionsgeschichtlicher Vergleich
- Synoptischer Vergleich
- Der Text als Teil eines theologischen Gesamtkonzepts
- Kompositionskritik
- Redaktionskritik
- Ergebnissicherung und Ausblick
- Ergebnis, Fazit
- Hermeneutischer Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Exegese der Tempelreinigung Jesu in Jerusalem, wie sie im Markus-Evangelium (Mk 11, 15-19) beschrieben wird. Ziel der Arbeit ist es, die sprachliche und sachliche Struktur des Textes zu analysieren, die historischen und sozialen Hintergründe zu beleuchten, die Aussageabsicht des Autors zu ergründen und den Text im Kontext des Gesamtkonzepts des Markus-Evangeliums zu betrachten.
- Wirkungsgeschichte der Tempelreinigung
- Sprachliche und textlinguistische Analyse
- Sozialgeschichtliche und historische Hintergründe
- Aussageabsicht des Autors
- Theologische Einordnung im Gesamtkontext des Markus-Evangeliums
Zusammenfassung der Kapitel
1. Vorüberlegung und Textsicherung
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit der Wirkungsgeschichte der Tempelreinigung und der Abgrenzung der Perikope im Kontext des Markus-Evangeliums. Die Autorin stellt die Frage nach den Emotionen, die Jesu Reaktion auf die Händler im Tempel auslöst, und betrachtet die sozialgeschichtlichen Hintergründe des Ereignisses. Der Abschnitt diskutiert verschiedene Interpretationsansätze, die sich mit dem Handeln Jesu im Tempel auseinandersetzen.
2. Sprachlich-sachliche Analyse (synchron)
Dieser Abschnitt fokussiert auf die sprachliche Analyse des Textes, indem er die Unterschiede zwischen verschiedenen deutschen Bibelübersetzungen aufzeigt. Die Autorin untersucht die Wortwahl und ihre Auswirkungen auf das Verständnis der Perikope. Zudem werden sozialgeschichtliche und historische Aspekte im Zusammenhang mit dem Tempel und den beteiligten Akteuren beleuchtet.
3. Frage nach der Aussageabsicht
Der dritte Teil der Arbeit widmet sich der Frage nach der Aussageabsicht des Autors. Die Autorin analysiert den Text anhand formkritischer Methoden und untersucht die pragmatische Funktion der Tempelreinigung. Der Abschnitt bietet eine Interpretation des Textes im Hinblick auf seine Intention und Botschaft.
4. Kontextuelle Analyse/das innovative Potential (diachron)
Dieser Abschnitt beleuchtet die Tempelreinigung im Kontext der Traditionengeschichte, des religionsgeschichtlichen Vergleichs und des synoptischen Vergleichs. Die Autorin untersucht die Entwicklung des Themas in verschiedenen Quellen und stellt die Einzigartigkeit des Textes im Markus-Evangelium heraus.
5. Der Text als Teil eines theologischen Gesamtkonzepts
Der fünfte Teil der Arbeit betrachtet die Tempelreinigung als Teil des theologischen Gesamtkonzepts des Markus-Evangeliums. Die Autorin analysiert den Text anhand von kompositionskritischen und redaktionskritischen Methoden, um die Bedeutung des Ereignisses für die Gesamtstruktur und Botschaft des Evangeliums zu verstehen.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter und Fokusthemen der Arbeit sind: Tempelreinigung, Markus-Evangelium, Jesus, Tempel, Händler, Geldwechsler, Taubenhändler, Wirkungsgeschichte, Sprachliche Analyse, Sozialgeschichte, Aussageabsicht, Tradition, Religion, Synoptik, Theologie, Kompositionskritik, Redaktionskritik.
- Quote paper
- Nicole Hahn (Author), 2006, Die Tempelreinigung (Markus 11, 15-19) - Exegese, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61350