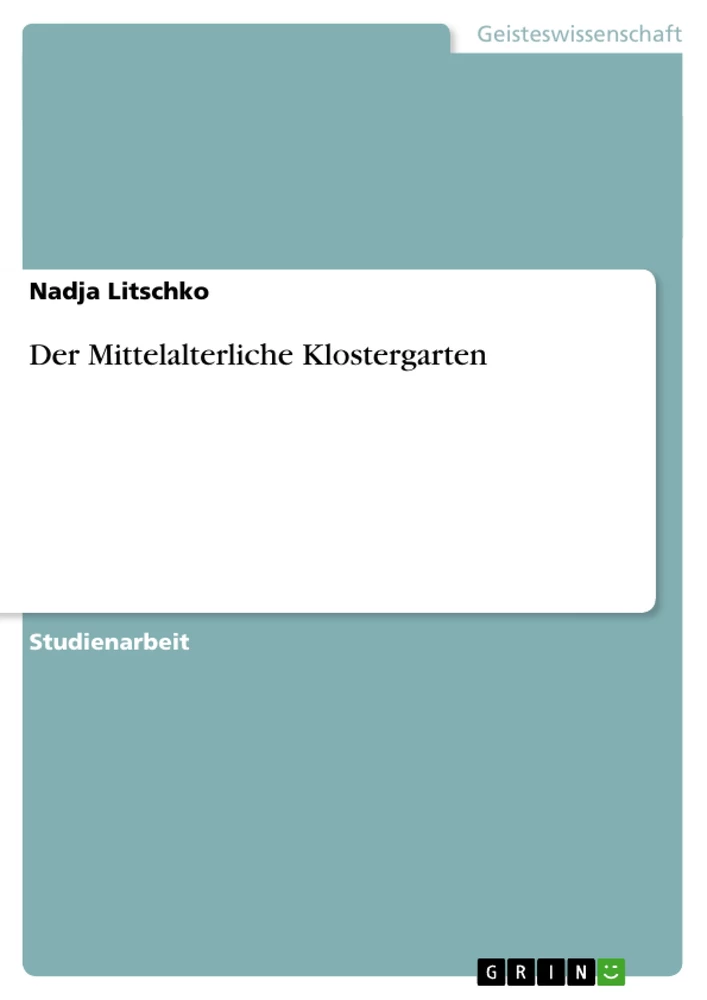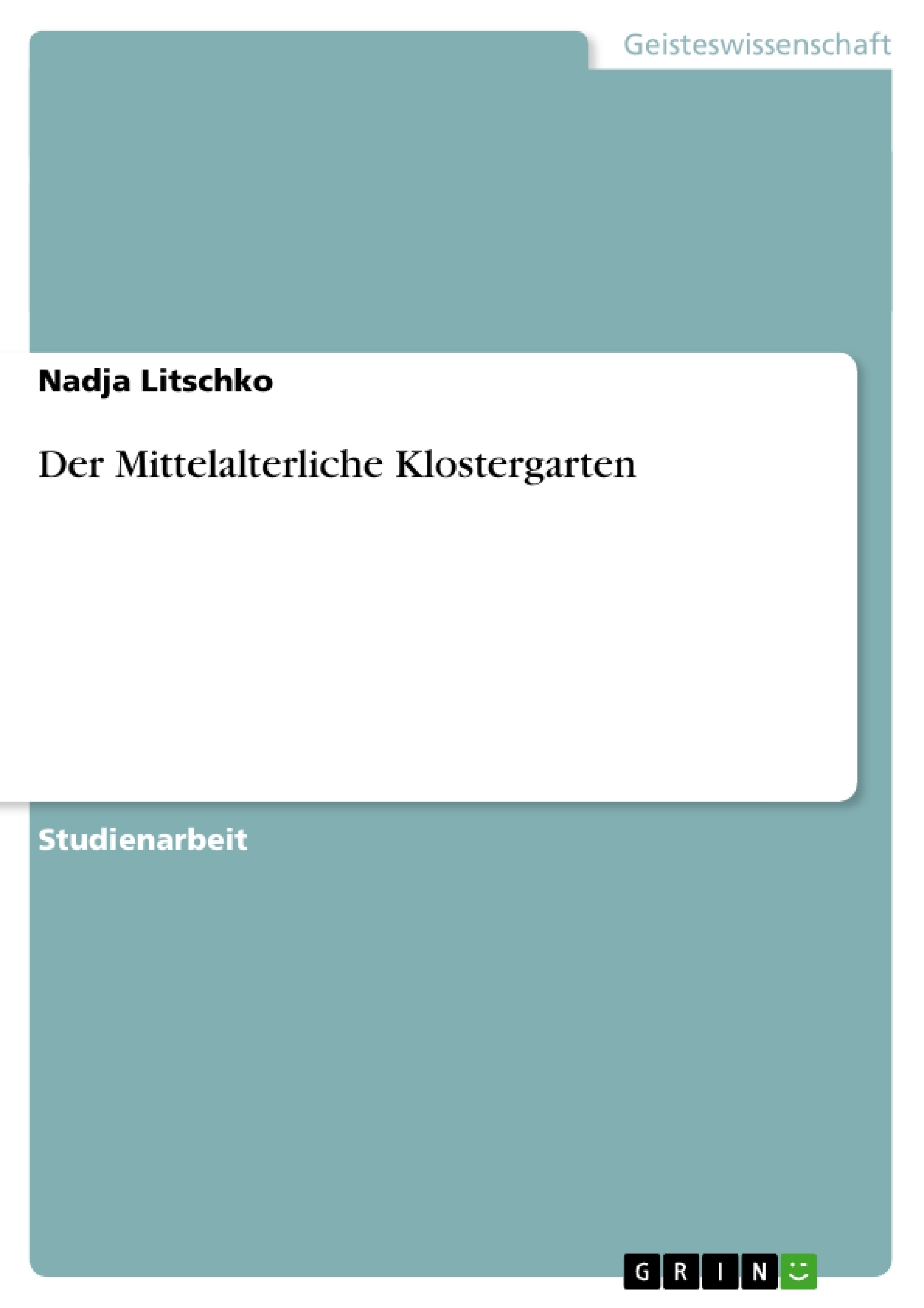Der Klostergarten, welcher im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen soll, ist einer der wohl bekanntesten und am häufigsten mit dem Mittelalter assoziierten Gartentypen. Allerdings war der Klostergarten bei weitem nicht der einzige Vertreter der Gartenkultur jener Zeit, auch wenn er heute nahezu der einzige mittelalterliche Gartentyp ist, der noch mehr oder weniger unversehrt erhalten werden konnte. Aus diesem Grund soll dieses erste Kapitel dazu genutzt werden, die wichtigsten mittelalterlichen Gartentypen, welche besonders der Erholung dienten, kurz vorzustellen und zu erläutern, um ein umfassenderes Bild der Gartenkultur des Mittelalters zu präsentieren. Zudem sollen auch einige der wichtigeren mittelalterlichen Nutzgärten kurz genannt werden. Die folgenden Ausführungen sind zudem auch für das Verständnis des mittelalterlichen Klostergartens von Bedeutung, da dieser in der Regel eine Verschmelzung diverser unterschiedlicher Gärten war. So waren die im Folgenden zu besprechenden Gartentypen nicht nur separat, sondern oftmals auch als Bestandteil eines Klostergartenkomplexes zu finden. Allerdings muss einleitend gesagt werden, dass die Rekonstruktion von mittelalterlichen Gärten ein schwieriges Unterfangen ist, da mit Ausnahme der Klostergärten so gut wie keine Anlagen aus jener Zeit erhalten geblieben sind. Ein Großteil der Informationen, welche zur Bestimmung des Aufbaus und des Aussehens der Gärten genutzt wurden, mussten daher aus sekundären Quellen gewonnen werden, zum Beispiel aus erhaltenen Kunstwerken, aus schriftlichen Quellen oder aus archäologischen Funden, welche Aufschluss über erhaltenen Reste mittelalterlicher Gärten liefern. Mit Hilfe solcher Quellen war es möglich, den Aufbau mittelalterlicher Gärten relativ zuverlässig zu rekonstruieren. Im Folgenden sollen nun drei der wichtigsten überlieferten mittelalterlichen Gartentypen vorgestellt werden, welche vor allem im englischen Raum weite Verbreitung fanden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Gartentypen des Mittelalters
- Allgemeines
- Der Herber oder Kleiner Dekorativer Garten
- Der Obstgarten
- Der Lustgarten
- Der Mittelalterliche Klostergarten
- Merkmale des Mittelalterlichen Klostergartens
- Der Klostergarten von St. Gallen
- Anlage des Klostergartens
- Der Kreuzganggarten
- Der Kräutergarten
- Der Gemüsegarten
- Der Obstgarten und Friedhof
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Gartenkultur des Mittelalters und konzentriert sich insbesondere auf den Klostergarten. Sie analysiert verschiedene Gartentypen der Epoche, beleuchtet die Funktionen und den Aufbau des Klostergartens sowie die Besonderheiten des Klostergartens von St. Gallen.
- Die verschiedenen Gartentypen des Mittelalters
- Die Funktion und Bedeutung des Klostergartens
- Der Aufbau und die Gestaltung von Klostergärten
- Das Beispiel des Klostergartens von St. Gallen
- Die Rekonstruktion mittelalterlicher Gartenanlagen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Gartenbegriffs in der heutigen Zeit dar und erläutert den historischen Kontext der Gartenkultur im Mittelalter. Sie führt den Leser in die verschiedenen Gartentypen ein und betont die Bedeutung des Klostergartens als ein zentrales Element dieser Arbeit.
Kapitel 2 bietet einen Überblick über die wichtigsten Gartentypen des Mittelalters. Es beschreibt den Herber, den Obstgarten und den Lustgarten, wobei die jeweiligen Funktionen und Gestaltungsmerkmale hervorgehoben werden.
Kapitel 3 widmet sich dem mittelalterlichen Klostergarten und seinen charakteristischen Merkmalen. Es analysiert die Anlage und Gestaltung des Klostergartens von St. Gallen und untersucht die verschiedenen Bereiche wie den Kreuzganggarten, den Kräutergarten, den Gemüsegarten und den Obstgarten.
Schlüsselwörter
Gartenkultur, Mittelalter, Klostergarten, St. Gallen, Herber, Obstgarten, Lustgarten, Kreuzganggarten, Kräutergarten, Gemüsegarten, Rekonstruktion, Quellen, Kunstwerke, schriftliche Quellen, archäologische Funde
- Quote paper
- Nadja Litschko (Author), 2005, Der Mittelalterliche Klostergarten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61291