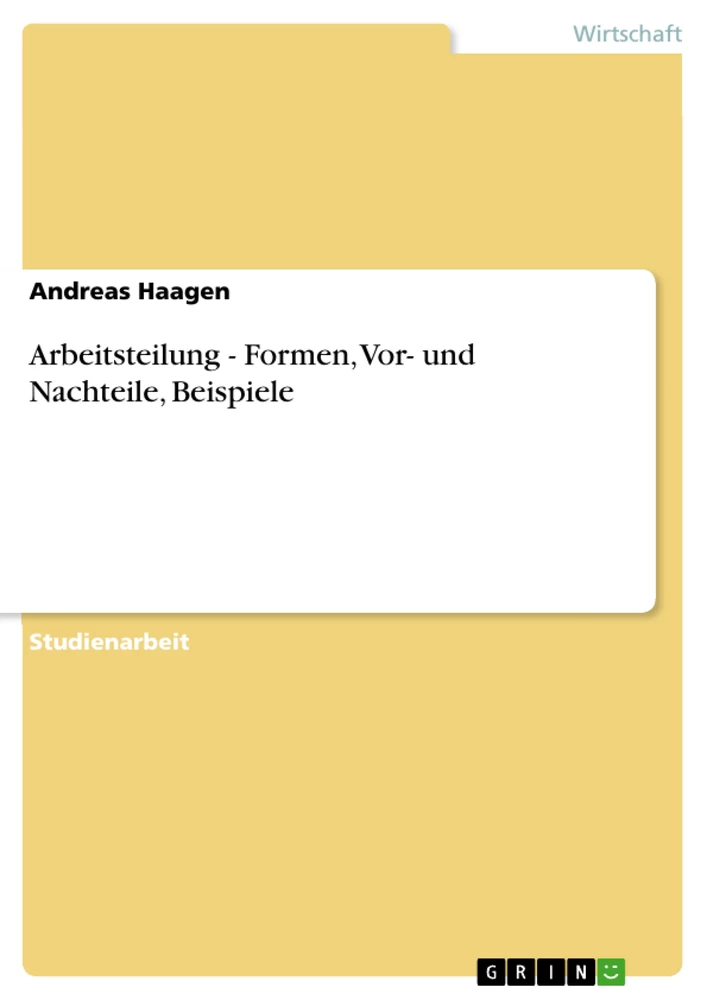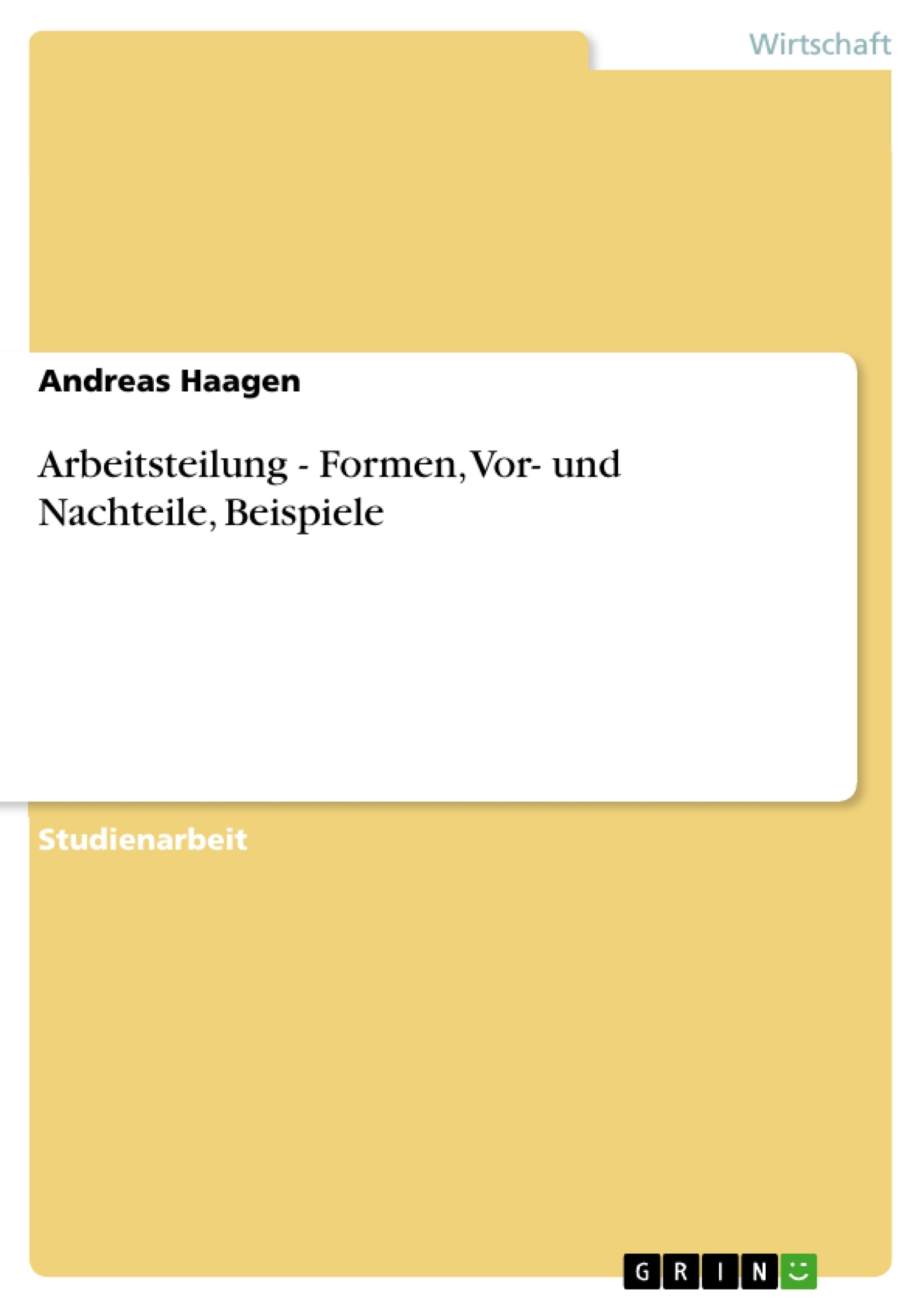Früher waren die Menschen Jäger und Sammler. Für statische Tätigkeiten wie das Sammeln von Pflanzen war die Frau verantwortlich, dynamische Tätigkeiten wie die Jagd oblagen dem Mann. Für die menschliche Nahrungssuche entwickelte sich diese geschlechtliche Arbeitsteilung.
Noch vor einigen Jahrhunderten war das Leben im wirtschaftlichen Sinne nicht annähernd so komplex wie heute. Die meisten privaten Haushalte waren Selbstversorger. Sie produzierten folglich die Güter primär zur eigenen Bedürfnisbefriedigung. Im Laufe der Zeit entwickelte sich eine Tauschwirtschaft. Nun wurden Güter sowohl für den eigenen Bedarf als auch für Dritte produziert. Durch die Tauschwirtschaft entwickelten sich Märkte, die wiederum mit einer zu-nehmenden Arbeitsteilung eng verbunden sind. Der rege Handel einer modernen Volkswirt-schaft spiegelt deshalb den hohen Grad an Arbeitsteilung wider.
Heute stehen wir beispielsweise morgens auf, ziehen Kleidung an, setzen uns mit der Tageszeitung an den Frühstückstisch und essen dort ein Stück Brot. Unser T-Shirt, das wir anziehen, kann ursprünglich aus Usbekistan kommen. Dort wird Baumwolle geerntet, in der Türkei zu Garn versponnen, in Taiwan gewebt, in Frankreich mit Farbstoffen aus Polen und China bedruckt, in Bangladesch genäht und schließlich als fertiges T-Shirt in einem Kaufhaus in Deutschland verkauft. Die Tageszeitung wird von Redakteuren verfasst, von Maschinen auf Papier gedruckt, welches in einer Papierfabrik aus Holz hergestellt wird. Schließlich wirft ein Zeitungsbote das arbeitsteilige Produkt in den Briefkasten. „Für […] [die] Herstellung [des Brotes] musste Getreide gesät, geerntet, sortiert und gemahlen werden – und all das geschah bereits mit Geräten, die ihrerseits in komplexen, mehrstufigen Produktionsprozessen hergestellt wurden; […] das Brot wurde gebacken, verpackt, gelagert und verkauft.“
Diese Arbeit befasst sich mit den Formen der Arbeitsteilung in der Wirtschaft, ihren Vor- und Nachteilen und der damit zusammenhängenden Problematik.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Definition und Formen der Arbeitsteilung in der Wirtschaft
- Innerbetriebliche Arbeitsteilung
- Zwischenbetriebliche Arbeitsteilung
- Internationale Arbeitsteilung
- Nachteile der Arbeitsteilung
- Auswirkungen auf Politik und Gesellschaft
- Gesamtwirtschaftliche Nachteile
- Nachteile für den Einzelnen
- Vorteile der Arbeitsteilung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Arbeitsteilung in der Wirtschaft. Ziel ist es, die verschiedenen Formen der Arbeitsteilung zu definieren und zu erklären, sowie deren Vor- und Nachteile darzulegen. Die Arbeit beleuchtet die Auswirkungen auf verschiedene Ebenen – vom einzelnen Individuum bis zur globalen Wirtschaft.
- Definition und Formen der Arbeitsteilung (innerbetrieblich, zwischenbetrieblich, international)
- Vorteile der Arbeitsteilung durch Spezialisierung und Effizienzsteigerung
- Nachteile der Arbeitsteilung, einschließlich gesellschaftlicher und individueller Auswirkungen
- Analyse konkreter Beispiele aus der Wirtschaft
- Zusammenfassende Betrachtung der Bedeutung der Arbeitsteilung in der modernen Wirtschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Wandel von der Selbstversorgung zur Tauschwirtschaft und dem damit verbundenen Anstieg der Arbeitsteilung. Sie veranschaulicht diesen Wandel anhand des Beispiels eines einfachen Frühstücks, dessen Bestandteile aus verschiedenen Ländern stammen, und betont die Komplexität der modernen Produktionsketten. Der Fokus der Arbeit auf die Formen, Vor- und Nachteile der Arbeitsteilung wird hier festgelegt.
Definition und Formen der Arbeitsteilung in der Wirtschaft: Dieses Kapitel definiert Arbeitsteilung als die Zerlegung von Produktionsprozessen in einzelne Arbeitsvorgänge, die von verschiedenen Wirtschaftseinheiten durchgeführt werden können. Es werden drei Hauptformen unterschieden: innerbetriebliche, zwischenbetriebliche und internationale Arbeitsteilung. Das klassische Beispiel der Stecknadelproduktion von Adam Smith wird herangezogen, um die Effizienzsteigerung durch Spezialisierung zu verdeutlichen. Die Definition bildet die Grundlage für die nachfolgende Analyse der jeweiligen Formen.
Innerbetriebliche Arbeitsteilung: Dieses Kapitel erläutert die innerbetriebliche Arbeitsteilung, indem es funktionale Organisation und Arbeitszerlegung unterscheidet. Funktionale Organisation teilt Aufgaben nach Funktionsbereichen (z.B. Entwicklung, Produktion, Vertrieb) auf, was sowohl Vorteile durch Spezialisierung als auch Nachteile durch "Abteilungsdenken" und lange Entscheidungswege mit sich bringt. Die Arbeitszerlegung, wie sie z.B. in der Fließbandarbeit vorkommt, wird als eine weitere Form der innerbetrieblichen Arbeitsteilung beschrieben, die durch Arbeitsablaufstudien optimiert wird.
Zwischenbetriebliche Arbeitsteilung: Hier werden vertikale und horizontale Produktionsteilung unterschieden. Die vertikale Produktionsteilung beschreibt die Arbeitsteilung entlang der Produktionskette, vom Rohstoff bis zum Endprodukt, anhand des Beispiels der Möbelherstellung. Die horizontale Produktionsteilung hingegen beschreibt die Spezialisierung von Unternehmen auf bestimmte Produktbereiche oder Marktnischen, wie z.B. die Fokussierung eines Möbelherstellers auf Küchenmöbel. Das Beispiel der Automobilindustrie und des Outsourcings von IT-Dienstleistungen wird genannt um die horizontale Arbeitsteilung weiter zu erläutern.
Internationale Arbeitsteilung: Dieses Kapitel erweitert den Fokus auf die internationale Ebene und zeigt, dass die Arbeitsteilung nicht auf nationale Grenzen beschränkt ist. Es wird das Beispiel eines PKWs angeführt, dessen Komponenten aus zahlreichen Ländern stammen. Dies verdeutlicht den globalen Charakter der modernen Arbeitsteilung und die Verflechtung nationaler Volkswirtschaften.
Schlüsselwörter
Arbeitsteilung, innerbetriebliche Arbeitsteilung, zwischenbetriebliche Arbeitsteilung, internationale Arbeitsteilung, Spezialisierung, Effizienz, Produktivität, funktionale Organisation, Arbeitszerlegung, vertikale Produktionsteilung, horizontale Produktionsteilung, Vor- und Nachteile, ökonomische Auswirkungen, gesellschaftliche Auswirkungen.
FAQ: Seminararbeit zur Arbeitsteilung in der Wirtschaft
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über die Arbeitsteilung in der Wirtschaft. Sie definiert und erklärt verschiedene Formen der Arbeitsteilung (innerbetrieblich, zwischenbetrieblich, international), analysiert deren Vor- und Nachteile und beleuchtet die Auswirkungen auf verschiedene Ebenen – vom Individuum bis zur globalen Wirtschaft. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, Kapitelzusammenfassungen, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten und ein Schlüsselwortverzeichnis.
Welche Formen der Arbeitsteilung werden behandelt?
Die Arbeit unterscheidet drei Hauptformen der Arbeitsteilung: innerbetriebliche Arbeitsteilung (funktionale Organisation und Arbeitszerlegung), zwischenbetriebliche Arbeitsteilung (vertikale und horizontale Produktionsteilung) und internationale Arbeitsteilung. Jedes dieser Gebiete wird detailliert erklärt und mit Beispielen aus der Wirtschaft illustriert (z.B. Adam Smiths Stecknadelproduktion, Automobilindustrie, Outsourcing).
Welche Vorteile der Arbeitsteilung werden genannt?
Die Arbeit hebt die Vorteile der Arbeitsteilung durch Spezialisierung und Effizienzsteigerung hervor. Durch die Zerlegung von Produktionsprozessen in einzelne Arbeitsgänge können Unternehmen ihre Produktivität steigern und Kosten senken. Die Spezialisierung führt zu höherer Expertise und Qualität der einzelnen Arbeitsschritte.
Welche Nachteile der Arbeitsteilung werden beschrieben?
Die Arbeit beleuchtet auch die Nachteile der Arbeitsteilung. Dies beinhaltet sowohl gesamtwirtschaftliche Nachteile (z.B. ungleiche Einkommensverteilung), gesellschaftliche Auswirkungen (z.B. Monotonie der Arbeit, Abhängigkeit von spezialisierten Tätigkeiten) als auch Nachteile für den Einzelnen (z.B. Verlust von Fähigkeiten, Arbeitslosigkeit durch Automatisierung). Die Arbeit geht auch auf das "Abteilungsdenken" und lange Entscheidungswege in funktional organisierten Unternehmen ein.
Welche Beispiele werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit verwendet verschiedene Beispiele, um die Konzepte der Arbeitsteilung zu veranschaulichen. Dazu gehören Adam Smiths Stecknadelproduktion zur Verdeutlichung der Effizienzsteigerung durch Spezialisierung, die Möbelherstellung zur Erklärung der vertikalen Produktionsteilung, die Automobilindustrie und das Outsourcing von IT-Dienstleistungen zur Veranschaulichung der horizontalen Arbeitsteilung, sowie ein einfaches Frühstück als Beispiel für die global vernetzten Produktionsketten der modernen Wirtschaft.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Definition und Formen der Arbeitsteilung in der Wirtschaft (mit Unterkapiteln zu innerbetrieblicher, zwischenbetrieblicher und internationaler Arbeitsteilung), Vorteile der Arbeitsteilung, Nachteile der Arbeitsteilung und Fazit. Jedes Kapitel wird in der Zusammenfassung der Kapitel separat erläutert.
Was ist die Zielsetzung der Seminararbeit?
Die Zielsetzung der Seminararbeit ist es, die verschiedenen Formen der Arbeitsteilung zu definieren und zu erklären, sowie deren Vor- und Nachteile darzulegen. Die Arbeit soll die Auswirkungen der Arbeitsteilung auf verschiedene Ebenen – vom einzelnen Individuum bis zur globalen Wirtschaft – beleuchten.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Seminararbeit?
Die relevanten Schlüsselwörter sind: Arbeitsteilung, innerbetriebliche Arbeitsteilung, zwischenbetriebliche Arbeitsteilung, internationale Arbeitsteilung, Spezialisierung, Effizienz, Produktivität, funktionale Organisation, Arbeitszerlegung, vertikale Produktionsteilung, horizontale Produktionsteilung, Vor- und Nachteile, ökonomische Auswirkungen, gesellschaftliche Auswirkungen.
- Quote paper
- Andreas Haagen (Author), 2006, Arbeitsteilung - Formen, Vor- und Nachteile, Beispiele, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61166