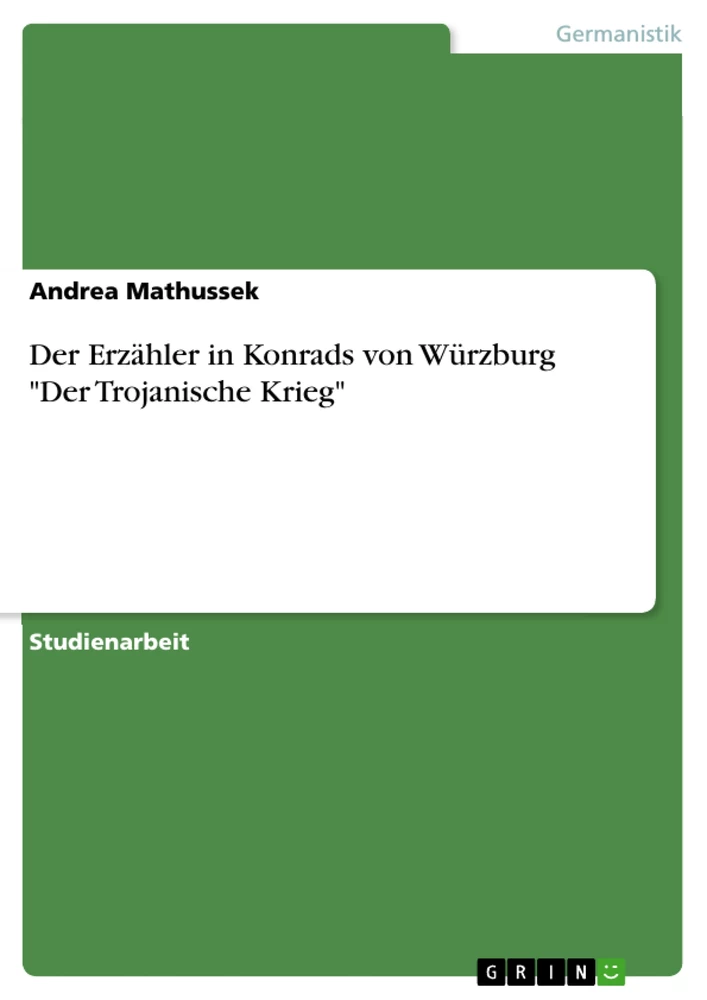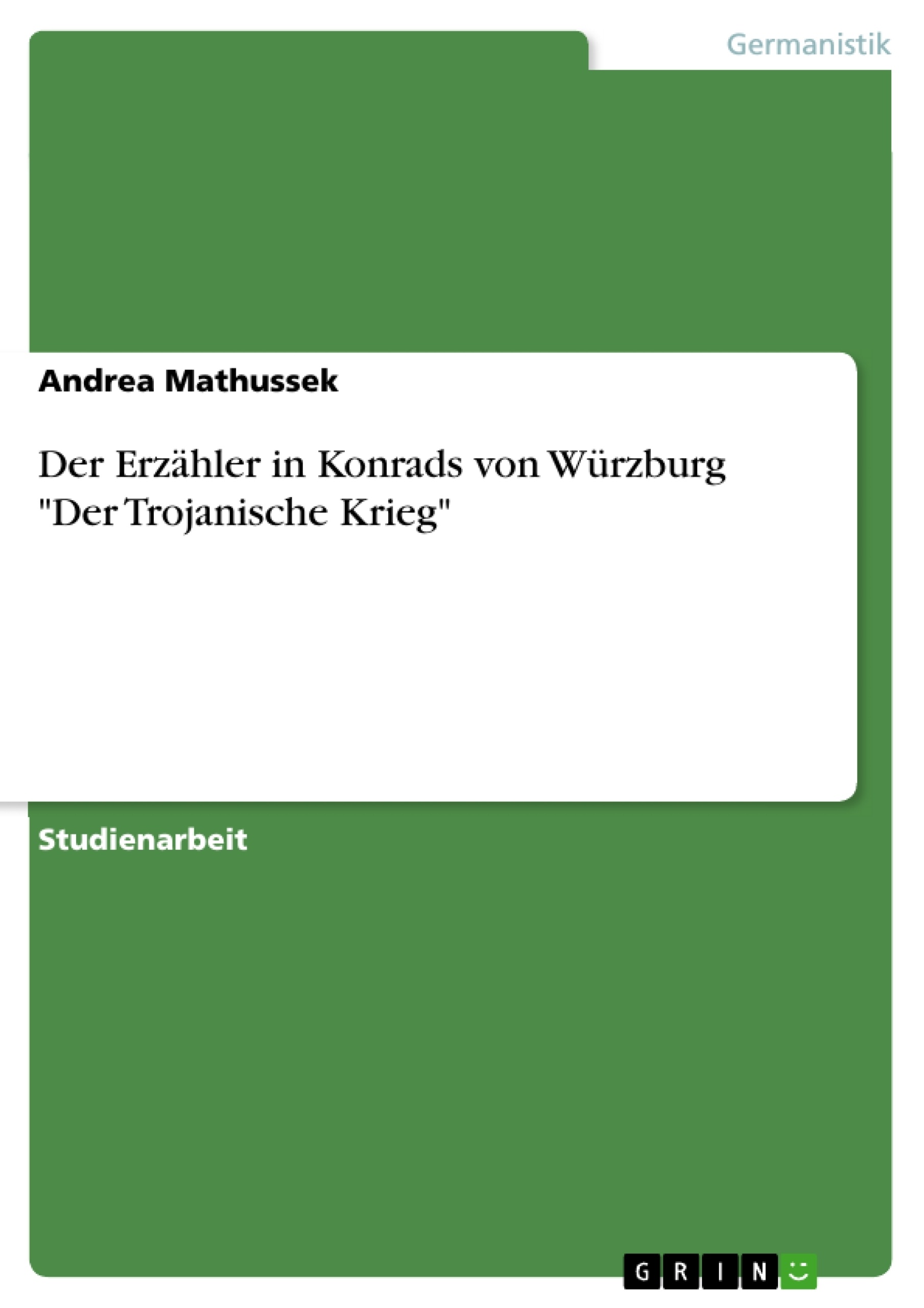Eine an den Methoden der Neueren Literaturwissenschaft ausgerichtete Herangehensweise an die Romane des Mittelalters im Allgemeinen und die Werke Konrads von Würzburg im Besonderen würde bei der Untersuchung der Autorinterventionen in diesen Texten von der Einschaltung einer fiktionalen narrativen Instanz durch den Autor ausgehen. In einer Mittlerposition zwischen Autor und Hörer würde diese keinesfalls fraglos mit dem Verfasser des Werkes gleichgesetzt werden dürfen. Bei der Betrachtung der Literatur des Spätmittelalters muss jedoch von einem davon deutlich verschiedenen Verhältnis des Schriftstellers zu seinem Text und dessen Inhalt ausgegangen werden. Ein Grund hierfür ist die Stellung der Dichtung im Mittelalter. Weil diese als 'Wissenschaft', als Teil derseptem artesangesehen wurde, ist nicht davon auszugehen, dass "der Dichter als Autorität sein Wissen mittels eines fiktionalen Erzählers vorführte". Trotzdem darf die Erzählerstimme im mittelalterlichen Roman nicht als deckungsgleich mit der Stimme des Dichters verstanden werden und der aus dem Text interpretierbare Erzählerstandpunkt nicht selbstverständlich als der des Dichters angesehen werden. Dies wird schon durch die Tatsache deutlich, dass Dichter des Mittelalters des öfteren in für verschiedene Auftraggeber verfassten Texten unterschiedliche Meinungen und Ansichten zu vertreten scheinen. Vielmehr muss von einer "Transformation des Autors in den Erzähler" ausgegangen werden, "die sich mit dem ersten Wort eines literarischen Textes vollzogen hat". Darin muss die Möglichkeit des Dichters impliziert gesehen werden, nicht als er selbst mit allen Eigenheiten und Ansichten als Erzähler in Erscheinung zu treten, sondern statt dessen ein inszeniertes Selbstbild zu zeichnen. Dieses kann je nach Absicht des Dichters, den Intentionen seines Auftraggebers oder seinem intendierten Publikum mehr oder weniger mit der Person des Autors identisch sein. Um aber gerade Abweichungen der Einheit von Autoren- und Erzählerstimme erkennen zu können, sollten biographische Aspekte - soweit bekannt - mit in die Analyse des Erzählers im spätmittelalterlichen Roman einfließen.
Inhaltsverzeichnis
- Realität oder Fiktion des Erzählers im mittelalterlichen Roman
- Zur Situation Konrads von Würzburg als Dichter in Basel
- Die Selbstdarstellung des Dichters im Prolog des 'Trojanerkrieges'
- Angaben zu Autor und Auftraggeber
- Dichterstolz und Bescheidenheit
- Dichter und Publikum
- Präsentation der Ziele des Werks
- Erscheinungsformen des Erzählers im 'Trojanerkrieg'
- Gliedernde Einschübe
- Vorausdeutungen
- Rückwendungen
- Aufforderungen zur Aufmerksamkeit
- Abkürzungen
- Beglaubigende Einschübe
- Wahrheitsbeteuerung
- Quellenberufung
- Eingeschobene Fragen
- Erläuterungsformel
- Veranschaulichende Einschübe
- Vergleich
- Hyperbel und Superlativ
- Unsagbarkeitsformel
- Didaktische Einschübe
- Lob und Tadel
- Exkurse
- Sentenzen
- Dichterische Stellungnahme
- Vergleiche mit der Norm
- Funktion und Wirkung der Erzählhaltung und Selbstdarstellung des Erzählers im 'Trojanerkrieg'
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert die Erzählhaltung und Selbstdarstellung des Erzählers in Konrads von Würzburgs 'Trojanerkrieg'. Im Fokus steht die Frage, wie sich der Erzähler im Werk präsentiert und welche Funktion diese Selbstdarstellung für die literarische Gestaltung und die Rezeption des Romans hat.
- Der Erzähler als Instanz zwischen Autor und Publikum
- Die Selbstdarstellung des Dichters im Prolog
- Die Funktion der verschiedenen Erscheinungsformen des Erzählers im Text
- Die Stellung des Dichters im mittelalterlichen Literaturbetrieb
- Die Rezeption des 'Trojanerkriegs' im 13. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel untersucht die Rolle des Erzählers im mittelalterlichen Roman. Es wird die Frage gestellt, ob der Erzähler als fiktionale Instanz betrachtet werden kann oder ob er als Stimme des Autors zu verstehen ist. Das zweite Kapitel beleuchtet die Situation Konrads von Würzburg als Dichter in Basel. Hierbei wird die Bedeutung des städtischen Literaturbetriebs im Spätmittelalter und die Rolle der Mäzene hervorgehoben. Im dritten Kapitel wird die Selbstdarstellung des Dichters im Prolog des 'Trojanerkriegs' untersucht. Es werden die Angaben zu Autor und Auftraggeber, der dichterische Stolz und die Bescheidenheit des Autors sowie die Beziehung zwischen Dichter und Publikum analysiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt die Themen des Erzählers, der Selbstdarstellung, des mittelalterlichen Romans, Konrads von Würzburg, des 'Trojanerkriegs', des städtischen Literaturbetriebs und der Mäzene im Spätmittelalter. Weitere wichtige Begriffe sind die Fiktionalität, die Autorinterventionen, die narrativen Instanzen und die dichterische Stellungnahme.
- Quote paper
- Andrea Mathussek (Author), 2006, Der Erzähler in Konrads von Würzburg "Der Trojanische Krieg", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61087