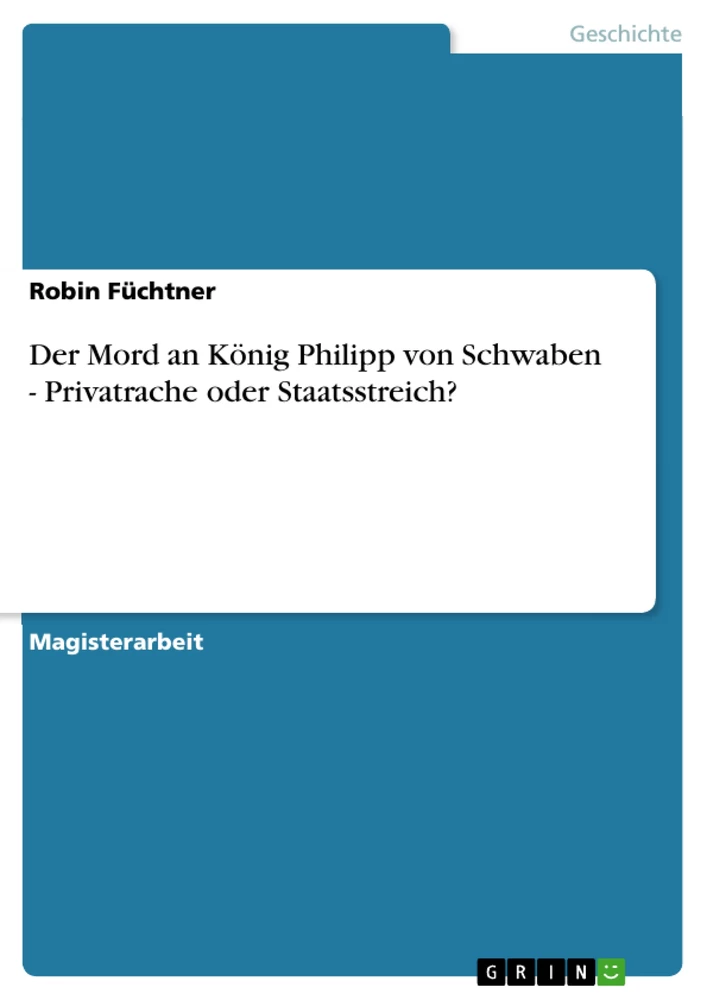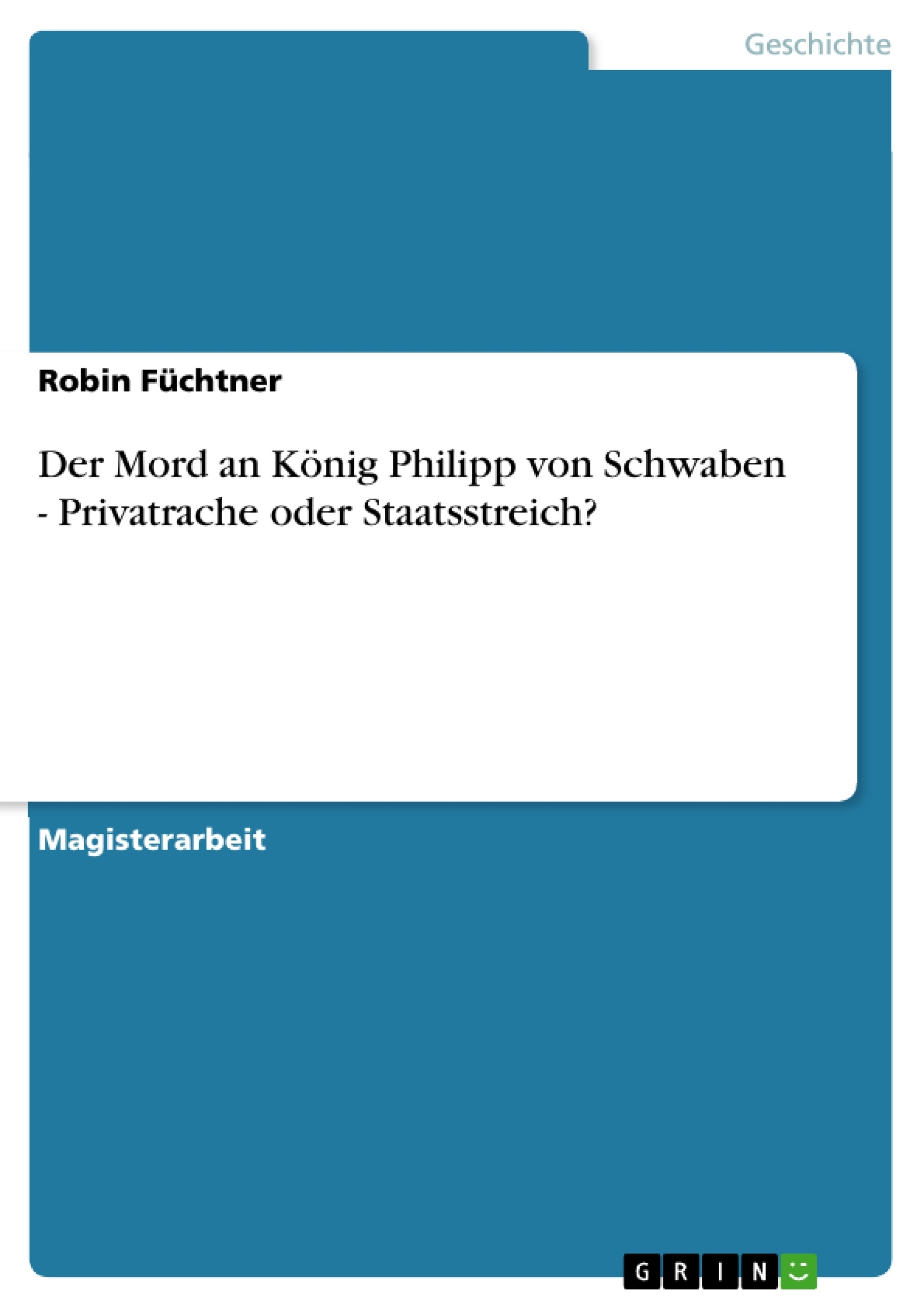„Non erit hic tibi ludus“ - Diesmal wird es kein Spiel für Dich sein! - mit diesen Worten stieß Pfalzgraf Otto von Wittelsbach König Philipp von Schwaben am 21. Juni 1208 in Bamberg das Schwert in die Brust und beendete damit den ein Jahrzehnt dauernden Thronstreit zwischen ihm und Otto von Braunschweig, dem späteren Kaiser Otto IV. Die vorliegende Magisterarbeit beschäftigt sich mit der Frage nach dem Warum für dieses Verbrechen. Zunächst soll in diesem einleitenden Kapitel der Tathergang dargestellt werden; es folgen ein Blick auf die Forschungslandschaft und die Erläuterung der für diese Untersuchung relevanten Fragestellung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung: Das Attentat von Bamberg – Ablauf und Thematisierung in der Forschung
- Ablauf
- Forschungsüberblick
- Die Fragestellung
- Quellenkritik
- Arnold von Lübeck
- Zur Person
- Zum Werk
- Otto von Sankt Blasien
- Zur Person
- Zum Werk
- Die Marbacher Annalen (Annales Marbacenses)
- Die Reinhardsbrunner Chronik (Cronica Reinhardsbrunnensis)
- Allgemeines zur Chronik
- Die „Historien“
- Zum Autor der „Historien“
- Burchard von Ursperg
- Zur Person
- Zum Werk
- Caesarius von Heisterbach
- Zur Person
- Zum Werk
- Hugo (Hugolinus) Graf von Segni (später Papst Gregor IX.)
- Zur Person
- Zur Quelle
- Hermann von Altaich
- Zur Person
- Zum Werk
- Eine Proskriptionsliste Ottos IV.
- Die Kölner Königschronik (Chronica Regia Coloniensis)
- Aventinus (Johannes Turmair)
- Zur Person
- Zum Werk
- Braunschweigsiche Reimchronik
- Walther von der Vogelweide
- Zur Person
- Zum Werk
- Der Königsmoerder Otto von Wittelsbach – seine Motive als Ansatz der klassischen Forschung
- Die Staufische Heiratspolitik unter Philipp
- Das erste Motiv: Die Auflösung der Verlobung
- Das zweite Motiv: Ein Empfehlungsschreiben
- Der Königsmord als Staatsstreich: Die Thesen Huckers
- Die Begleitung des Mörders
- Burchard von Ursperg
- Hugo von Ostia
- Belege für eine Verschwörung bzw. Mitwisserschaft der Andechs-Meranier
- Die Marbacher Annalen
- Otto von St. Blasien
- Hermann von Altaich
- Arnold von Lübeck
- Eine Proskriptionsliste Ottos IV.
- Bischof Ekbert von Bamberg
- Das Verhältnis zwischen Philipp und Ekbert
- Das Bamberger Lehen
- Der Prozess. Die Rollen von Innozenz III. und Otto von Braunschweig.
- Der Akkusationsprozess
- Der Inquisitionsprozess
- Heinrich von Istrien
- Das persönliche Verhältnis zwischen Heinrich und Philipp
- Die Eroberung der Stadt Zara
- Die venezianischen Interessen
- Die Rolle Bonifaz’ von Montferrat und die Interessen Philipps
- Die Tangierung der andechs-meranischen Interessen durch den Kreuzzug
- Die Verurteilung Heinrichs und sein langer Kampf um Rehabilitierung
- Landgraf Hermann von Thüringen
- Das Verhältnis Hermanns von Thüringen zu König Philipp
- Hatte Hermann den Plan, Philipp zu beseitigen?
- Wer sollte Nachfolger Philipps werden?
- Die Rollen König Philipps II. August von Frankreich und Herzog Heinrichs von Brabant
- Das Scheitern
- Der Mord an König Philipp von Schwaben – Privatrache oder wirklich Staatsstreich?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Mord an König Philipp von Schwaben im Jahr 1208. Ziel ist es, die bestehenden Forschungstheorien zu diesem Ereignis zu analysieren und zu bewerten, insbesondere die Frage nach den Motiven des Attentats und der möglichen Beteiligung weiterer Personen oder Gruppierungen. Die Arbeit hinterfragt die gängige Darstellung als reine Privatrache und untersucht die These eines Staatsstreiches.
- Die Motive des Königsmoerdes
- Die Rolle der Andechs-Meranier
- Die Bewertung der verschiedenen historischen Quellen
- Die politische Situation im Heiligen Römischen Reich um 1208
- Die Frage nach der Nachfolge Philipps
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Das Attentat von Bamberg – Ablauf und Thematisierung in der Forschung: Dieses Kapitel beschreibt den Ablauf des Attentats auf König Philipp von Schwaben und gibt einen Überblick über die bisherige Forschung zu diesem Ereignis. Es werden verschiedene Interpretationen und Theorien vorgestellt, die den Mord entweder als Privatrache oder als Staatsstreich einordnen. Die Fragestellung der Arbeit wird definiert: War der Mord ein Akt der Rache oder ein politisch motivierter Staatsstreich? Diese Einleitung legt den Grundstein für die detaillierte Untersuchung, die in den folgenden Kapiteln vorgenommen wird.
Quellenkritik: Dieses Kapitel analysiert kritisch die verschiedenen Quellen, die für die Untersuchung des Mordes an König Philipp von Schwaben herangezogen werden. Es werden einzelne Chronisten und ihre Werke im Detail beleuchtet, wobei deren jeweilige Position, mögliche Voreingenommenheiten und die Zuverlässigkeit ihrer Schilderungen untersucht werden. Die Analyse der Quellen bildet die Grundlage für die nachfolgenden Kapitel und erlaubt eine differenzierte Bewertung der verschiedenen Theorien über die Hintergründe des Attentats. Die verschiedenen Quellen werden jeweils auf ihre Glaubwürdigkeit und ihren Informationsgehalt hin untersucht, um ein fundiertes Bild des Ereignisses zu schaffen. Es werden sowohl die Autoren als auch deren Werke analysiert, um eventuelle Verzerrungen und subjektive Einflüsse zu identifizieren.
Der Königsmoerder Otto von Wittelsbach – seine Motive als Ansatz der klassischen Forschung: Dieses Kapitel beleuchtet die klassischen Forschungsansätze, die Otto von Wittelsbach als alleinigen Täter identifizieren und dessen Motive in der Auflösung einer Verlobung und einem Empfehlungsschreiben sehen. Die Arbeit analysiert die Stärken und Schwächen dieser Perspektive. Sie veranschaulicht die etablierte Sichtweise, aber weist gleichzeitig auf deren Grenzen hin, um den Weg für alternative Erklärungen zu ebnen. Der Fokus liegt hier auf der traditionellen Interpretation des Mordes und der kritischen Betrachtung der dazu verwendeten Argumente.
Der Königsmord als Staatsstreich: Die Thesen Huckers: Dieses Kapitel präsentiert und analysiert die These Huckers, welche den Mord als Staatsstreich deutet und eine Verschwörung mit der Beteiligung verschiedener Mächte und Personen vermutet. Es wird untersucht, welche Belege für diese These sprechen und wie diese im Kontext der zeitgenössischen politischen Landschaft zu interpretieren sind. Durch die Untersuchung der beteiligten Personen und Gruppen wird die Komplexität des Ereignisses deutlich. Diese These wird im Detail mit entsprechenden Belegen aus den vorangegangenen Kapiteln untermauert und kritisch hinterfragt. Es werden verschiedene Aspekte der Verschwörungstheorie detailliert erörtert und mit den Ergebnissen der Quellenkritik abgeglichen.
Wer sollte Nachfolger Philipps werden?: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Kandidaten für die Nachfolge Philipps und analysiert die Rolle der jeweiligen Interessengruppen. Es wird untersucht, wie die politische Landschaft durch den Mord beeinflusst wurde und welche Strategien verfolgt wurden, um die Nachfolge zu sichern. Der Fokus liegt hier auf den politischen Machtkämpfen nach dem Tod des Königs und den damit verbundenen strategischen Überlegungen. Die Analyse dieser Kapitel beleuchtet die komplexen politischen Konstellationen im Heiligen Römischen Reich und deren Einfluss auf das Ereignis.
Schlüsselwörter
König Philipp von Schwaben, Königsmord, Staatsstreich, Privatrache, Otto von Wittelsbach, Andechs-Meranier, Quellenkritik, mittelalterliche Geschichte, Staufer, Papsttum, Heiliges Römisches Reich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Attentat auf König Philipp von Schwaben
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Mord an König Philipp von Schwaben im Jahr 1208. Sie analysiert bestehende Forschungstheorien, insbesondere die Frage nach den Motiven des Attentats und der möglichen Beteiligung weiterer Personen oder Gruppierungen. Ein zentrales Thema ist die Hinterfragung der gängigen Darstellung als reine Privatrache und die Untersuchung der These eines Staatsstreiches.
Welche Quellen werden untersucht?
Die Arbeit analysiert kritisch verschiedene historische Quellen, darunter die Werke von Arnold von Lübeck, Otto von Sankt Blasien, die Marbacher Annalen, die Reinhardsbrunner Chronik, Burchard von Ursperg, Caesarius von Heisterbach, Hugo (Hugolinus) Graf von Segni (Papst Gregor IX.), Hermann von Altaich, eine Proskriptionsliste Ottos IV., die Kölner Königschronik, Aventinus (Johannes Turmair), die Braunschweigsiche Reimchronik und Walther von der Vogelweide. Die Quellen werden auf ihre Glaubwürdigkeit und ihren Informationsgehalt hin untersucht, um eventuelle Verzerrungen und subjektive Einflüsse zu identifizieren.
Welche Theorien zum Königsmord werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die klassische Forschungsperspektive, die Otto von Wittelsbach als alleinigen Täter sieht, dessen Motive in der Auflösung einer Verlobung und einem Empfehlungsschreiben liegen. Im Gegensatz dazu steht die These Huckers, die den Mord als Staatsstreich deutet und eine Verschwörung mit der Beteiligung verschiedener Mächte und Personen vermutet. Beide Theorien werden detailliert analysiert und kritisch bewertet.
Welche Rolle spielen die Andechs-Meranier?
Die Arbeit untersucht die mögliche Rolle der Andechs-Meranier bei dem Attentat. Es wird geprüft, ob Belege für eine Verschwörung oder Mitwisserschaft dieser Familie existieren. Die Analyse der Quellen soll Aufschluss darüber geben, ob und inwieweit die Andechs-Meranier in das Attentat verwickelt waren.
Welche Personen werden im Detail betrachtet?
Neben Otto von Wittelsbach werden weitere Schlüsselfiguren untersucht, darunter Bischof Ekbert von Bamberg, Heinrich von Istrien und Landgraf Hermann von Thüringen. Das Verhältnis dieser Personen zu König Philipp und ihre möglichen Motive werden analysiert.
Welche politische Situation wird betrachtet?
Die Arbeit beleuchtet die politische Situation im Heiligen Römischen Reich um 1208. Die Analyse umfasst die Staufer, das Papsttum, die politischen Machtkämpfe und die Frage nach der Nachfolge Philipps. Der Kontext des Attentats wird somit eingehend untersucht.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Quellenkritik, Kapitel zu den verschiedenen Theorien zum Königsmord (klassische Forschung und die These Huckers), ein Kapitel zur Nachfolgefrage und ein Fazit. Die Kapitelzusammenfassungen liefern einen Überblick über die behandelten Themen und Ergebnisse.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: König Philipp von Schwaben, Königsmord, Staatsstreich, Privatrache, Otto von Wittelsbach, Andechs-Meranier, Quellenkritik, mittelalterliche Geschichte, Staufer, Papsttum, Heiliges Römisches Reich.
Welches ist das Hauptziel der Arbeit?
Das Hauptziel der Arbeit ist es, die bestehenden Forschungstheorien zum Mord an König Philipp von Schwaben zu analysieren und zu bewerten, um ein umfassenderes Verständnis des Ereignisses und seiner Hintergründe zu ermöglichen.
- Quote paper
- Magister Artium Robin Füchtner (Author), 2004, Der Mord an König Philipp von Schwaben - Privatrache oder Staatsstreich?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/61070