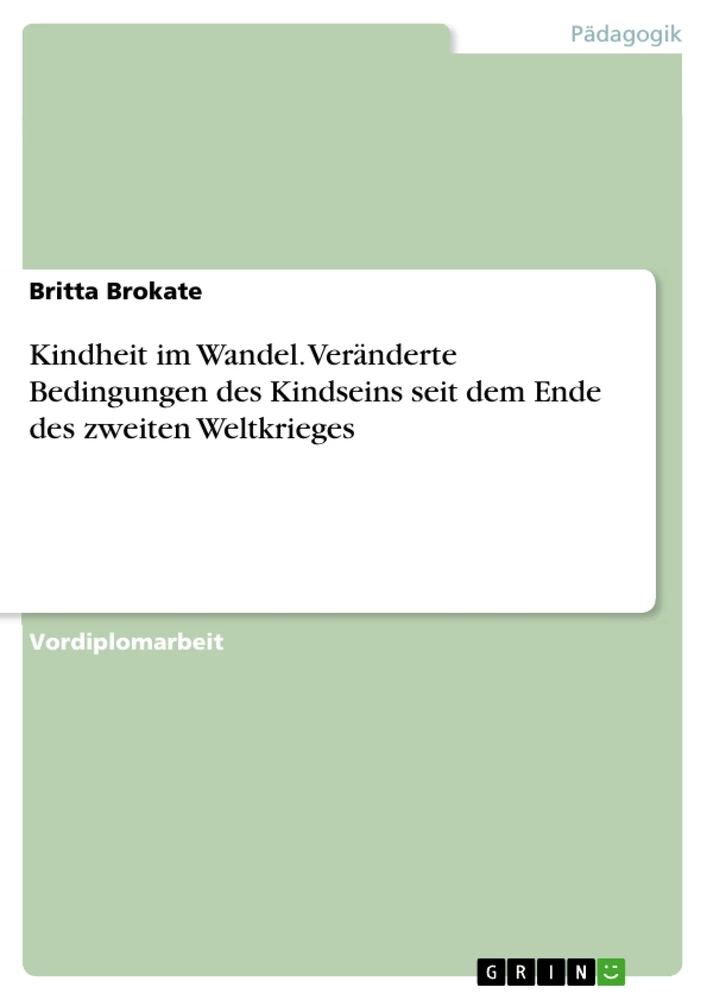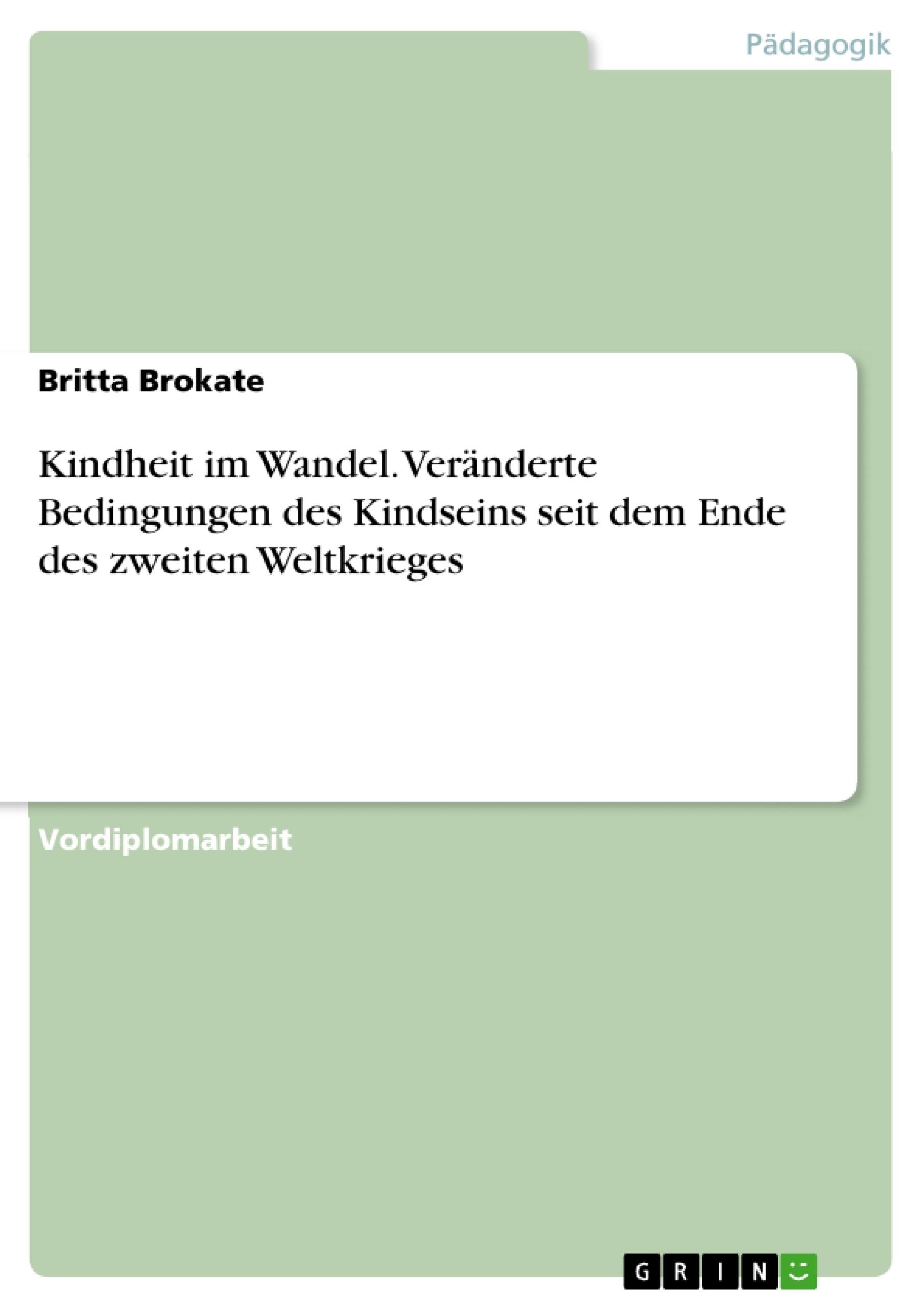Seit Beginn der Nachkriegszeit hat sich die Gesellschaft rasant und grundlegend gewandelt. Die Veränderungen erstrecken sich auf fast alle Bereiche des sozialen Lebens, dazu gehören unter anderem soziale Abläufe, familiäre Lebens-, sowie Schul- und Arbeitswelten und die Vielfalt körperlicher und psychischer Erkrankungen. Diese soziokulturell, sozioökonomisch und gesellschaftlich-politisch beobachtbaren Wandlungsprozesse in den letzten Jahrzehnten erfassen längst auch die Kinder, die heutzutage in veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen aufwachsen, und man infolge dessen durchaus von einem Wandel des sozialen Zustandes „Kindheit“ sprechen kann. Diese „veränderte Kindheit“ hat wiederum zum Teil schwerwiegende Änderungen für die Verläufe und Ergebnisse des Aufwachsens von Kindern und Jugendlichen, sowie deren Handlungsweisen zur Folge. So stellt jeder von uns direkt erhebliche Unterschiede zu unserer eigenen Kindheit fest, wenn uns Großeltern von ihrer Kindheit erzählen, und unter welchen Bedingungen sie damals aufgewachsen und in die Gesellschaft integriert worden sind.
Im Folgenden soll versucht werden, den Beginn, sowie den geschichtlichen Ablauf des Wandels der Kindheit seit den 1940er Jahren überblicksartig darzustellen. Den Fragen, inwieweit gesellschaftliche Veränderungsprozesse das Wesen von Kindheit verändert haben, und wie die sozialen Lebenszusammenhänge von Kindern gegenwärtig aussehen, soll auf den Grund gegangen werden. Dabei wird anhand ausgewählter Generationsvergleiche und Modernisierungsprozesse in der Kindheit aufgezeigt, dass sich durch verschiedenste äußere Einflüsse ein Wandel der Kindheit vollzogen hat, der sich in mehreren Erscheinungsformen erfassen lässt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Einblick in die historische Entwicklung von Kindheit
- Die Nachkriegskinder und die Konsumkinder – Kindheitsverläufe zweier Generationen
- Charakteristiken typischer Kindheit der 40er Generation
- Veränderungsaspekte heutiger Kindheit
- Veränderte Grundstrukturen heutiger kindlicher Lebensbedingungen
- Wandel sozioökonomischer Rahmenbedingungen
- Wandel der familiären Lebenswelt
- Reduktion der Geburtenrate
- Müttererwerbstätigkeit
- Vielfalt an Familienkonstellationen
- Die Rolle der Medien für die Kindheit
- Veränderte räumliche Lebensbedingungen der Kinder
- Allgemeine Veränderungen in der Großstadt
- Veränderte Wohn- und Außenbereiche
- Modell der Verinselung des kindlichen Lebensraumes
- Zeiterleben in heutiger Kindheit
- Spiel- und Freizeitverhalten im Wandel
- Vom Befehlen zum Verhandeln – Veränderungen des Erziehungsverhaltens
- Gewalt in der Erziehung
- Die Erziehungsnormen des Verhandlungshaushalts und ihre Konsequenzen
- Verhalten und Reaktionen der Kinder in Anbetracht der Veränderungen
- Veränderte Grundstrukturen heutiger kindlicher Lebensbedingungen
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Wandel der Kindheit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Ziel ist es, die Veränderungen der sozialen Lebensbedingungen von Kindern aufzuzeigen und deren Auswirkungen auf das Aufwachsen und die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu analysieren. Dabei werden verschiedene Generationen verglichen und die Einflüsse gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse beleuchtet.
- Der Einfluss sozioökonomischer Veränderungen auf die Kindheit
- Wandel der familiären Strukturen und deren Auswirkungen auf Kinder
- Die Rolle der Medien und des Konsums in der modernen Kindheit
- Veränderungen im räumlichen Lebensumfeld von Kindern
- Entwicklung des Erziehungsverhaltens und seine Folgen
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt den grundlegenden Wandel der Gesellschaft seit dem Zweiten Weltkrieg und dessen Auswirkungen auf die Kindheit. Es wird deutlich gemacht, dass sich die Lebensbedingungen von Kindern drastisch verändert haben und dies schwerwiegende Folgen für deren Entwicklung hat. Der Text kündigt die bevorstehende Analyse des Wandels der Kindheit an, die auf ausgewählten Generationsvergleichen und Modernisierungsprozessen basiert.
Einblick in die historische Entwicklung von Kindheit: Dieses Kapitel bietet einen kurzen Überblick über die historische Entwicklung des Konzepts der Kindheit. Es wird dargestellt, dass der Begriff „Kindheit“ als eigenständige Lebensphase erst im Laufe der Geschichte entstand und sich die Einstellung zu Kindern im Laufe der Zeit deutlich verändert hat. Der Fokus liegt jedoch auf dem Wandel der Kindheit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs.
Die Nachkriegskinder und die Konsumkinder – Kindheitsverläufe zweier Generationen: Dieses Kapitel vergleicht die Kindheitserfahrungen der Generation der 1940er Jahre mit denen der 1960er Jahre. Es zeigt auf, wie die einmaligen sozialen Bedingungen dieser Epochen zu charakteristischen Kindheitserfahrungen führten und die Sozialisationsgeschichte der jeweiligen Generation prägten. Der Vergleich verdeutlicht den starken Umbruch, der sich in diesen Generationen widerspiegelt. Die Charakteristika der Kindheit der 40er Jahre werden ausführlich dargestellt, mit Fokus auf die Auswirkungen des Krieges, wie Vaterlosigkeit, Wohnungsnot und räumliche Enge.
Häufig gestellte Fragen zum Text: Wandel der Kindheit
Was ist der Hauptfokus dieses Textes?
Der Text untersucht den Wandel der Kindheit seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Er analysiert die Veränderungen der sozialen Lebensbedingungen von Kindern und deren Auswirkungen auf deren Aufwachsen und Entwicklung. Dabei werden verschiedene Generationen verglichen, und der Einfluss gesellschaftlicher Modernisierungsprozesse wird beleuchtet.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt folgende Themenschwerpunkte: den Einfluss sozioökonomischer Veränderungen auf die Kindheit, den Wandel der familiären Strukturen und deren Auswirkungen, die Rolle der Medien und des Konsums, Veränderungen im räumlichen Lebensumfeld, die Entwicklung des Erziehungsverhaltens und dessen Folgen sowie einen Vergleich der Kindheitserfahrungen von Nachkriegskindern und Konsumkindern.
Welche Generationen werden verglichen?
Der Text vergleicht vor allem die Kindheitserfahrungen der Generation der 1940er Jahre (Nachkriegskinder) mit denen der 1960er Jahre (Konsumkinder). Der Vergleich soll den starken Umbruch in den Lebensbedingungen und -erfahrungen von Kindern in diesen beiden Epochen aufzeigen.
Wie wird der Wandel der Kindheit im Text dargestellt?
Der Wandel wird durch den Vergleich verschiedener Generationen und die Analyse von Modernisierungsprozessen dargestellt. Es werden Veränderungen in sozioökonomischen Rahmenbedingungen, familiären Strukturen, Mediennutzung, räumlichen Lebensbedingungen, Erziehungsverhalten und dem Zeiterleben von Kindern beleuchtet.
Welche Aspekte der familiären Lebenswelt werden betrachtet?
Der Text betrachtet die Reduktion der Geburtenrate, die zunehmende Müttererwerbstätigkeit und die Vielfalt an Familienkonstellationen als wichtige Veränderungen der familiären Lebenswelt und deren Auswirkungen auf Kinder.
Welche Rolle spielen Medien und Konsum?
Der Text untersucht die zunehmende Bedeutung von Medien und Konsum in der modernen Kindheit und deren Einfluss auf das Aufwachsen und die Entwicklung von Kindern. Die Konsumkinder der 1960er Jahre werden in diesem Zusammenhang explizit behandelt.
Wie werden Veränderungen im räumlichen Lebensumfeld der Kinder beschrieben?
Der Text beschreibt Veränderungen in Großstädten, Wohn- und Außenbereichen und entwickelt das Modell der "Verinselung des kindlichen Lebensraumes", um die veränderten räumlichen Bedingungen der Kindheit zu verdeutlichen.
Welche Veränderungen im Erziehungsverhalten werden analysiert?
Der Text analysiert den Wandel vom autoritären "Befehlen" zum verhandlungsorientierten "Verhandeln" im Erziehungsverhalten. Dabei werden auch die Themen Gewalt in der Erziehung und die Erziehungsnormen des "Verhandlungshaushaltes" und deren Konsequenzen diskutiert.
Welche Kapitel umfasst der Text?
Der Text umfasst Kapitel zu Einleitung, historischer Entwicklung der Kindheit, Vergleich der Nachkriegs- und Konsumkinder, veränderten Aspekten heutiger Kindheit und einer Zusammenfassung. Die Kapitel zu den Nachkriegs- und Konsumkindern stellen einen detaillierten Vergleich dar, während die Einleitung den Kontext des Wandels beschreibt und die Zusammenfassung die Ergebnisse zusammenfasst.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist übersichtlich strukturiert mit Inhaltsverzeichnis, Zielsetzung und Themenschwerpunkten, Kapitelzusammenfassungen und Schlüsselbegriffen. Dies ermöglicht eine schnelle Orientierung und erleichtert das Verständnis der komplexen Thematik.
- Quote paper
- Britta Brokate (Author), 2006, Kindheit im Wandel. Veränderte Bedingungen des Kindseins seit dem Ende des zweiten Weltkrieges, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60935