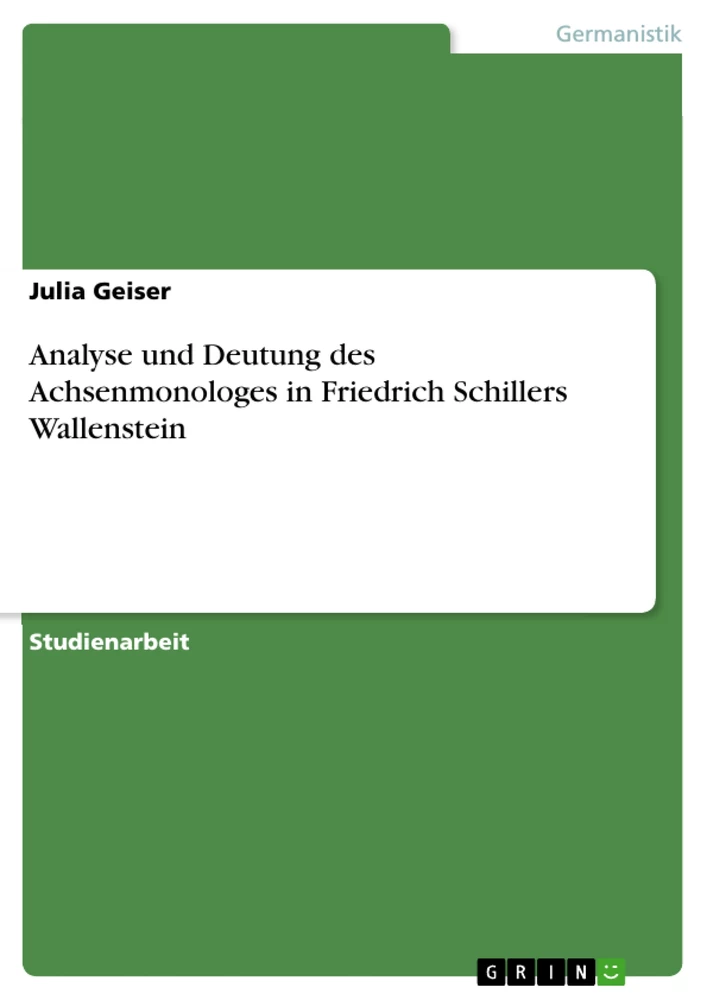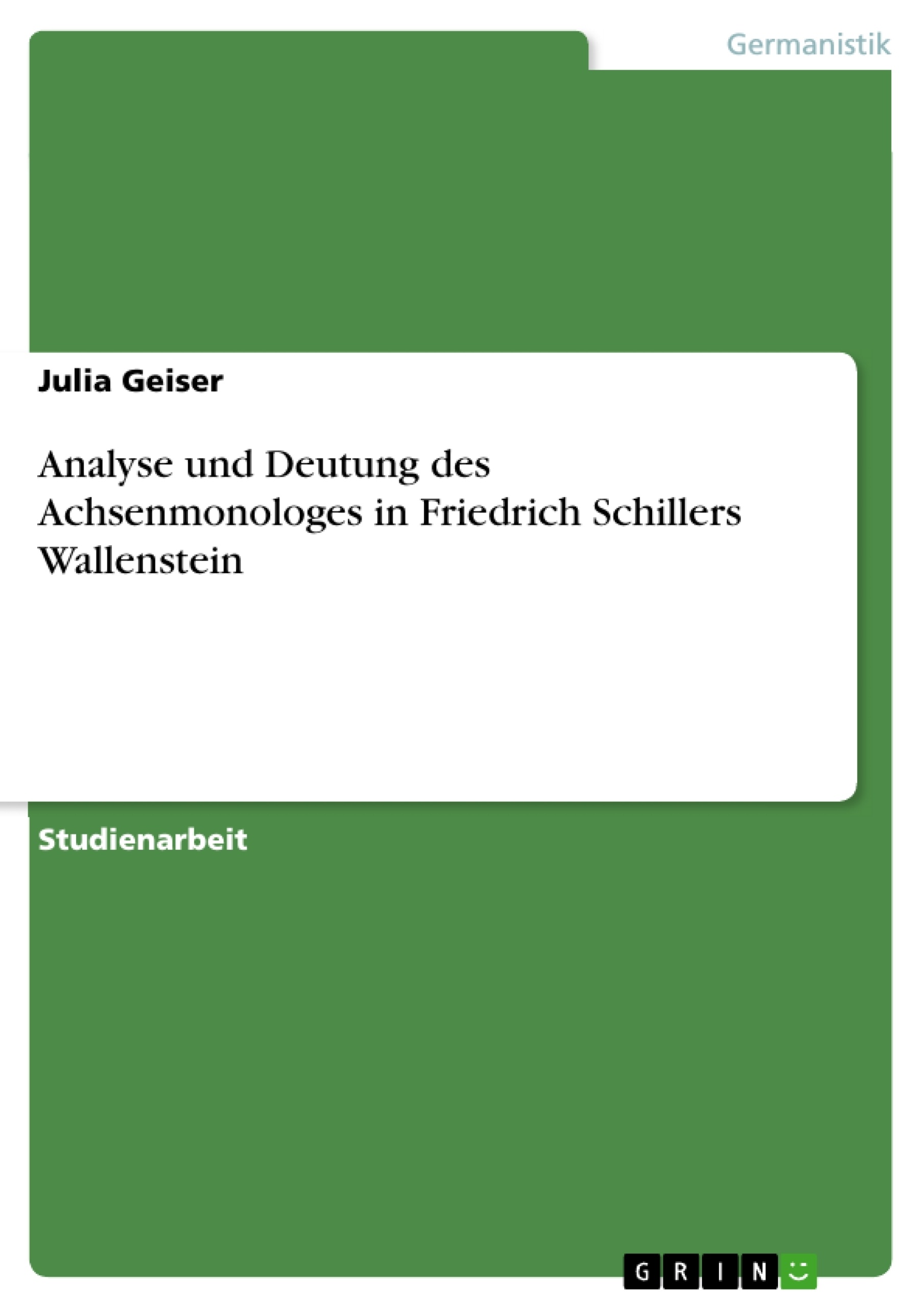„Ernst ist das Leben, heiter ist die Kunst.“1 - mit diesem Satz endet der Prolog Schillers zu seiner großen Wallenstein-Trilogie. Und genau diese Gegensätze, die heitere Kunst und das ernste Leben, versucht Schiller in seinem außergewöhnlichen Werk zu vereinen. Er verknüpft in seinem Werk die Historie eines Feldherren mit den philosophischen Ideen der damaligen Zeit und verleiht dem Ganzen durch seine Sprache und der Versform Eleganz und Dramatik. Was den besonderen Anreiz dieses Dramas von Friedrich Schiller ausmacht, kann auf die Schnelle aber nicht genau gesagt werden. Und doch zählt die Wallenstein-Trilogie zu den Eckpfeilern der deutschen Literaturgeschichte. Bis in die heutige Zeit hinein gehört Wallenstein von Friedrich Schiller, neben Faust von Goethe, zu den Pflichtthemen im Deutschunterricht am Gymnasium. Und besonders der Monolog Wallensteins, der im dritten Buch der Trilogie im vierten Abschnitt des ersten Aktes zu finden ist, wird gerne als Beispiel herausgegriffen.
In diesem Monolog wird die Grundproblematik des Werkes zusammengefasst, weshalb er auch gerne als Achsenmonolog bezeichnet wird, da sich die gesamte Trilogie um diesen Monolog dreht.
Inhaltsverzeichnis
- Friedrich Schillers Wallenstein – ein außergewöhnliches Werk:
- Einordnung des Monologs in das Gesamtwerk:
- Deutung und Analyse des Monologs:
- Gedanke und Tat:
- Doppelsinn des Lebens:
- Freiheit und Notwendigkeit:
- Überlegenheit der traditionellen Herrschaft:
- Handlungsfreiheit Wallensteins:
- Schuldfrage Wallensteins:
- Aktualität der Wallenstein-Trilogie:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Analyse und Deutung des Achsenmonologs aus Friedrich Schillers Wallenstein-Trilogie. Ziel ist es, die Bedeutung dieses Monologs im Kontext des Gesamtwerks zu ergründen und die darin aufgeworfenen Fragen nach Handlungsfreiheit, Schuld und der Beziehung zwischen Kunst und Wirklichkeit zu beleuchten.
- Die Frage der Handlungsfreiheit Wallensteins und die Abgrenzung zwischen Entscheidungsfreiheit und Notwendigkeit.
- Die Schuldfrage Wallensteins und die Rolle des Schicksals in seinem Untergang.
- Die Beziehung zwischen Kunst und Wirklichkeit im Werk und die Verknüpfung von Historie und Philosophie.
- Die Darstellung von Machtstrukturen und die Kritik an der traditionellen Herrschaft.
- Die Aktualität der Wallenstein-Trilogie und ihre Relevanz für die heutige Zeit.
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil der Arbeit befasst sich mit der Einordnung des Achsenmonologs in die gesamte Wallenstein-Trilogie, wobei die einzelnen Teile der Trilogie und der Prolog beleuchtet werden.
Der zweite Teil der Arbeit widmet sich einer formalen und sprachlichen Analyse des Monologs und versucht, einen Überblick über die zentralen Themen und Argumentationslinien zu gewinnen.
Im dritten Teil der Arbeit wird die Frage nach Wallensteins Handlungsfreiheit untersucht und analysiert, inwieweit er sich in der Situation des Monologs noch frei entscheiden kann.
Der vierte Teil der Arbeit behandelt die Schuldfrage Wallensteins und untersucht die Frage, inwieweit er für sein Schicksal verantwortlich ist oder ob es von vornherein vorbestimmt war.
Schlüsselwörter
Friedrich Schiller, Wallenstein, Achsenmonolog, Handlungsfreiheit, Schuld, Notwendigkeit, Schicksal, Kunst, Wirklichkeit, Geschichte, Philosophie, Macht, Herrschaft, Dreißigjähriger Krieg, Tragödie.
- Quote paper
- Julia Geiser (Author), 2005, Analyse und Deutung des Achsenmonologes in Friedrich Schillers Wallenstein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60913