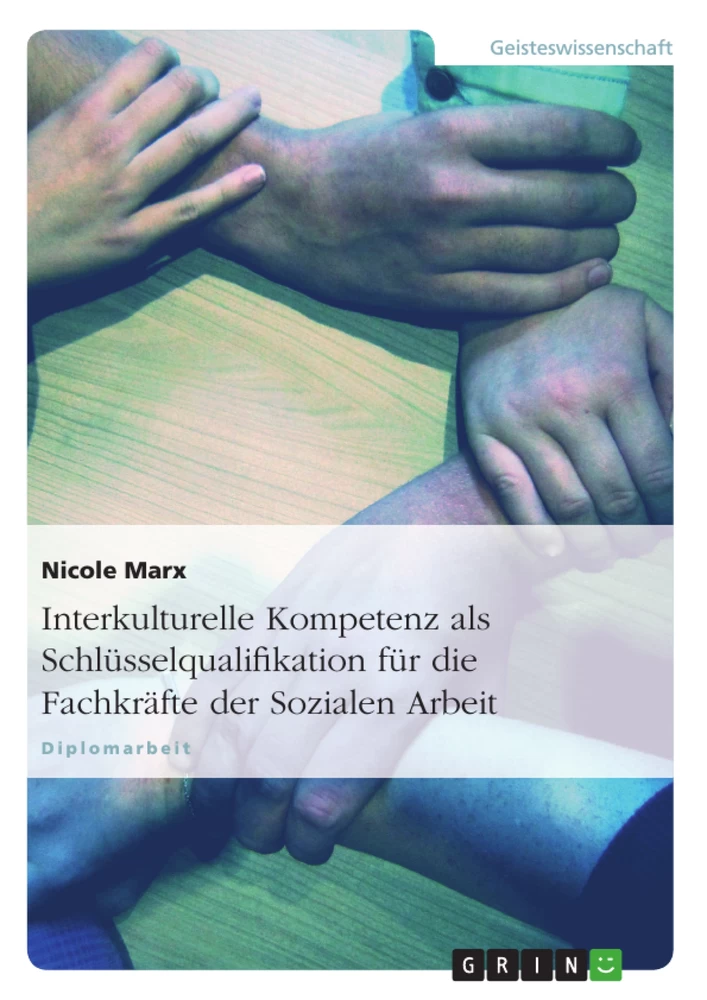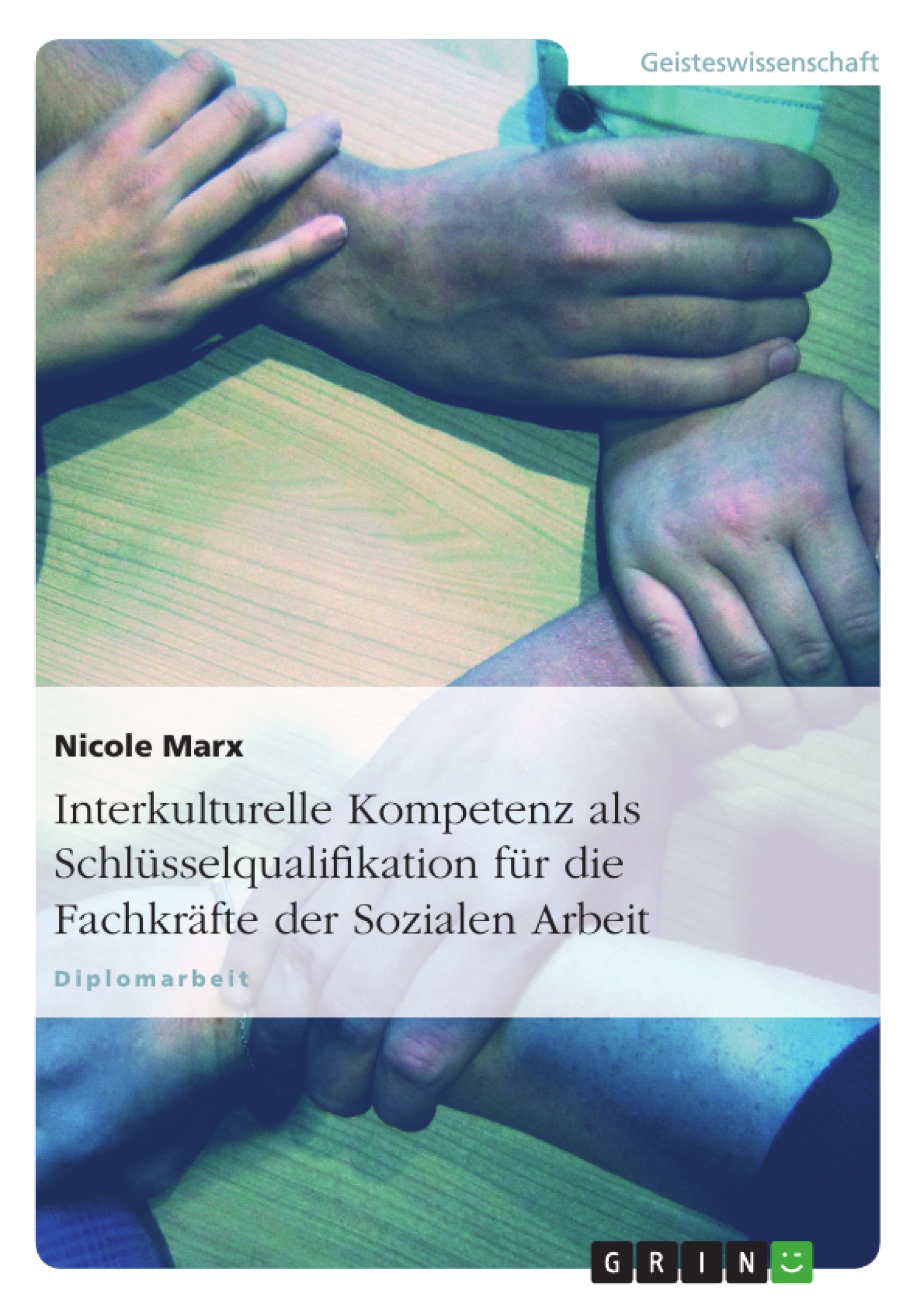In modernen Gesellschaften wie der BRD ist eine zunehmende kulturelle Vielfalt zu verzeichnen. Als mögliche Ursachen dieser kulturellen Ausdifferenzierung können die Zuwanderung von Individuen aus verschiedensten Kulturkreisen, die Entstehung einer großen Bandbreite subkultureller Milieus als Folge gesellschaftlicher Differenzierungsprozesse sowie eine zunehmende Interaktionsdichte im Zuge regionaler sowie globaler Wandlungsprozesse (z. B. Globalisierung, deutsche Wiedervereinigung und europäische Integration) angeführt werden.
Ausgehend von einem erweiterten Kulturverständnis, welches den dynamischen Charakter von Kultur betont und die Differenzierung in Teilkulturen, Subkulturen und Milieus beinhaltet, können Kulturen nicht mehr auf Nationalkulturen reduziert oder als statisch angesehen werden. Aus einer solchen differenzierteren Perspektive ergibt sich ein neues Verständnis kultureller Vielfalt und den damit einhergehenden interkulturellen Begegnungen (vgl. Handschuck/Klawe 2004; Freise 2005). Diese Entwicklungen führen dazu, dass interkulturelle Erfahrungen heute zum Lebensalltag der Menschen gehören und ihre individuelle und kollektive Identitätsbildung prägen.
Vor diesem Hintergrund wird interkulturelle Kompetenz zu einer notwendigen Qualifikation für Fachkräfte in der Sozialer Arbeit. Die Aktualität des Diskurses um interkulturelle Kompetenz spiegelt sich in den unzähligen Veröffentlichungen und Debatten wieder. Es sind vielschichtige und umfangreiche Kompetenzprofile veröffentlicht worden, die allerdings den Überblick über die Diskussionen und eine mögliche Quintessenz erschweren (vgl. Friesenhahn/Rickert 2006: 30; Leiprecht 2002: 88; Auernheimer 2002: 183).
Ziel dieser Arbeit ist es aufzuzeigen, welche gesellschaftlichen Wandlungsprozesse und Erkenntnisse die Forderung nach einem erweiterten Verständnis von Interkulturalität begründen. Weiterhin soll der Versuch unternommen werden, aus den identifizierten Entwicklungen eine plausible Begründung für folgende These abzuleiten: Interkulturelle Kompetenz ist heute als Schlüsselqualifikation für Fachkräfte der Sozialen Arbeit anzusehen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsdefinitionen
- 2.1. Kultur
- 2.1.1. Der Kulturbegriff im Wandel
- 2.1.2. Orientierungsfunktion und Symbolcharakter von Kultur
- 2.1.3. Der Kulturbegriff im Rahmen dieser Arbeit
- 2.2. Das Eigene und das Fremde
- 2.2.1. Fremdwahrnehmung
- 2.2.2. Die eigene und kollektive Identität
- 2.2.3. Konstruktion des Fremden und Eigenen
- 2.3. Das Interkulturelle
- 2.3.1. Das Interkulturelle als Zustands- und Prozessbeschreibung
- 2.3.2. Abgrenzung zum Mulikulturalismus
- 2.3.3. Kritik am Konzept der Interkulturalität
- 2.3.4. Definition von Interkulturalität
- 2.4. Interkulturelle Kompetenz
- 3. Im Kontext der interkulturellen Kompetenz relevante gesellschaftliche Entwicklungen und Wandlungsprozesse
- 3.1. Sozialer Wandel
- 3.1.1. Wertewandel und die Pluralisierung der Lebenswelten
- 3.1.2. Risikogesellschaft und Veränderungen der Arbeitsgesellschaft
- 3.2. Globalisierung
- 3.2.1. Ökonomische Aspekte
- 3.2.2. Sozio-kulturelle Aspekte
- 3.2.2.1. Mobilität
- 3.2.2.2. Migration
- 3.2.2.3. Kommunikationstechnologien als wesentliches Element der Globalisierung
- 4. Debatten um „Kulturelle Vielfalt“
- 4.1. Kulturelle Diversität
- 4.1.1. Die mehrkulturelle Gesellschaft
- 4.1.2. Subkulturen
- 4.2. Umgang mit Diversität: zwischen Annerkennung und Ausgrenzung
- 4.2.1. Ausgrenzungstendenzen
- 4.2.2. Kulturelle Differenzen
- 5. Bedeutung der kulturellen Diversität für die interkulturelle Soziale Arbeit
- 5.1. Kategorisierung interkultureller Sozialer Arbeit
- 5.1.1. Adressatengruppen interkultureller Sozialer Arbeit
- 5.1.2. Umgang mit Differenzen in der Sozialen Arbeit
- 5.1.3. Anschlussfähigkeit interkultureller Ansätze an vorhandene Handlungskonzepte Sozialer Arbeit
- 5.1.4. Anforderungen an Fachkräfte der Sozialen Arbeit
- 5.2. Kompetenzanforderungen
- 5.2.1. Der Kompetenzbegriff
- 5.2.1. Der Begriff der Schlüsselqualifikation
- 6. Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation
- 6.1. Ebenen interkultureller Kompetenz
- 6.2. Elemente interkultureller Kompetenz
- 6.3. Erwerb interkultureller Kompetenzen
- 6.4. Kritik am Konzept der interkulturellen Kompetenz
- 6.5. Besondere Relevanz interkultureller Kompetenz für die Fachkräfte der Jugendarbeit
- 6.5.1. Der sozio-kulturelle Lebenskontext junger Menschen
- 6.5.2. Interkulturelle Anforderungen an die Fachkräfte der Jugendarbeit
- 6.5.3. Bedeutung interkultureller Kompetenz für Fachkräfte der Jugendarbeit
- 7. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Relevanz von interkultureller Kompetenz als Schlüsselqualifikation für Fachkräfte in der Sozialen Arbeit. Sie analysiert gesellschaftliche Wandlungsprozesse und Erkenntnisse, die die Forderung nach einem erweiterten Verständnis von Interkulturalität begründen. Die Arbeit strebt danach, aus diesen Entwicklungen eine plausible Begründung für die These abzuleiten, dass interkulturelle Kompetenz heute eine wesentliche Qualifikation für Fachkräfte in der Sozialen Arbeit ist.
- Der dynamische Kulturbegriff und seine Bedeutung für die Interkulturelle Kompetenz
- Die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse, die die Notwendigkeit interkultureller Kompetenz hervorheben
- Der Umgang mit kultureller Diversität in der Sozialen Arbeit
- Die Bedeutung von interkultureller Kompetenz für die Fachkräfte der Jugendarbeit
- Die Bedeutung des interkulturellen Ansatzes für die Fachkräfte der Sozialen Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet den aktuellen Diskurs um interkulturelle Kompetenz und stellt die gesellschaftlichen Entwicklungen in den Vordergrund, die diese Forderung hervorrufen. Der Fokus liegt dabei auf den wachsenden kulturellen Vielfalt in modernen Gesellschaften und der Notwendigkeit interkultureller Kompetenz für Fachkräfte in der Sozialen Arbeit. Kapitel zwei widmet sich der Definition relevanter Begriffe wie Kultur, Fremdheit, Interkulturalität und interkulturelle Kompetenz. Das dritte Kapitel beleuchtet die gesellschaftlichen Wandlungsprozesse, die mit der Entwicklung der interkulturellen Kompetenz verbunden sind. Hierbei werden sowohl der soziale Wandel, insbesondere der Wertewandel und die Pluralisierung der Lebenswelten, als auch die Globalisierungsprozesse, die mit einer zunehmenden Mobilität von Individuen und Ideen einhergehen, analysiert. Kapitel vier beschäftigt sich mit der kulturellen Vielfalt in der deutschen Gesellschaft und dem Umgang mit Diversität. Hierbei werden die Herausforderungen der Integration und die Tendenzen zur Ausgrenzung beleuchtet. Kapitel fünf untersucht die Bedeutung der kulturellen Vielfalt für die Soziale Arbeit und analysiert verschiedene Ansätze, wie die Soziale Arbeit mit Diversität umgeht. Darüber hinaus werden die Herausforderungen und Anforderungen an Fachkräfte der Sozialen Arbeit im Umgang mit interkulturellen Situationen thematisiert. Kapitel sechs setzt sich schließlich mit der interkulturellen Kompetenz als Schlüsselqualifikation auseinander. Es werden verschiedene Ebenen und Elemente der interkulturellen Kompetenz vorgestellt sowie deren Erwerb und die Kritikpunkte am Konzept beleuchtet. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der besonderen Relevanz interkultureller Kompetenz für Fachkräfte der Jugendarbeit.
Schlüsselwörter
Interkulturelle Kompetenz, Soziale Arbeit, Kulturbegriff, gesellschaftlicher Wandel, Globalisierung, kulturelle Diversität, Integration, Ausgrenzung, Fachkräfte der Sozialen Arbeit, Jugendarbeit.
- Quote paper
- Dipl. Sozialpädagogin Nicole Marx (Author), 2006, Interkulturelle Kompetenz als Schlüsselqualifikation für die Fachkräfte der Sozialen Arbeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60776