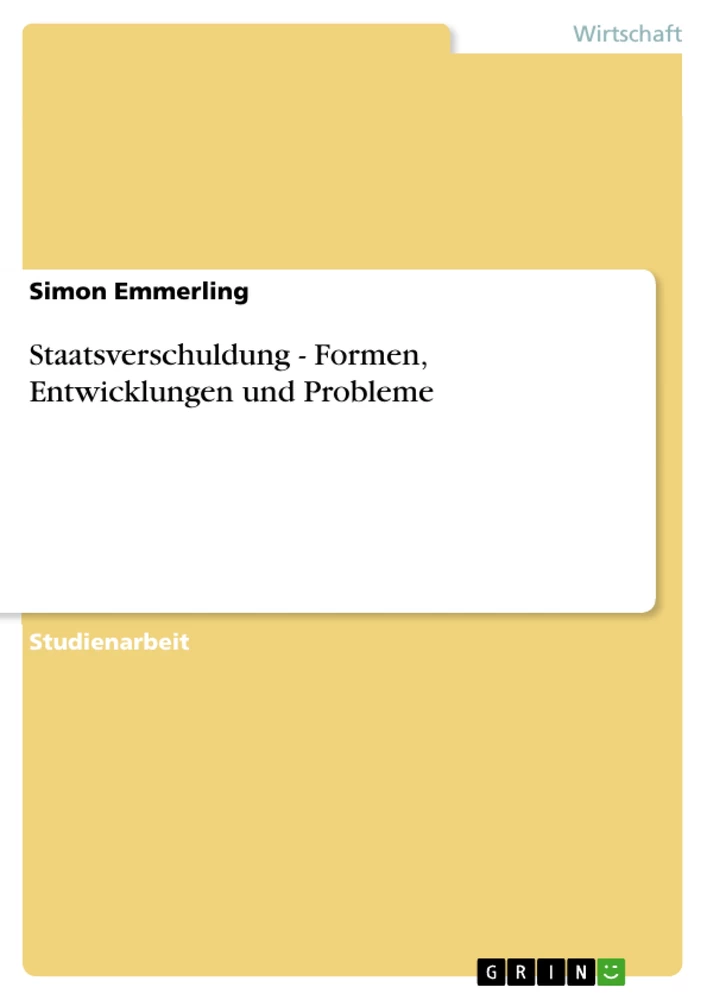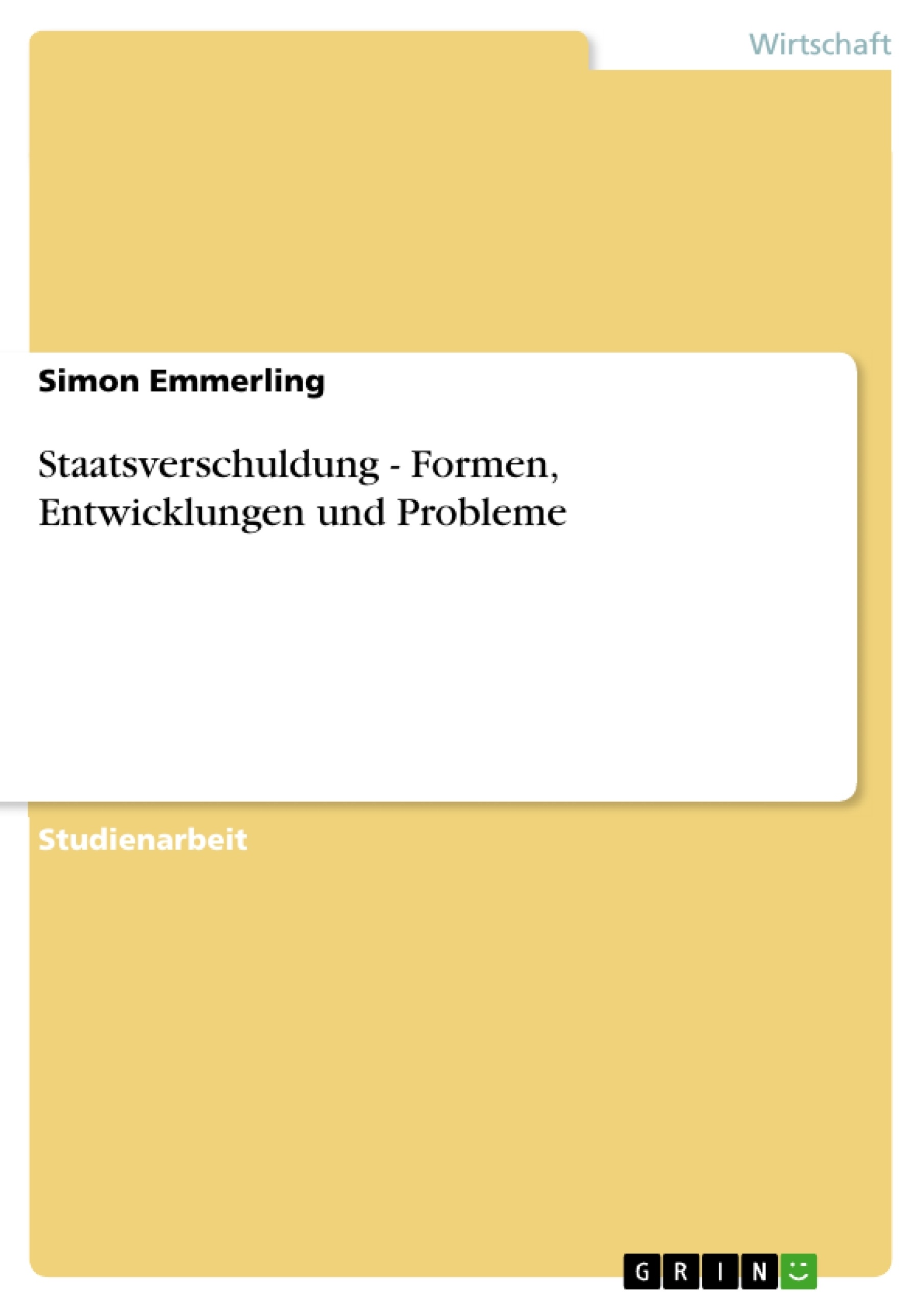Nicht erst seit dem Vertrag von Maastricht und den damit verbundenen Konvergenzkriterien, die zur Teilhabe an der Wirtschaft- und Währungsunion der Europäischen Gemeinschaft ermächtigen, ist das Thema Staatsverschuldung wieder stärker in das Bewusstsein der allgemeinen Öffentlichkeit geraten.
Allzu lange, so scheint es jedoch, war die mittlerweile zu einem sehr ernsthaften Problem gewordene Frage einer kreditfinanzierten Ausgabenpolitik bewusst oder unbewusst aus dem öffentlichen Blickfeld geraten.
Dass aber die Schuldenproblematik, auch gemessen an der Präsenz in den Medien, zunehmend an Bedeutung gewinnt, ist nur zu einem Teil darauf zurückzuführen, dass die Bundesrepublik gewillt ist, sich an den Konvergenzkriterien zu orientieren. Der andere Teil rührt von der Tatsache her, dass die Rot-Grüne-Bundesregierung einen finanzpolitischen Konsolidierungskurs eingeschlagen hat, der für die nähere Zukunft einen Bundeshaushalt ohne erneute Netto-Kreditaufnahmen vorsieht. Dies alles geschieht u.a. vor dem Hintergrund, dass schon heute jeder fünfte Steuereuro für die Tilgung von Zinsen verwendet werden muss. Konsequent zu Ende gedacht, engt diese Entwicklung den politischen Gestaltungsspielraum bereits dieser Tage so stark ein, dass für engagierte Projekte und nötige Reformen, die zunächst mit entsprechend hohen Kosten verbunden wären, nahezu keine Wahlalternativen in finanzieller Hinsicht mehr vorhanden sind.
Diese Arbeit möchte, im Rahmen ihrer durch den geplanten Umfang begrenzten Möglichkeiten, Formen, Entwicklungen und Probleme staatlicher Verschuldung darstellen. Dabei bildet die Untersuchung der Begriffe 'Staat' und 'Verschuldung' die Ausgangsbasis (A). Sobald diese Begriffe hinreichend definiert sind, bleibt die Frage offen, welche Verschuldungsformen es in der Bundesrepublik gibt (B): Bei wem verschuldet sich der Staat? Auf wie lange Zeit, und in welchen Strukturen? Und letztlich wird zu untersuchen sein, wofür sich der Staat eigentlich verschuldet (C): Mit welcher Begründung darf, kann, oder gar soll sich der Staat verschulden, und welche Probleme gehen mit der jeweiligen Begründung einher? Den Abschluss der Arbeit bildet die Vorstellung von Entwicklungen und Grenzen (D), die, wie oben angedeutet rechtlichen Charakter haben, oder aber auch ökonomischer Natur sein können.
Inhaltsverzeichnis
- Teil I: Einleitung
- Teil II: Darstellung
- (A) Definitionen: „Staat“ und „Staatsverschuldung“
- 1. Was ist unter „Staat“ zu verstehen?
- 2. Was heißt „Staatsverschuldung“?
- (B) Formen der Verschuldung
- (C) Wofür verschuldet sich der Staat? Gründe der Verschuldung und damit verbundene Probleme
- (D) Entwicklungen und Grenzen der Verschuldung
- (A) Definitionen: „Staat“ und „Staatsverschuldung“
- Teil III: Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Formen, Entwicklungen und Probleme staatlicher Verschuldung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Arbeit beginnt mit der Definition der Begriffe „Staat“ und „Staatsverschuldung“ und beleuchtet anschließend verschiedene Formen der Verschuldung, betrachtet die Gründe für staatliche Verschuldung und die damit verbundenen Probleme, sowie die Entwicklungen und Grenzen der Verschuldung. Der Fokus liegt auf der Analyse der deutschen Situation im Kontext der föderalen Struktur und der europäischen Einbindung.
- Definition von „Staat“ und „Staatsverschuldung“ im deutschen Kontext
- Formen der staatlichen Verschuldung (zeitlicher, lokaler und struktureller Aspekt)
- Gründe für staatliche Verschuldung (Kassenkredite, Deckungskredite und deren fiskalische, konjunktur- und verteilungspolitische Begründungen)
- Entwicklung der öffentlichen Verschuldung in Deutschland
- Rechtliche und ökonomische Grenzen der staatlichen Verschuldung
Zusammenfassung der Kapitel
Teil I: Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der Staatsverschuldung ein und betont deren zunehmende Bedeutung im öffentlichen Bewusstsein, insbesondere im Zusammenhang mit dem Vertrag von Maastricht und den Konvergenzkriterien. Sie hebt die Notwendigkeit einer Untersuchung der Formen, Entwicklungen und Probleme staatlicher Verschuldung hervor und skizziert den Aufbau der Arbeit, der von der Definition der zentralen Begriffe über die verschiedenen Formen der Verschuldung bis hin zu den Gründen, Entwicklungen und Grenzen der Verschuldung reicht. Die Einleitung verweist auf die Bedeutung der Staatsverschuldung für den politischen Gestaltungsspielraum und den Druck, durch Tilgung von Zinsen entstehende Ausgaben zu decken.
Teil II: Darstellung (A) Definitionen: „Staat“ und „Staatsverschuldung“: Dieser Abschnitt klärt die zentralen Begriffe der Untersuchung. „Staat“ wird im deutschen Kontext definiert, wobei die föderalen Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden) und weitere Institutionen wie bundeseigene Betriebe und Parafisci (z.B. der Fond „Deutsche Einheit“) berücksichtigt werden. Die Definition von „Staatsverschuldung“ umfasst den Schuldenstand, die Neuverschuldung und die (Netto-) Kreditaufnahme. Die unterschiedlichen Akteure und ihre jeweiligen Verschuldungsmöglichkeiten werden systematisch dargestellt.
Teil II: Darstellung (B) Formen der Verschuldung: Dieser Abschnitt untersucht verschiedene Formen der Staatsverschuldung unter zeitlichen, lokalen und strukturellen Aspekten. Der zeitliche Aspekt betrachtet die Dauer der Verschuldung, der lokale Aspekt den Gläubigerkreis, und der strukturelle Aspekt die verschiedenen Arten von Staatsanleihen (Direktausleihungen, Obligationen, Schatzanweisungen, Bundesschatzbriefe und Bundesanleihen). Die jeweiligen Charakteristika und Unterschiede dieser Formen werden detailliert erläutert.
Teil II: Darstellung (C) Wofür verschuldet sich der Staat? Gründe der Verschuldung und damit verbundene Probleme: Dieser Teil analysiert die Gründe für staatliche Verschuldung. Kassenkredite und Deckungskredite werden als Hauptgründe identifiziert und im Detail erläutert. Die fiskalische, konjunkturpolitische (Keynesianismus) und verteilungspolitische Begründung (Lastenverschiebungseffekt) der Verschuldung werden diskutiert, wobei die jeweiligen ökonomischen und politischen Implikationen beleuchtet werden. Es werden die jeweiligen Vor- und Nachteile dieser Strategien und ihre Auswirkungen auf den Staatshaushalt und die Gesellschaft analysiert.
Teil II: Darstellung (D) Entwicklungen und Grenzen der Verschuldung: Dieser Abschnitt befasst sich mit der Entwicklung der öffentlichen Verschuldung in Deutschland, sowohl insgesamt als auch strukturell. Er analysiert die rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. im Kontext des europäischen Rechtsrahmens) und die ökonomischen Grenzen der Verschuldung, unter Berücksichtigung von deren Auswirkungen auf die Finanzmärkte und die wirtschaftliche Stabilität. Die Grenzen werden sowohl aus rechtlicher als auch aus ökonomischer Perspektive betrachtet.
Schlüsselwörter
Staatsverschuldung, Bundesrepublik Deutschland, Föderalismus, Konvergenzkriterien, Maastricht-Vertrag, Kassenkredite, Deckungskredite, Fiskalpolitik, Konjunkturpolitik, Verteilungspolitik, Schuldenarten, Gläubigerkreis, Rechtliche Grenzen, Ökonomische Grenzen, Bundeshaushalt, Netto-Kreditaufnahme.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Staatsverschuldung in der Bundesrepublik Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Formen, Entwicklungen und Probleme der staatlichen Verschuldung in der Bundesrepublik Deutschland. Sie analysiert die deutsche Situation im Kontext der föderalen Struktur und der europäischen Einbindung.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt die Definition von „Staat“ und „Staatsverschuldung“, verschiedene Formen der Verschuldung (zeitlicher, lokaler und struktureller Aspekt), die Gründe für staatliche Verschuldung (Kassenkredite, Deckungskredite und deren fiskalische, konjunktur- und verteilungspolitische Begründungen), die Entwicklung der öffentlichen Verschuldung in Deutschland und die rechtlichen und ökonomischen Grenzen der staatlichen Verschuldung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Teil I (Einleitung), Teil II (Darstellung) und Teil III (Literaturverzeichnis). Teil II ist weiter unterteilt in Abschnitte zu Definitionen, Formen der Verschuldung, Gründen der Verschuldung und deren Problemen sowie Entwicklungen und Grenzen der Verschuldung.
Welche Definitionen von „Staat“ und „Staatsverschuldung“ werden verwendet?
Der „Staat“ wird im deutschen Kontext definiert, unter Berücksichtigung der föderalen Ebenen (Bund, Länder, Gemeinden) und weiterer Institutionen. „Staatsverschuldung“ umfasst Schuldenstand, Neuverschuldung und (Netto-) Kreditaufnahme, wobei die unterschiedlichen Akteure und ihre Verschuldungsmöglichkeiten systematisch dargestellt werden.
Welche Formen der Staatsverschuldung werden unterschieden?
Die Arbeit unterscheidet verschiedene Formen der Staatsverschuldung nach zeitlichen, lokalen und strukturellen Aspekten. Zeitlich wird die Dauer der Verschuldung betrachtet, lokal der Gläubigerkreis und strukturell die Arten von Staatsanleihen (Direktausleihungen, Obligationen, Schatzanweisungen, Bundesschatzbriefe und Bundesanleihen).
Welche Gründe für staatliche Verschuldung werden analysiert?
Als Hauptgründe werden Kassenkredite und Deckungskredite identifiziert. Die Arbeit diskutiert deren fiskalische, konjunkturpolitische (Keynesianismus) und verteilungspolitische Begründungen (Lastenverschiebungseffekt) sowie deren ökonomische und politische Implikationen und Auswirkungen auf den Staatshaushalt und die Gesellschaft.
Wie werden die Entwicklungen und Grenzen der Staatsverschuldung behandelt?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung der öffentlichen Verschuldung in Deutschland und betrachtet die rechtlichen Rahmenbedingungen (z.B. im Kontext des europäischen Rechtsrahmens) und die ökonomischen Grenzen der Verschuldung, unter Berücksichtigung der Auswirkungen auf Finanzmärkte und wirtschaftliche Stabilität.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind Staatsverschuldung, Bundesrepublik Deutschland, Föderalismus, Konvergenzkriterien, Maastricht-Vertrag, Kassenkredite, Deckungskredite, Fiskalpolitik, Konjunkturpolitik, Verteilungspolitik, Schuldenarten, Gläubigerkreis, Rechtliche Grenzen, Ökonomische Grenzen, Bundeshaushalt und Netto-Kreditaufnahme.
Welche Bedeutung hat der Maastricht-Vertrag im Kontext dieser Arbeit?
Der Maastricht-Vertrag und die Konvergenzkriterien spielen eine wichtige Rolle, da sie die zunehmende Bedeutung der Staatsverschuldung im öffentlichen Bewusstsein hervorgehoben haben und den Rahmen für die rechtlichen und ökonomischen Grenzen der Verschuldung setzen.
- Quote paper
- Simon Emmerling (Author), 2004, Staatsverschuldung - Formen, Entwicklungen und Probleme, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60741