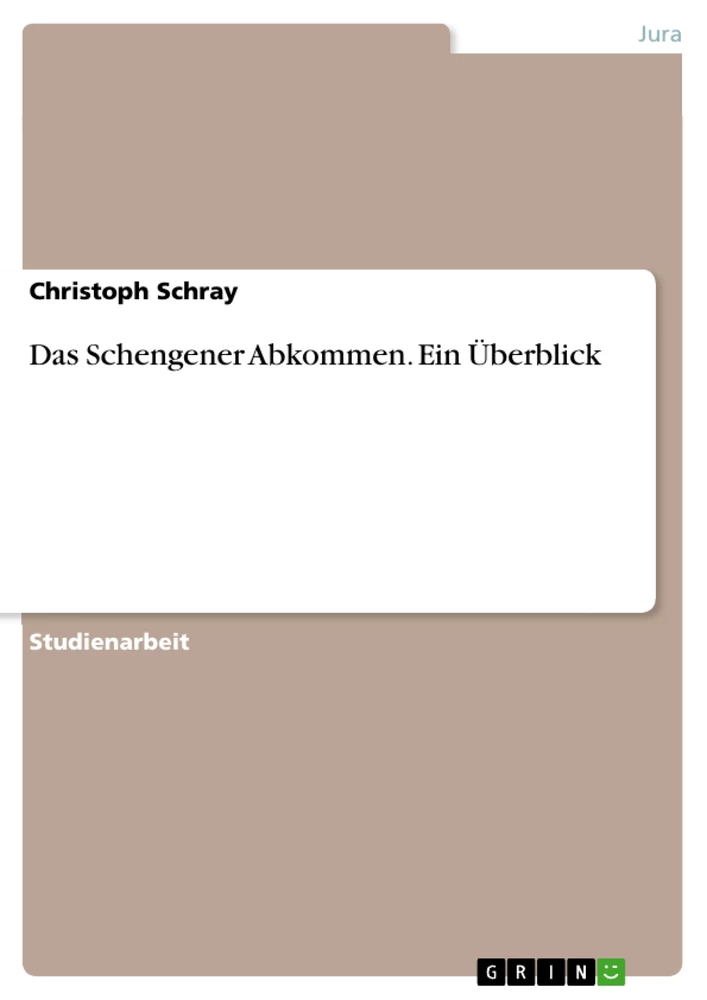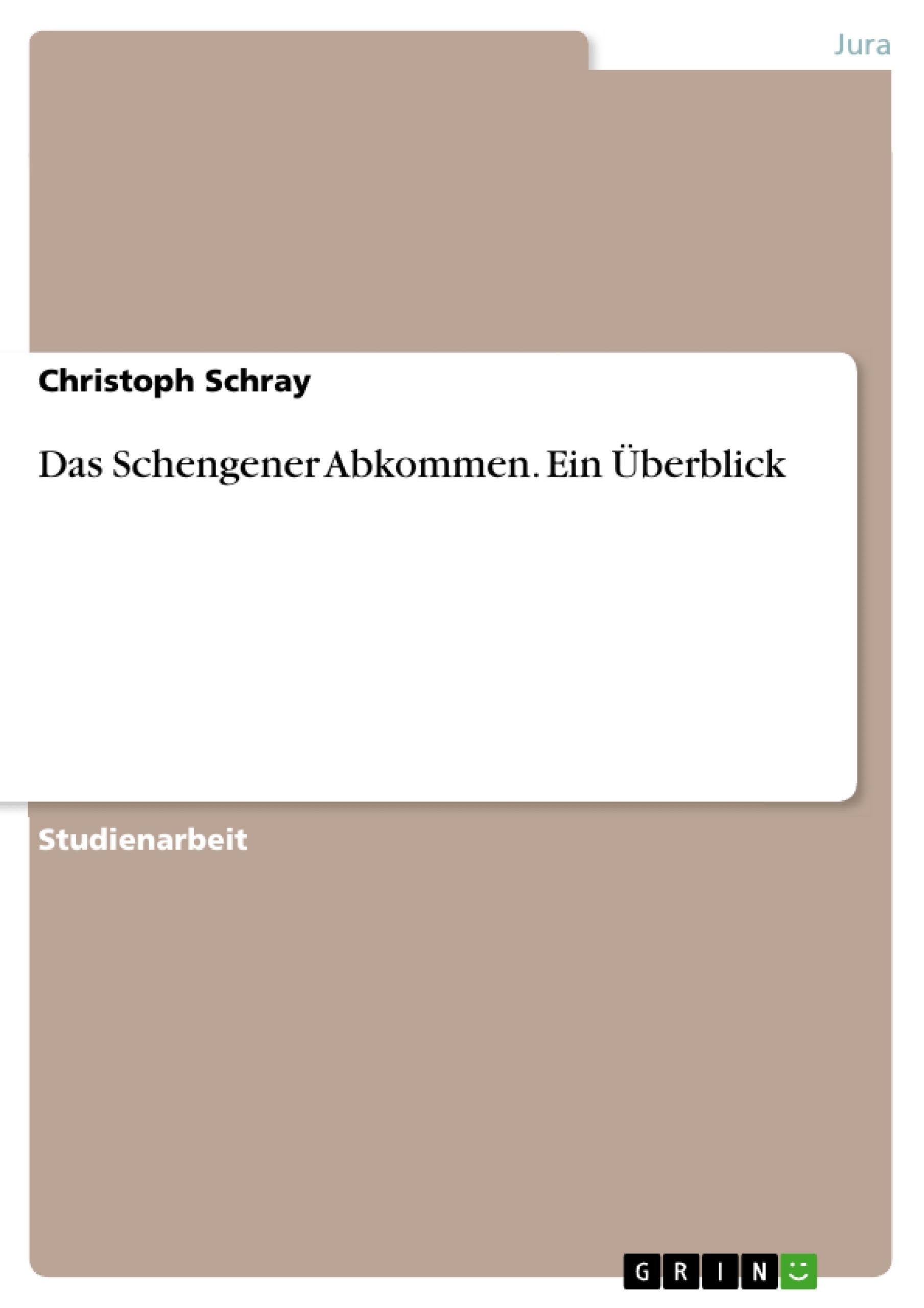Im Rahmen dieser Arbeit soll das gültige Recht rund um das Schengener Abkommen
und die darauf aufbauenden Verträge und Verordnungen deskriptiv dargestellt und kritisch beleuchtet werden. Es wird auf die einzelnen Regelungsgebiete, ihre rechtliche Verankerung und kritische Stimmen zur Schengener Idee bzw. ihrer Ausführung eingegangen und Stellung genommen. Wo notwendig werden auch noch weitergehende Zusammenhänge im Rahmen der EU geschildert. Der Beitrittsprozess und die dadurch entstehenden Vor- und Nachteile werden zusätzlich am aktuellen Beispiel des Schengen-Beitritts der Schweiz erörtert.
Inhaltsverzeichnis
- Der Schengen-Besitzstand
- §1 Definition und Überblick
- I Schengen-Chronologie
- II Mitgliedsstaaten
- 1. Beitrittsprozess
- 2. Sonderstatus einzelner Mitgliedsländer
- §2 Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ)
- I Abschaffung der Binnengrenzkontrollen und freier Personenverkehr
- II Verstärkte Kontrollen an den Außengrenzen
- III Vereinheitlichung der Asylverfahren und gemeinsame Visa- und Aufenthaltspolitik
- 1. Asylverfahren
- 2. Visa-, Einwanderungs- und Aufenthaltspolitik
- IV Ausgleich zu dem Wegfall der Binnengrenzkontrollen
- 1. Schengener Informationssystem SIS
- 2. Schleierfahndung
- 3. Polizeiliche Nacheile
- 4. Weitere Maßnahmen zur polizeilichen und justiziellen Zusammenarbeit
- V Fortentwicklung und Überwachung der Durchführung des SDÜ
- §3 Amsterdamer Vertrag
- I Grundsätzliches
- II Schengener Protokoll zum Amsterdamer Vertrag
- §4 Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes in der EU
- §5 Die Schweiz und Schengen
- I Beitrittsprozess
- II Besonderheiten
- III Kritik an der Beteiligung der Schweiz
- 1. Sicherheit verlieren?
- 2. Arbeit verlieren?
- 3. Souveränität verlieren?
- IV Vor- und Nachteile für die Schweiz und Europa
- §6 Kritik
- I Asyl- und Einwanderungsrecht
- II Schleierfahndung
- III SIS II
- §7 Zusammenfassender Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht den Schengen-Besitzstand, seine Entwicklung und seine Auswirkungen, insbesondere auf die Schweiz. Ziel ist es, einen Überblick über die wichtigsten Aspekte des Abkommens zu geben und kritische Punkte zu beleuchten.
- Definition und Entwicklung des Schengen-Raums
- Abschaffung der Binnengrenzkontrollen und freier Personenverkehr
- Ausgleichsmaßnahmen zum Wegfall der Binnengrenzkontrollen (SIS, Schleierfahndung etc.)
- Der Amsterdamer Vertrag und seine Bedeutung für Schengen
- Die Beteiligung der Schweiz am Schengen-Raum und damit verbundene Herausforderungen
Zusammenfassung der Kapitel
Der Schengen-Besitzstand: Dieses Kapitel liefert eine einführende Definition und einen Überblick über den Schengen-Raum, seine Chronologie und die beteiligten Mitgliedsstaaten, einschließlich des Beitrittsprozesses und des Sonderstatus einzelner Länder. Es bildet die Grundlage für das Verständnis der nachfolgenden Kapitel.
§2 Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ): Das Kapitel beschreibt das Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) umfassend. Es analysiert die Abschaffung der Binnengrenzkontrollen und den damit verbundenen freien Personenverkehr, die verstärkten Kontrollen an den Außengrenzen und die Vereinheitlichung der Asylverfahren und der Visapolitik. Besondere Aufmerksamkeit wird den Ausgleichsmaßnahmen gewidmet, darunter das Schengener Informationssystem (SIS), die Schleierfahndung und die polizeiliche Zusammenarbeit. Die Bedeutung der Fortentwicklung und Überwachung des SDÜ wird ebenfalls hervorgehoben, um die Funktionsfähigkeit des Systems zu gewährleisten.
§3 Amsterdamer Vertrag: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Amsterdamer Vertrag und dem Schengener Protokoll. Es erläutert die grundsätzlichen Bestimmungen und zeigt die Integration des Schengen-Besitzstandes in das Rechtsgefüge der Europäischen Union auf, wodurch die rechtliche Grundlage des Systems gefestigt und weiterentwickelt wurde.
§4 Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes in der EU: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes innerhalb der Europäischen Union. Es analysiert die Anpassungen und Erweiterungen des Abkommens im Laufe der Zeit und die damit verbundenen Herausforderungen und Lösungsansätze.
§5 Die Schweiz und Schengen: Dieses Kapitel behandelt den Beitritt der Schweiz zum Schengen-Raum, detailliert den Prozess und die Besonderheiten der Schweizer Beteiligung. Es analysiert die Kritikpunkte an der Schweizer Beteiligung, die Bedenken hinsichtlich Sicherheit, Arbeitsplätze und Souveränität, und bewertet die Vor- und Nachteile für die Schweiz und Europa. Die Diskussion verdeutlicht die Komplexität der Integration eines Nicht-EU-Staates in den Schengen-Raum.
§6 Kritik: Dieses Kapitel beleuchtet kritische Aspekte des Schengen-Systems. Es diskutiert die Kritikpunkte im Zusammenhang mit Asyl- und Einwanderungsrecht, der Schleierfahndung und dem SIS II. Die Analyse der Kritikpunkte dient der kritischen Auseinandersetzung mit dem Schengen-Raum und seinen möglichen Schwachstellen.
Schlüsselwörter
Schengen-Raum, freier Personenverkehr, Binnengrenzkontrollen, Außengrenzkontrollen, Asylverfahren, Visapolitik, Schengener Informationssystem (SIS), Schleierfahndung, polizeiliche Zusammenarbeit, Amsterdamer Vertrag, Schweizer Beteiligung, Kritik, Einwanderung, Sicherheit, Souveränität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Der Schengen-Raum und die Schweiz
Was ist der Inhalt dieser Seminararbeit?
Diese Seminararbeit bietet einen umfassenden Überblick über den Schengen-Raum, seine Entwicklung, seine Auswirkungen und insbesondere seine Bedeutung für die Schweiz. Sie beinhaltet eine Definition des Schengen-Raums, eine Erläuterung des Schengener Durchführungsübereinkommens (SDÜ), die Rolle des Amsterdamer Vertrages, die Weiterentwicklung des Schengen-Besitzstandes in der EU, den Beitritt der Schweiz und eine kritische Auseinandersetzung mit dem System.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit deckt folgende Themen ab: Definition und Entwicklung des Schengen-Raums, Abschaffung der Binnengrenzkontrollen und freier Personenverkehr, Ausgleichsmaßnahmen wie SIS und Schleierfahndung, der Amsterdamer Vertrag, die Schweizer Beteiligung am Schengen-Raum mit ihren Herausforderungen, Kritikpunkte am Schengen-System bezüglich Asyl- und Einwanderungsrecht sowie Sicherheitsaspekten.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in Kapitel unterteilt, beginnend mit einer Einleitung, die den Schengen-Besitzstand definiert und einen Überblick bietet. Es folgen Kapitel zum SDÜ, dem Amsterdamer Vertrag, der Weiterentwicklung innerhalb der EU, der Schweizer Beteiligung und abschließend einer kritischen Auseinandersetzung mit dem System. Jedes Kapitel beinhaltet eine Zusammenfassung.
Was ist das Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ)?
Das SDÜ ist das Kernstück des Schengen-Systems. Es regelt die Abschaffung der Binnengrenzkontrollen, die Verstärkung der Außengrenzkontrollen, die Vereinheitlichung der Asylverfahren und der Visapolitik sowie Ausgleichsmaßnahmen wie das Schengener Informationssystem (SIS) und die Schleierfahndung.
Welche Rolle spielt der Amsterdamer Vertrag?
Der Amsterdamer Vertrag integrierte den Schengen-Besitzstand in das Rechtsgefüge der Europäischen Union, wodurch die rechtliche Grundlage des Schengen-Systems gefestigt und weiterentwickelt wurde.
Wie ist die Schweiz in den Schengen-Raum eingebunden?
Die Schweiz ist zwar kein EU-Mitglied, beteiligt sich aber am Schengen-Raum. Die Arbeit beschreibt den Beitrittsprozess, die Besonderheiten der Schweizer Beteiligung und die damit verbundenen Herausforderungen und Kritikpunkte, einschließlich Bedenken hinsichtlich Sicherheit, Arbeitsplätzen und Souveränität.
Welche Kritikpunkte werden an Schengen geäußert?
Die Arbeit beleuchtet kritische Aspekte des Schengen-Systems, insbesondere im Hinblick auf Asyl- und Einwanderungsrecht, die Schleierfahndung und das Schengener Informationssystem (SIS II).
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Schengen-Raum, freier Personenverkehr, Binnengrenzkontrollen, Außengrenzkontrollen, Asylverfahren, Visapolitik, Schengener Informationssystem (SIS), Schleierfahndung, polizeiliche Zusammenarbeit, Amsterdamer Vertrag, Schweizer Beteiligung, Kritik, Einwanderung, Sicherheit, Souveränität.
Für wen ist diese Seminararbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für den Schengen-Raum, die europäische Integration und die Herausforderungen der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit interessieren, insbesondere im Kontext der Schweizer Beteiligung.
- Arbeit zitieren
- Christoph Schray (Autor:in), 2006, Das Schengener Abkommen. Ein Überblick, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60654