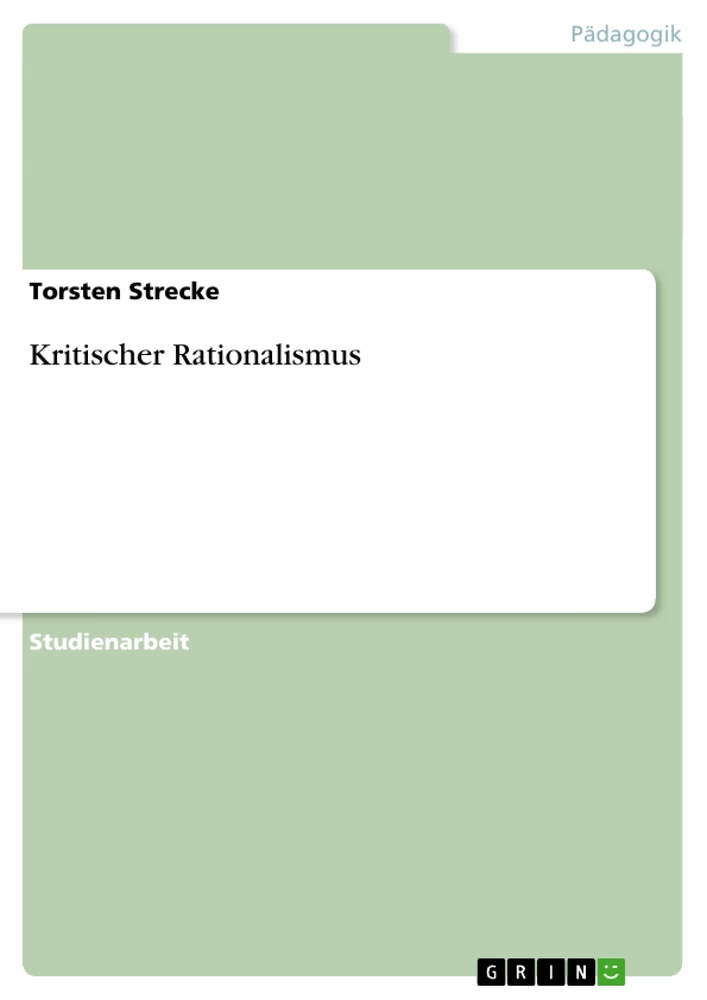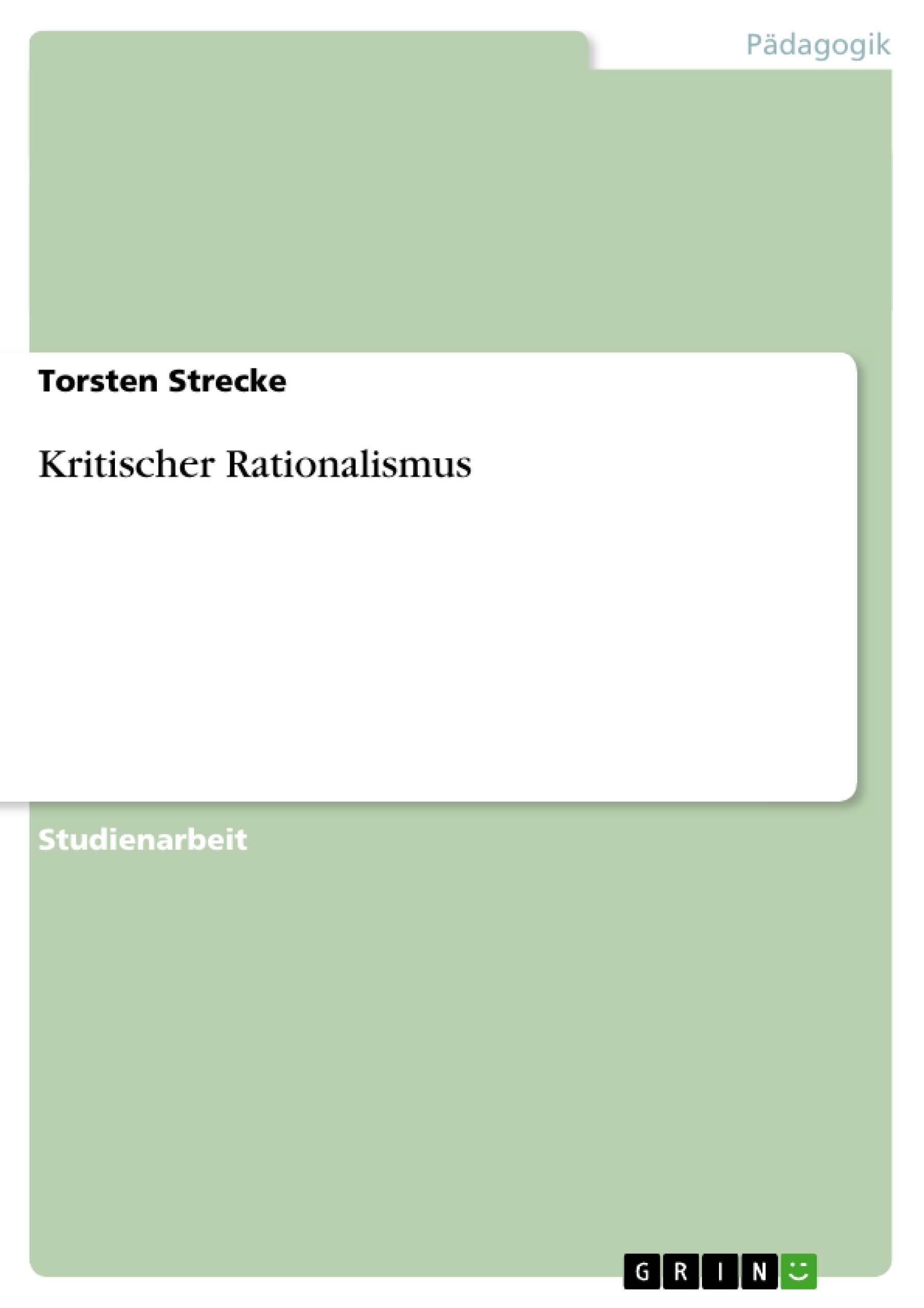Das Seminarthema lautet „Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Berufspädagogik“. Hierin werden die verschiedenen wissenstheoretischen Ansichten genauer unter die Lupe genommen. Das in der Berufspädagogik agierende Personal muss für die Wissensvermittlung die verschiedenen Ansätze kennen. Einer dieser Ansätze ist der Kritische Rationalismus nach Popper/ Brezinka. In ihren Aussagen betonen sie die Bedeutung der Theorieprüfung für die Wissenschaft und Praxis. Dies werde ich behandeln und außerdem dem kontrastierenden Verfahren der Theoriebildung gegenüberstellen. Wissenschaftliche Forschung im Bereich der empirischen Erziehungswissenschaft hat sich erst relativ spät im Vergleich zu anderen geistigen Wissenschaftsdisziplinen entwickelt. Als Zeitpunkt sind die ersten Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts zu ne nnen. Von besonderer Bedeutung war dabei die Grundannahme, dass die Erkenntnisbildung mithilfe von Beobachtung und Experimenten geschieht und daraus objektive Resultate geschlossen werden können. Ein weiterer Punkt war die Korrespondenz zu den naturwissenschaftlichen Forschungsmethoden. Dabei ergeben sich einige Fragen: Ist dieser Ansatz überhaupt haltbar? Beginnt die Erkenntnisbildung nicht schon bereits bei der Begriffswahl, die das angeblich objektive Erscheinungsbild verzerren kann? Kann man die Methode der Induktion oder Deduktion für die wissenschaftliche Forschung anwenden?
Ich möchte mich im Folgenden mit den theoretischen Ausprägungen auseinandersetzen, sie vorstellen und in einem weiteren Punkt die praktische Umsetzung in der verhaltensorientierten Erziehungswissenschaft dem Leser näher bringen.
Inhaltsverzeichnis
1. Einbettung in das Seminarthema
2. Zentrale Aussagen
2.1 Die Entstehung des Kritischen Rationalismus
2.2 Die Theoretiker und ihre Ideen
2.2.1 Karl Raimund Popper (1902 - 1994)
2.2.2 Hans Albert (geb. 1921)
2.2.3 Wolfgang Brezinka (geb. 1928)
2.3 Der Positivismusstreit
3. Anwendungen in der Praxis
3.1 Theoretische Ergänzungen
3.2 Vorgehen bei wissenschaftlichen Experimenten
3.2.1 Bildung des Hypothesenpaars
3.2.2 Operationalisierung der Variablen
3.3.3 Quantifizierung
3.3.4 Festlegung von Population und Stichprobe
3.3.5 Festlegung der Untersuchungsform
3.3.6 Pretest
3.3.7 Datenerhebung
3.3.8 Datenauswertung
3.3 Praktische Umsetzungen
3.3.1 Pädagogische Verhaltensmodifikation
3.3.2 Verhaltentraining
4. Konsequenzen für die Berufsbildung/ Eigene Stellungnahme
5. Anhang
5.1 Das Forschungsexperiment
6. Literatur
1. Einbettung in das Seminarthema
Das Seminarthema lautet „Wissenschaftstheoretische Grundlagen der Berufspädago- gik“. Hierin werden die verschiedenen wissenstheoretischen Ansichten genauer unter die Lupe genommen. Das in der Berufspädagogik agierende Personal muss für die Wissensvermittlung die verschiedenen Ansätze kennen. Einer dieser Ansätze ist der Kritische Rationalismus nach Popper/ Brezinka. In ihren Aussagen betonen sie die Bedeutung der Theorieprüfung für die Wissenschaft und Praxis. Dies werde ich be- handeln und außerdem dem kontrastierenden Verfahren der Theoriebildung gege n- überstellen.
2. Zentrale Aussagen
2.1 Die Entstehung des Kritischen Rationalismus
Wissenschaftliche Forschung im Bereich der empirischen Erziehungswissenschaft hat sich erst relativ spät im Vergleich zu anderen geistigen Wissenschaftsdisziplinen entwickelt. Als Zeitpunkt sind die ersten Jahrzehnte des letzten Jahrhunderts zu ne n- nen. Von besonderer Bedeutung war dabei die Grundannahme, dass die Erkenntnisbildung mithilfe von Beobachtung und Experimenten geschieht und daraus objektive Resultate geschlossen werden können. Ein weiterer Punkt war die Korrespondenz zu den naturwissenschaftlichen Forschungsmethoden.1
Dabei ergeben sich einige Fragen: Ist dieser Ansatz überhaupt haltbar? Beginnt die Erkenntnisbildung nicht schon bereits bei der Begriffswahl, die das angeblich objektive Erscheinungsbild verzerren kann? Kann man die Methode der Induktion oder Deduktion2für die wissenschaftliche Forschung anwenden?
Ich möchte mich im Folgenden mit den theoretischen Ausprägungen auseinandersetzen, sie vorstellen und in einem weiteren Punkt die praktische Umsetzung in der verhaltensorientierten Erziehungswissenschaft dem Leser näher bringen.
2.2 Die Theoretiker und ihre Ideen
2.2.1 Karl Raimund Popper (1902 - 1994)
Der ausgebildete Mathematik- und Physiklehrer und spätere Professor für Logik und Wissenschaftsmethodologie in London kann als Begründer des Kritischen Rationa- lismus angesehen werden. In seinem bedeutendsten Werk „Logik der Forschung“ befasst er sich mit dem „I nduktionsproblem“. Für die Erziehungswissenschaft hält er es für instabil, aus Einzelbeobachtungen „hier so etwas wie ein Naturgesetz anzu- nehmen.“3Wissenschaftlicher Fortschritt verläuft für ihn nach der Falsifizierung. Eine allgemeine Theorie bleibt solange gültig und bewährt, bis sie falsifiziert wurde: ’Bekanntlich berechtigen uns noch so viele Beobachtungen von weißen Schwänen nicht zu dem Satz, dass alle Schwäne weiß sind’4. Es reicht eine einzige Sic htung eines schwarzen Schwanes aus, um den Grundsatz „Alle Schwäne sind weiß.“ zu widerlegen.
Dieses plastische Beispiel lässt sich generalisieren: Alle Erkenntnisse bleiben vorläu- fig; die Theorien, die „wahrheitsnäher“ sind, setzen sich durch und sicheres Wissen ist eine Illusion. Dadurch stellt Popper eine Forderung auf: „Wissenschaftler sollten versuchen, ihre Theorien zu widerlegen bzw. mit entscheidenden Experimenten […] Theorien auszusieben.“5Das Prüfungsverfahren ist nunmehr ein deduktives Vorge- hen. Die bisher anerkannte Formel wird zugrunde gelegt und daraus Hypothesen abge leitet, die mittels Forschungsmethoden überprüft werden. Fällt das Ergebnis im Sinne der Hypothese aus, ist der Ansatz verifiziert. Im gegenteiligen Fall ist der An- satz falsifiziert und die Formel verworfen: „In einer Art evolutionärem Turnier von Hypothesen werden brauchbare Hypothesen sich als überlebensfähig herausstellen; falsifizierte Hypothesen hingegen in den Fossilienfundus der Wissenschaftsgeschich- te eingehen.“6
Poppers Ideen beziehen sich auch auf ein Werkzeug der Wissenschaft, nämlich die Sprache und deren Semantik. Die Tatsachen beruhen auf Erkenntnis und werden in Basissätzen beschrieben; diese stellen für ihn nur ein vorläufiges Ergebnis dar. Das- selbe gilt für die objektive Wissenschaft, die nicht auf Felsengrund gebaut ist.7
Popper vereinheitlicht diese Methode zum Prüfverfahren nach dem „Kritischen Rati-
onalismus“.
In seinen Ausführungen wird die Affinität zu den Naturwissenschaften immer wieder deutlich. Denn eigentlich war sein Konzept der kritischen Prüfung für dieses Gebiet vorgesehen. Die Sozialwissenschaften meinte er damit jedoch auch, indem er es dar- auf übertrug.
2.2.2 Hans Albert (geb. 1921)
Der deutsche Philosoph und vormalige Schüler Poppers hat sich dem Konzept des Kritischen Rationalismus nach Popper angenommen und dieses im deutschen Sprachraum etabliert.
2.2.3 Wolfgang Brezinka (geb. 1928)
Auch der Pädagoge Brezinka rezipierte Popper und ebnete dem „Kritischen Rationa- lismus“ den Weg in die Praxis - insbesondere für die empirische Erziehungswissen- schaft. Er ist Vertreter eines empirisch-analytischen Wissenschaftskonzeptes. In sei- nen eigenen Werken sagt er u.a., dass Erkenntnisgewinn nur durch Verwendung der wissenschaftlichen Methode stattfindet. Darüber hinaus fordert er eine intersubjekti- ve Überprüfbarkeit von Erziehungswissenschaft, die dazu wertfrei sein muss.
2.3 Der Positivis musstreit
Anhand des Positivismusstreites möchte ich dem Leser die sich differenzierenden Meinungen über Wertfreiheit und Wertung in wissenschaftlichen Aussagen näher bringen.
Was der „Kritische Rationalismus“ bei Popper und Albert darstellt („Die Kölner Schule“), stellt dazu im Gegensatz die „Kritische Theorie“ bei Theodor Adorno, Max Horkheimer und Jürgen Habermas dar („Die Frankfurter Schule“). Für sie sind Wis- senschaftstheorien normativ, die Werturteile enthalten. Zugrunde liegen dabei Nor- men, die beschreiben, was getan werden soll. Die Auseinandersetzung wurde auf einer Fachtagung in Tübingen im Jahr 1961 ausgetragen und auch die nächsten Jahre weitergeführt.
Popper und Albert betonen die Objektivität von Wissenschaft und sprechen sich für die positive, deskriptive und somit wertfreie Theorie aus (Beschreibung der Welt und nicht, wie die Welt sein soll). Der einzige normative Aspekt in den Ausführungen Poppers bzw. Alberts liegt in der Voraussetzung, wie Wissenschaft vorzugehen hat: „Wissenschaft, […], setzt mit der Wertbasis selbstverständlich Wertentscheidungen voraus, aber darf selbst innerhalb der Wissenschaft keine Normen aufstellen.“8Ver- treter der quantitative n Sozialforschung (Analyse auf der Makroebene) berufen sich sodann auch auf Popper und Albert.
Adorno hingegen meint, dass dieser Ansatz sehr technokratisch belastet ist und der Mensch nicht mehr die Kontrolle über sich behält. Er spricht von „Verdinglichung“ und stellt die These auf, dass durch die Nicht-Reflektion Machtverhältnisse manifestieren - hierbei meint er hauptsächlich Ungerechtfertigte. Außerdem hält er die empirischen Forschungsmethoden für moralisch äußerst fragwürdig.
Die Legitimation wird nicht hinterfragt und damit ist die Forschungspraxis in jedem Fall normativ. Der qualitativen Sozialforschung (Analyse auf der Mikroebene) liegt dieser Ansatz zugrunde. Aus einer geringen Zahl von Objekten mit umfassenden Informationen lassen sich Theorien bilden. Das Vorgehen auf diesem Gebiet ist in- duktiv.
Der andere Weg ist nicht möglich, nämlich von einer großen Menge - über die eine allgemeingültige Theorie existiert - auf das Individuum zu schließen. Aus dem Positivismusstreit ging eine Unsicherheit in Bezug auf wissenschaftstheore- tische Überlegunge n hervor, sodass diese nicht weiter bearbeitet wurde. Stattdessen wurden vermehrt forschungsmethodische Fragen bearbeitet und die empirische Ana- lyse gestärkt.
3. Anwendungen in der Praxis
3.1 Theoretische Ergänzungen
Die Ausführungen Poppers und Alberts haben einen starken Einfluss auf empirische Forschungsmethoden ausgeübt. Die wertfreie Wissenschaft kann dazu beitragen, ’bei der Klärung von Handlungsalternativen mitzuwirken, Probleme der Realisierbarkeit und der Kompatibilität von Zielsetzungen zu lösen und darüber hinaus zur Grundlage für die Entwicklung sozialtechnologischer Systeme werden, die unter Berücksicht i- gung der in Betracht kommenden Ziele und Mittel zu konstruieren sind.’9
Dem Anwender der Theorie - also dem Praktiker - stehen Erklärungen (Informatio- nen über die Ursachen einer Situation), Prognosen (Information über die zu erwar- tenden Folgen einer Situation) und Technologien (Informationen über geeignete Mit-
tel zur Erreichung von Zielen) zur Verfügung, aus denen er wählen kann. Darauf
begründet sich sein praktisches Handeln. Folgendes Schema liegt zugrunde, das von K.G. Hempel und P. Oppenheim als H-O-Schema spezifiziert wurde:10
Abbildung in dieser Leseprobe nicht enthalten
Hierdurch informiert erstens die Erziehungswissenschaft und stellt darüber hinaus geeignete Mittel zur Erreichung bestimmter Ziele zur Verfügung.111213
3.2 Vorgehen bei wissenschaftlichen Experimenten
Empirische Sozialforschung auf Basis des Kritischen Rationalismus verläuft durch Beobachtung von Verhalten. Die Ergebnisse können möglicherweise dieselben sein, wie durch Alltagsbeobachtung erzielte Ergebnisse. Hier muss aber klar differenziert werden: „Wissenschaftliches Vorgehen bedeutet demgegenüber, dass die Überprü- fung in einem von jedermann nachvollziehbaren Prozess erfolgt.“14Damit gehen auch weitere Gütekriterien beim methodischen Vorgehen einher. Objektivität, Relia- bilität und Validität15sind für wissenschaftliche Forschungsmethoden unabdingbar.
[...]
1vgl. König/ Zedler 1998, S. 45
2Induktion und Deduktion: Das Induktionsprinzip basiert auf der Annahme, dass sich aus Beobachtungsaussagen Gesetze und Theorien ableiten lassen, d.h. also vom Einfachen auf das Allgemeine. Dem gegenüber steht die Annahme der Deduktion, d.h. aus Gesetzen und Theorien lassen sich Erklärungen und Vorhersagen (Hypothesen) formulieren.
3König/ Zedler 1998, S. 46
4Popper, K.R.: Logik der Forschung. Tübingen (10.Auflage) 1994, S.3 in König/ Zedler 1998, S.46
5http://de.wikipedia.org/wiki/Karl_Popper mit Stand vom 27.10.2005
6Diekmann 2004, S. 153
7vgl. Popper, K.R.: Logik der Forschung. Tübingen (10.Auflage) 1994, S. 75f in König/ Zedler 1998, S. 47
8König/ Zedler 1998, S. 49
9Albert , H.: Konstruktion und Kritik. Hamburg 1972, S. 61 in König/ Zedler 1998, S. 48
10vgl. König/ Zedler 1998, S. 50
11Beispiel zu gegebener Erklärung: Wenn das gegebene Explanandum etwa lautet: „In Gesellschaft X herrscht Ausländerfeindlichkeit“, so kann eine Randbedingung herausgefunden werden, dass in Ge- sellschaft X starke Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt besteht. Ein allgemeines Gesetz, dass sich erge- ben könnte, wäre: „Wenn Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt herrscht, dann entsteht Ausländerfeind- lichkeit.“
12Das Beispiel ist auch hier anwendbar: Wenn die generelle Aussage lautet, dass Konkurrenz auf dem Arbeitsmarkt Ausländerfeindlichkeit schüren kann und als Randbedingung von starker Konkurrenz in Gesellschaft X auszugehen ist, so wird die Prognose lauten: „In Gesellschaft X wird es in naher Zukunft zu Ausländerfeindlichkeit kommen.“
13Das Beispiel in diesem Fall kann so formuliert werden: Ziel ist, dass es in Gesellschaft X nicht zu Ausländerfeindlichkeit kommt. Die Randbedingung ist bekannt und lautet, dass auf dem Arbeitsmarkt in Gesellschaft X ein harter Konkurrenzdruck herrscht. Das allgemeine Gesetz, das daraus abgeleitet werden kann, ist das Folgende: „Damit es in Gesellschaft nicht zu Ausländerfeindlichkeit kommt, darf auf dem Arbeitsmarkt nicht ein so hoher Konkurrenzdruck herrschen.“ Dieser Satz ist dann eine tech- nologische Regel.
14König/ Zedler 1998, S. 57
15Objektivität zielt auf die Unabhängigkeit der Beobachter ab. Wenn Anwender A und B dasselbe Messergebnis erzielen, ist das Experiment objektiv. Reliabilität bedeutet, dass Messergebnisse in sich konsistent sind. Daher muss bei einer Reproduktion von Messungen das Ergebnis annähernd konstant sein. Die Validität gibt den Grad der Genauigkeit der tatsächlichen Messung an. Die Gewichtung der drei Gütekriterien sieht folgendermaßen aus - mit absteigender Bedeutung: Validität, Reliabilität, Objektivität. (vgl. Dieckmann 2004, S. 216ff)
- Citation du texte
- Torsten Strecke (Auteur), 2005, Kritischer Rationalismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60475