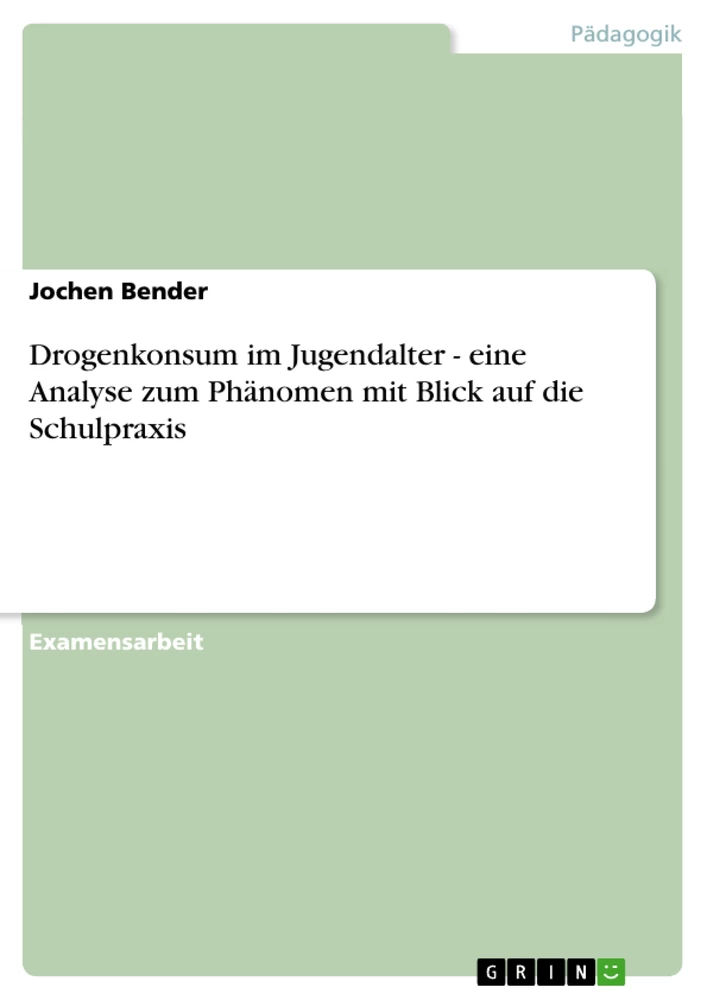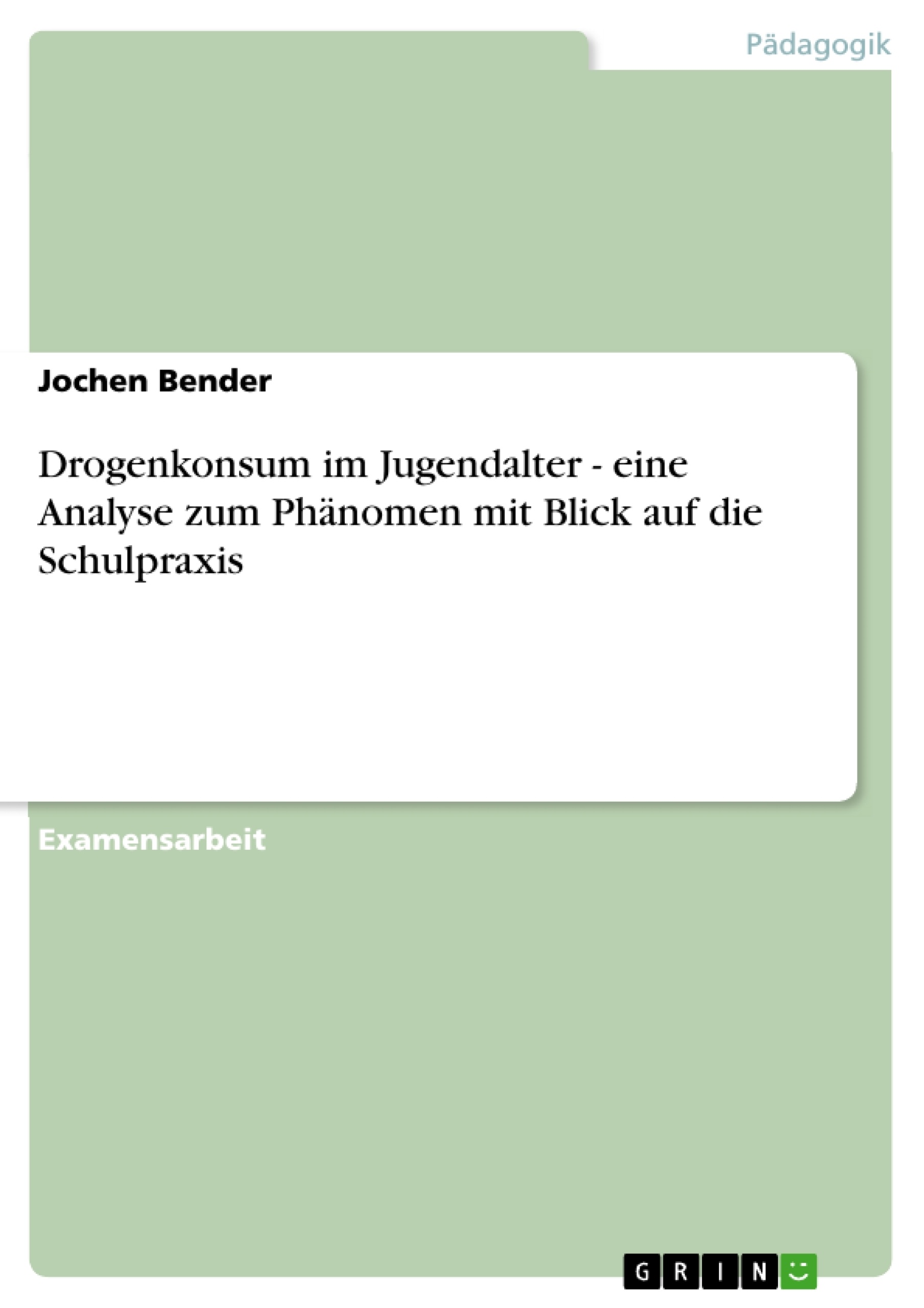Jugendliche haben beim Übergang ins Erwachsenenalter schwierige Entwicklungsaufgaben, wie die Ablösung von den Eltern, den Aufbau einer gegengeschlechtlichen Beziehung und die Findung einer eigenen Identität zu bewältigen. Diese Anforderungen gehen oft mit erhöhten Belastungen und mit der Suche der Jugendlichen nach Hilfsmitteln einher, um die Entwicklungsaufgaben und die daraus resultierenden Belastungen zu meistern. Drogenkonsum kann als solches Hilfsmittel angesehen werden, da er verschiedene Funktionen erfüllt, die mit der Bewältigung von Entwicklungsaufgaben zusammenhängen. So kann Drogengebrauch beispielsweise dem Zugang zu einer Gleichaltrigengruppe, der Vorwegnahme der Erwachsenenrolle und der damit verbundenen demonstrativen Abgrenzung vom Elternhaus dienen.
Einerseits kann Drogenkonsum also mit positiven Entwicklungszielen verbunden sein, muss aber, wegen seiner Folgen für die Gesundheit und die psychosoziale Entwicklung sowie wegen seiner Suchtgefahren, als inadäquate und somit zu vermeidende Art der Problembewältigung klassifiziert werden.
Programme zur primären Suchtprävention, die hauptsächlich an der Schule durchgeführt werden, versuchen dem Konsum und Missbrauch von Drogen zuvorzukommen, indem sie den Jugendlichen unter anderem alternative Handlungsmöglichkeiten für die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben und der sonstigen Alltagsanforderungen vermitteln.
Inhaltlich werden in vorliegender Arbeit zunächst zentrale Begriffe, die der Thematik zu Grunde liegen, geklärt. Im weiteren Verlauf richtet sich der Focus auf die Wirkungsweise von Drogen auf das zentrale Nervensystem sowie auf einzelne legale und illegale Drogen, deren Geschichte, Wirkungsweise, Folgen und Verbreitung. Daran anschließend wird in erster Linie der Frage nach den Faktoren, die Drogenkonsum begünstigen, bzw. davor schützen, nachgegangen. Unumgänglich, vor allem, um Aussagen über Ursache- Wirkungszusammenhänge machen zu können, ist die Frage nach verschiedenen theoretischen Ansätzen zur Erklärung von Substanzmissbrauch und deren heutige Relevanz. Der letzte Teil vorliegender Arbeit beschäftigt sich schließlich mit schulischer Suchtprävention, deren Grundsätze, Ziele und Geschichte. In diesem Zusammenhang werden zwei erfolgversprechende Ansätze schulischer Suchtprävention mit Blick auf die Suchtentstehungstheorien diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Terminologische Abgrenzungen
- 2.1 Drogen- Versuch einer definitorischen Klärung
- 2.2 Definition der Begriffe Drogengebrauch, Drogenmissbrauch, Abhängigkeit bzw. Sucht
- 2.3 Definition Jugendalter/ Adoleszenz
- 3. Drogenarten und ihre Wirkungsweise
- 3.1 Wirkungsweise auf das Zentrale Nervensystem
- 3.2 Klassifizierung psychotroper Substanzen
- 3.3 Harte und weiche Konsummuster
- 3.4 Legale Drogen: Alkohol und Tabak
- 3.5 Illegale Drogen: Cannabis, Kokain und Heroin
- 3.6 Verbreitung legaler und illegaler Drogen
- 4. Entwicklungsmechanismen und Risikofaktoren
- 4.1 Substanzmissbrauch als Problemverhalten
- 4.2 Genetische Disposition
- 4.3 Risiko- und Schutzfaktoren im personalen Bereich
- 4.4 Familiäre Risiko- und Schutzfaktoren
- 4.5 Risiko und Schutz durch Gleichaltrige
- 4.6 Risiko und Schutz auf schulischer Ebene
- 5. Theoretische Ansätze zur Erklärung von Substanzmissbrauch
- 5.1 Neurobiologische Erklärungsansätze
- 5.2 Psychologische Erklärungsansätze
- 5.3 Soziologische Erklärungsansätze
- 6. Prävention von Alkohol und Drogenmissbrauch
- 6.1 Geschichte schulischer Suchtprävention- von der Informationsvermittlung zur Kompetenzförderung
- 6.2 Ziele und Grundsätze schulischer Suchtprävention
- 6.3 Life- Skills Programme - ein vielversprechender Ansatz
- 6.4 Klasse2000 - Suchtprävention und Gesundheitsförderung in der Grundschule
- 7. Konsequenzen für die Schulpraxis und Perspektiven
- 8. Verallgemeinerung der Erkenntnisse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Drogenkonsum im Jugendalter und seine Relevanz für die Schulpraxis. Ziel ist es, die notwendigen Kompetenzen für die Durchführung schulischer Suchtpräventionsprogramme zu erarbeiten und Suchtprävention als Unterrichtsprinzip umzusetzen.
- Definition und Abgrenzung zentraler Begriffe im Zusammenhang mit Drogenkonsum.
- Analyse der Wirkungsweise verschiedener Drogen und ihrer Verbreitung unter Jugendlichen.
- Untersuchung von Entwicklungsmechanismen, Risikofaktoren und Schutzfaktoren im Hinblick auf Drogenmissbrauch.
- Diskussion verschiedener theoretischer Ansätze zur Erklärung von Substanzmissbrauch.
- Beschreibung und Bewertung von Ansätzen der schulischen Suchtprävention.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt den Kontext der Arbeit und den Zusammenhang zwischen den Herausforderungen des Jugendalters, der Suche nach Bewältigungsstrategien und dem Drogenkonsum. Es wird hervorgehoben, dass Drogenkonsum zwar scheinbar positive Funktionen erfüllen kann, aber letztlich eine inadäquate und zu vermeidende Form der Problembewältigung darstellt. Die Bedeutung von schulischer Suchtprävention wird betont.
2. Terminologische Abgrenzungen: Dieses Kapitel liefert präzise Definitionen der zentralen Begriffe wie „Droge“, „Drogenkonsum“, „Drogenmissbrauch“, „Abhängigkeit“ und „Sucht“, unter Bezugnahme auf verschiedene wissenschaftliche Ansätze und Definitionen in der Literatur. Es schafft eine einheitliche terminologische Grundlage für die gesamte Arbeit.
3. Drogenarten und ihre Wirkungsweise: Dieses Kapitel beschreibt die Wirkungsweise verschiedener legaler (Alkohol, Tabak) und illegaler (Cannabis, Kokain, Heroin) Drogen auf das zentrale Nervensystem. Es werden Klassifizierungssysteme und die Unterschiede zwischen „harten“ und „weichen“ Drogen erläutert, sowie Daten zur Verbreitung von legalen und illegalen Drogen unter Jugendlichen präsentiert.
4. Entwicklungsmechanismen und Risikofaktoren: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf den Faktoren, die Drogenkonsum begünstigen oder davor schützen. Es werden genetische Dispositionen, persönliche, familiäre und peer-group-bezogene Risikofaktoren sowie Schutzfaktoren auf individueller und schulischer Ebene detailliert analysiert. Der Substanzmissbrauch wird als Problemverhalten eingeordnet und im Kontext der Entwicklung des Jugendlichen betrachtet.
5. Theoretische Ansätze zur Erklärung von Substanzmissbrauch: Dieses Kapitel beleuchtet unterschiedliche theoretische Ansätze zur Erklärung von Substanzmissbrauch. Es werden neurobiologische, psychologische und soziologische Perspektiven vorgestellt und hinsichtlich ihrer Erklärungskraft und aktuellen Relevanz diskutiert. Die verschiedenen Ansätze werden miteinander in Beziehung gesetzt, um ein umfassenderes Verständnis zu ermöglichen.
6. Prävention von Alkohol und Drogenmissbrauch: Dieses Kapitel befasst sich mit der schulischen Suchtprävention. Es wird die historische Entwicklung von der Informationsvermittlung hin zur Kompetenzförderung dargestellt. Ziele und Grundsätze schulischer Suchtprävention werden definiert und anhand von Beispielen wie "Life-Skills-Programmen" und "Klasse2000" werden vielversprechende Ansätze diskutiert.
Schlüsselwörter
Drogenkonsum, Jugendalter, Suchtprävention, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, schulische Intervention, Alkohol, Tabak, illegale Drogen, neurobiologische Ansätze, psychologische Ansätze, soziologische Ansätze, Kompetenzförderung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Drogenkonsum im Jugendalter und seine Relevanz für die Schulpraxis
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Das Dokument befasst sich umfassend mit dem Thema Drogenkonsum im Jugendalter und dessen Bedeutung für die Schulpraxis. Es analysiert die Wirkungsweise verschiedener Drogen, untersucht Risikofaktoren und Schutzfaktoren, diskutiert verschiedene theoretische Erklärungsansätze und bewertet Ansätze der schulischen Suchtprävention.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument deckt ein breites Spektrum an Themen ab, darunter die terminologische Abgrenzung wichtiger Begriffe (Droge, Drogenmissbrauch, Sucht etc.), die Wirkungsweise verschiedener Drogen (inklusive legaler Drogen wie Alkohol und Tabak), Entwicklungsmechanismen und Risikofaktoren für Drogenkonsum (genetische, persönliche, familiäre, peer-group und schulische Faktoren), verschiedene theoretische Erklärungsansätze (neurobiologisch, psychologisch, soziologisch) und schließlich Ansätze der schulischen Suchtprävention, einschließlich einer historischen Betrachtung und der Vorstellung von Beispielprogrammen wie "Life-Skills-Programme" und "Klasse2000".
Welche Ziele verfolgt das Dokument?
Das Hauptziel des Dokuments ist es, die notwendigen Kompetenzen für die Durchführung effektiver schulischer Suchtpräventionsprogramme zu vermitteln und Suchtprävention als integrales Unterrichtsprinzip zu etablieren. Es soll ein tiefergehendes Verständnis des Drogenkonsums im Jugendalter ermöglichen und pädagogische Fachkräfte bei der Präventionsarbeit unterstützen.
Welche Arten von Drogen werden behandelt?
Das Dokument behandelt sowohl legale Drogen (Alkohol und Tabak) als auch illegale Drogen (Cannabis, Kokain und Heroin). Es wird deren Wirkungsweise auf das zentrale Nervensystem erläutert und die Unterschiede zwischen „harten“ und „weichen“ Drogen dargestellt.
Welche Risikofaktoren und Schutzfaktoren werden diskutiert?
Das Dokument analysiert eine Vielzahl von Risikofaktoren, einschließlich genetischer Dispositionen, persönlicher Faktoren (z.B. geringe Selbstwirksamkeit), familiärer Faktoren (z.B. problematische Familienstrukturen), Einflüsse durch Gleichaltrige (Peer-Pressure) und schulische Faktoren (z.B. mangelnde soziale Integration). Es werden aber auch Schutzfaktoren auf diesen Ebenen betrachtet, die einen präventiven Einfluss haben können.
Welche theoretischen Ansätze zur Erklärung von Substanzmissbrauch werden vorgestellt?
Das Dokument präsentiert und diskutiert neurobiologische, psychologische und soziologische Erklärungsansätze für Substanzmissbrauch. Die verschiedenen Perspektiven werden miteinander in Beziehung gesetzt, um ein umfassenderes Verständnis zu ermöglichen.
Wie wird schulische Suchtprävention im Dokument behandelt?
Die schulische Suchtprävention wird ausführlich behandelt, inklusive der historischen Entwicklung von der reinen Informationsvermittlung hin zur Kompetenzförderung. Es werden Ziele und Grundsätze schulischer Suchtprävention definiert und erfolgreiche Ansätze wie Life-Skills-Programme und das Programm "Klasse2000" als Beispiele vorgestellt und bewertet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren das Dokument?
Schlüsselwörter sind: Drogenkonsum, Jugendalter, Suchtprävention, Risikofaktoren, Schutzfaktoren, schulische Intervention, Alkohol, Tabak, illegale Drogen, neurobiologische Ansätze, psychologische Ansätze, soziologische Ansätze, Kompetenzförderung.
- Quote paper
- Jochen Bender (Author), 2004, Drogenkonsum im Jugendalter - eine Analyse zum Phänomen mit Blick auf die Schulpraxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60464