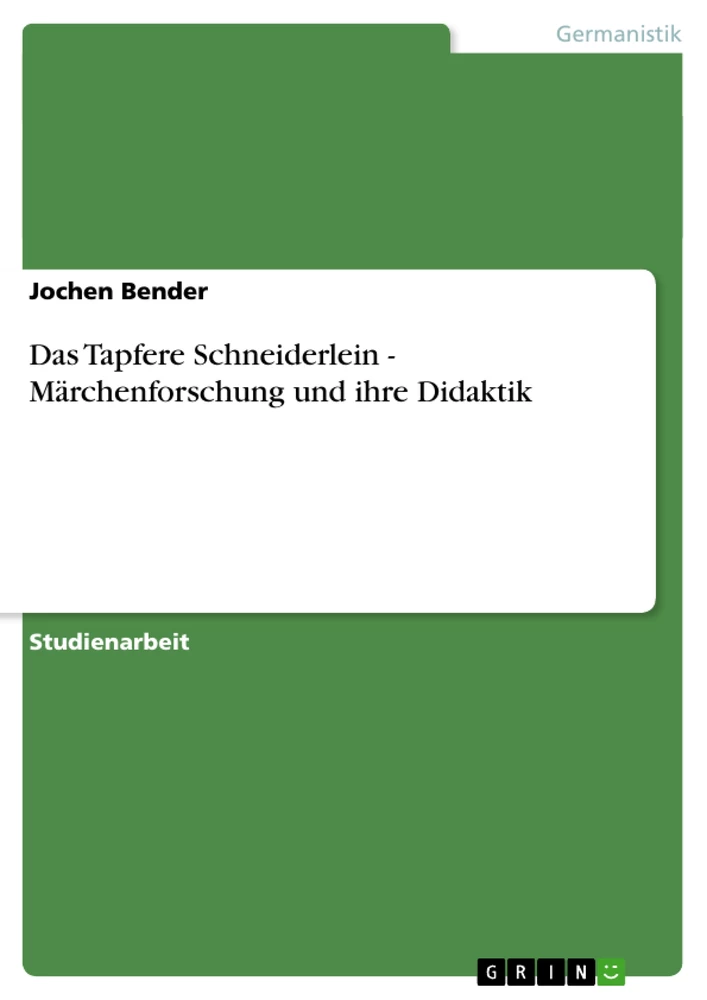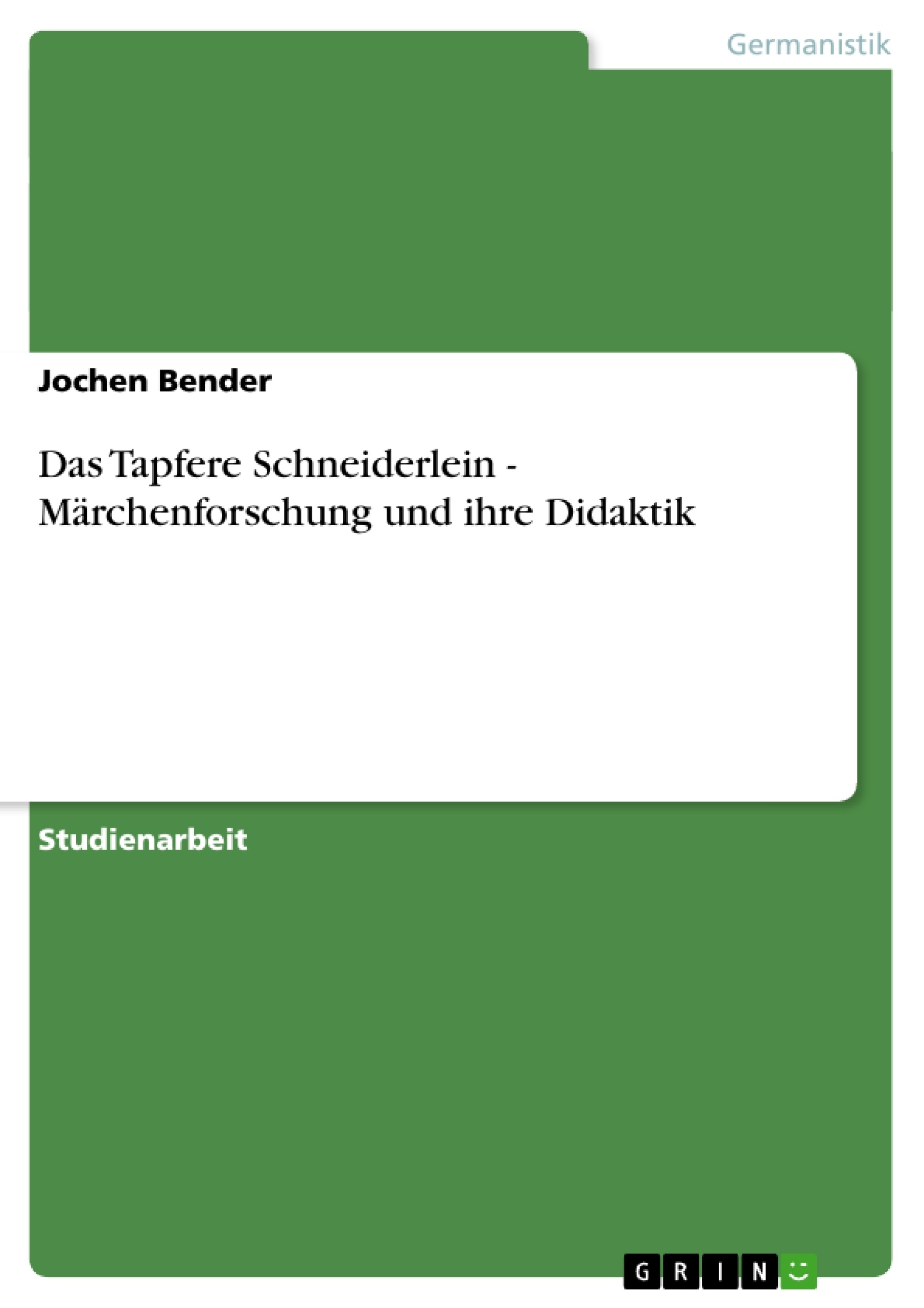Aarne und Thompson (1928, zit. nach Freund 1996, S. 182) erstellten ein Verzeichnis aller in den Kinder- und Hausmärchen vorkommender Märchentypen. Die erste Hauptgruppe bilden die Tiermärchen, in denen Tiere die Handlungsträger sind. Ihnen folgen in der zweiten Hauptgruppe die eigentlichen Märchen, aufgeteilt in Zauber- und Wundermärchen, in denen der übernatürliche Faktor eine entscheidende Rolle spielt, die legendenartigen Märchen, in denen Gott lohnt und bestraft, novellenartige Märchen um Liebe, Treue, Schicksalsmächte und Verbrechen und schließlich die Märchen vom dummen Teufel, womit Riesen gemeint sind. In diesen steht der Wettstreit zwischen Mensch und Unhold im Mittelpunkt. In der dritten und abschließenden Hauptgruppe sind die Schwankmärchen zusammengefasst, in denen der Einfallsreiche und listige die Oberhand behält. Diese Hauptgruppe soll im Folgenden näher charakterisiert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Schwankmärchen – kurze Charakterisierung der Zwischengattung
- 3. Überlieferung
- 4. Analyse und Interpretation
- 4.1 Verschiedene Ebenen der Interpretation
- 4.2 Literaturwissenschaftliche Interpretation
- 5. Didaktische Konzeptionen
- 6. Lehrplanbezug
- 7. Märchen in der Grundschule
- 8. Der kognitive Entwicklungsstand nach Piaget
- 9. Methodische Überlegungen
- 10. Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Analyse von Schwankmärchen, insbesondere im Kontext der Grimmschen Märchen. Ziel ist es, die Gattung der Schwankmärchen zu charakterisieren, ihre Überlieferung nachzuvollziehen und verschiedene Interpretationsansätze zu beleuchten. Die didaktische Relevanz und der Bezug zum Lehrplan werden ebenfalls thematisiert.
- Charakterisierung der Schwankmärchen als literarische Gattung
- Analyse der Überlieferungsgeschichte von Schwankmärchen
- Verschiedene Ebenen der Interpretation von Märchen (volkskundlich, psychologisch, literaturwissenschaftlich, soziologisch)
- Didaktische Konzeptionen und der Einsatz von Märchen im Unterricht
- Lehrplanbezug und methodische Überlegungen zum Einsatz von Märchen in der Grundschule
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die Debatte um die Definition von Volksmärchen und die Rolle des "Volkes" als Märchenschöpfer. Sie diskutiert die unterschiedlichen Ansichten von Gelehrten wie Jacob Grimm, Achim von Arnim, und Lüthi über die Entstehung und Natur von Märchen, wobei die Frage nach dem Verhältnis von Naturpoesie und Kunstpoesie im Zentrum steht. Kritisch wird der Mythos der direkten Übernahme der Märchen aus volkstümlicher Tradition durch die Brüder Grimm hinterfragt und die Quellen ihrer Arbeit aufgezeigt. Die Einleitung legt den Grundstein für die nachfolgende detaillierte Auseinandersetzung mit Schwankmärchen.
2. Schwankmärchen - kurze Charakterisierung der Zwischengattung: Dieses Kapitel charakterisiert Schwankmärchen als Zwischengattung zwischen Zaubermärchen und Schwank. Es beschreibt den Helden als schlau und mutig, der durch List und Klugheit, im Gegensatz zum Zaubermärchen, seine überlegenen Gegner besiegt. Der Glaube an das Wunder ist auf die Nebenfiguren beschränkt, während der Held seine betrügerischen Machenschaften bewusst einsetzt. Der Kapitel vergleicht und kontrastiert die Gattung mit anderen Märchenformen und diskutiert die Ansichten von Märchenforschern wie Solms und Lüthi zur Bedeutung des Humors und des Abbaus von Wunderglauben im Kontext dieser literarischen Form.
3. Überlieferung: Dieses Kapitel analysiert die Überlieferung des Schwankmärchens „Das tapfere Schneiderlein“ aus den Kinder- und Hausmärchen der Brüder Grimm. Es verfolgt die verschiedenen Fassungen des Märchens, von der ältesten Version aus Montanus' „Wegkürzer“ bis zu den mündlichen Überlieferungen, die die Grimms verwendeten. Es beleuchtet die Herkunft der verschiedenen Fassungen und zeigt auf, wie Varianten des Märchens in anderen Regionen und Kulturen existieren, wobei einige Versuche unternommen wurden, das Schwankmärchen an das Zaubermärchen anzugleichen. Der Abschnitt unterstreicht die vielschichtige Überlieferungsgeschichte der Märchen und deren Anpassung an verschiedene kulturelle Kontexte.
4. Analyse und Interpretation: Das Kapitel 4 skizziert verschiedene Ebenen der Märcheninterpretation, nämlich die volkskundliche, psychologische, literaturwissenschaftliche und soziologische Perspektive. Es erläutert kurz den jeweiligen Fokus und die Fragestellungen jeder Interpretationsmethode. Die volkskundliche Perspektive konzentriert sich auf den kulturellen Kontext und die gesellschaftliche Rolle der Märchen, die psychologische auf die seelischen Prozesse und Einflüsse auf Leser/Hörer, die literaturwissenschaftliche auf die literarischen Merkmale und die Entstehungsgeschichte und die soziologische auf die gesellschaftliche Funktion des Märchens. Dies legt den methodologischen Rahmen für eine umfassendere Analyse der behandelten Märchen fest.
Schlüsselwörter
Schwankmärchen, Grimmsche Märchen, Märcheninterpretation, Volkskunde, Psychologie, Literaturwissenschaft, Soziologie, Didaktik, Lehrplan, Grundschule, kognitive Entwicklung, Piaget, Überlieferung, Gattung, Märchentyp
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Analyse von Schwankmärchen"
Was ist der Inhalt dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Schwankmärchen, insbesondere im Kontext der Grimmschen Märchen. Sie charakterisiert die Gattung, verfolgt ihre Überlieferung nach, beleuchtet verschiedene Interpretationsansätze und thematisiert die didaktische Relevanz sowie den Bezug zum Lehrplan. Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, eine Charakterisierung der Schwankmärchen, eine Analyse der Überlieferung, verschiedene Interpretationsebenen, didaktische Konzeptionen, Lehrplanbezug, methodische Überlegungen zum Einsatz in der Grundschule und ein Literaturverzeichnis.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Charakterisierung der Schwankmärchen als literarische Gattung, die Analyse ihrer Überlieferungsgeschichte, verschiedene Interpretationsebenen (volkskundlich, psychologisch, literaturwissenschaftlich, soziologisch), didaktische Konzeptionen und den Einsatz von Märchen im Unterricht, sowie den Lehrplanbezug und methodische Überlegungen zum Einsatz in der Grundschule.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung: Diskussion um die Definition von Volksmärchen und die Rolle des "Volkes", unterschiedliche Ansichten von Gelehrten zur Entstehung von Märchen. 2. Schwankmärchen - kurze Charakterisierung der Zwischengattung: Charakterisierung der Schwankmärchen als Zwischengattung zwischen Zaubermärchen und Schwank. 3. Überlieferung: Analyse der Überlieferung des Schwankmärchens "Das tapfere Schneiderlein", verschiedene Fassungen und ihre Herkunft. 4. Analyse und Interpretation: Verschiedene Ebenen der Märcheninterpretation (volkskundlich, psychologisch, literaturwissenschaftlich, soziologisch). Weitere Kapitel befassen sich mit didaktischen Konzeptionen, Lehrplanbezug, Märchen in der Grundschule, dem kognitiven Entwicklungsstand nach Piaget und methodischen Überlegungen.
Welche Interpretationsansätze werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Ebenen der Märcheninterpretation: die volkskundliche Perspektive (kultureller Kontext, gesellschaftliche Rolle), die psychologische Perspektive (seelische Prozesse), die literaturwissenschaftliche Perspektive (literarische Merkmale, Entstehungsgeschichte) und die soziologische Perspektive (gesellschaftliche Funktion).
Welchen Bezug hat die Arbeit zum Lehrplan und zur Grundschule?
Die Arbeit thematisiert den Lehrplanbezug und methodische Überlegungen zum Einsatz von Märchen in der Grundschule, unter Berücksichtigung des kognitiven Entwicklungsstandes nach Piaget.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Schwankmärchen, Grimmsche Märchen, Märcheninterpretation, Volkskunde, Psychologie, Literaturwissenschaft, Soziologie, Didaktik, Lehrplan, Grundschule, kognitive Entwicklung, Piaget, Überlieferung, Gattung, Märchentyp.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke gedacht und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Art und Weise.
- Arbeit zitieren
- Jochen Bender (Autor:in), 2004, Das Tapfere Schneiderlein - Märchenforschung und ihre Didaktik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60454