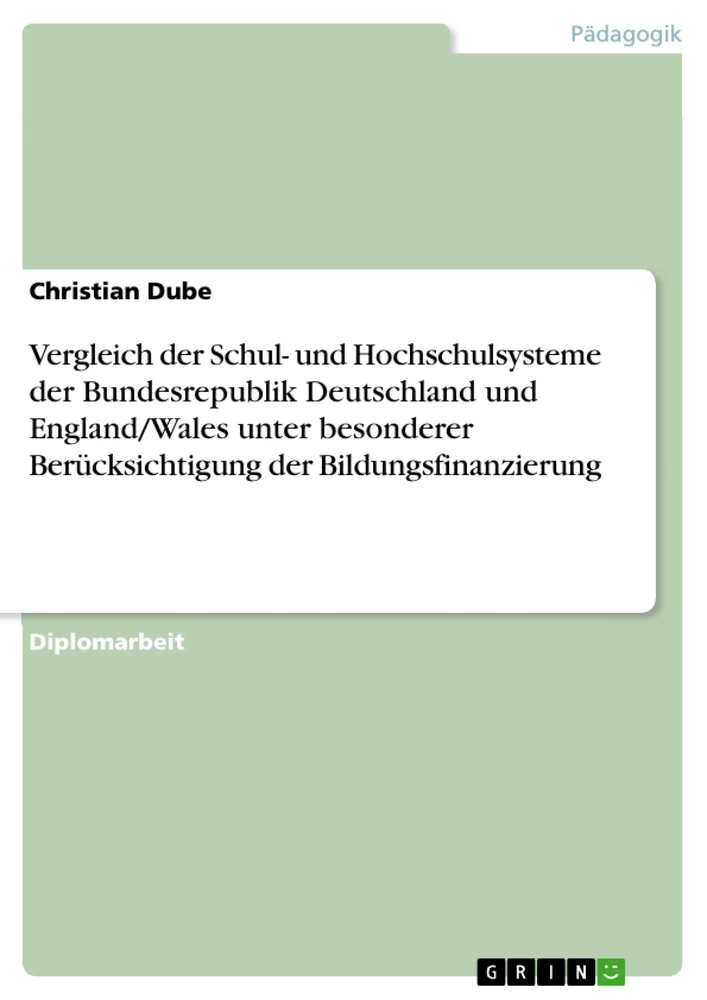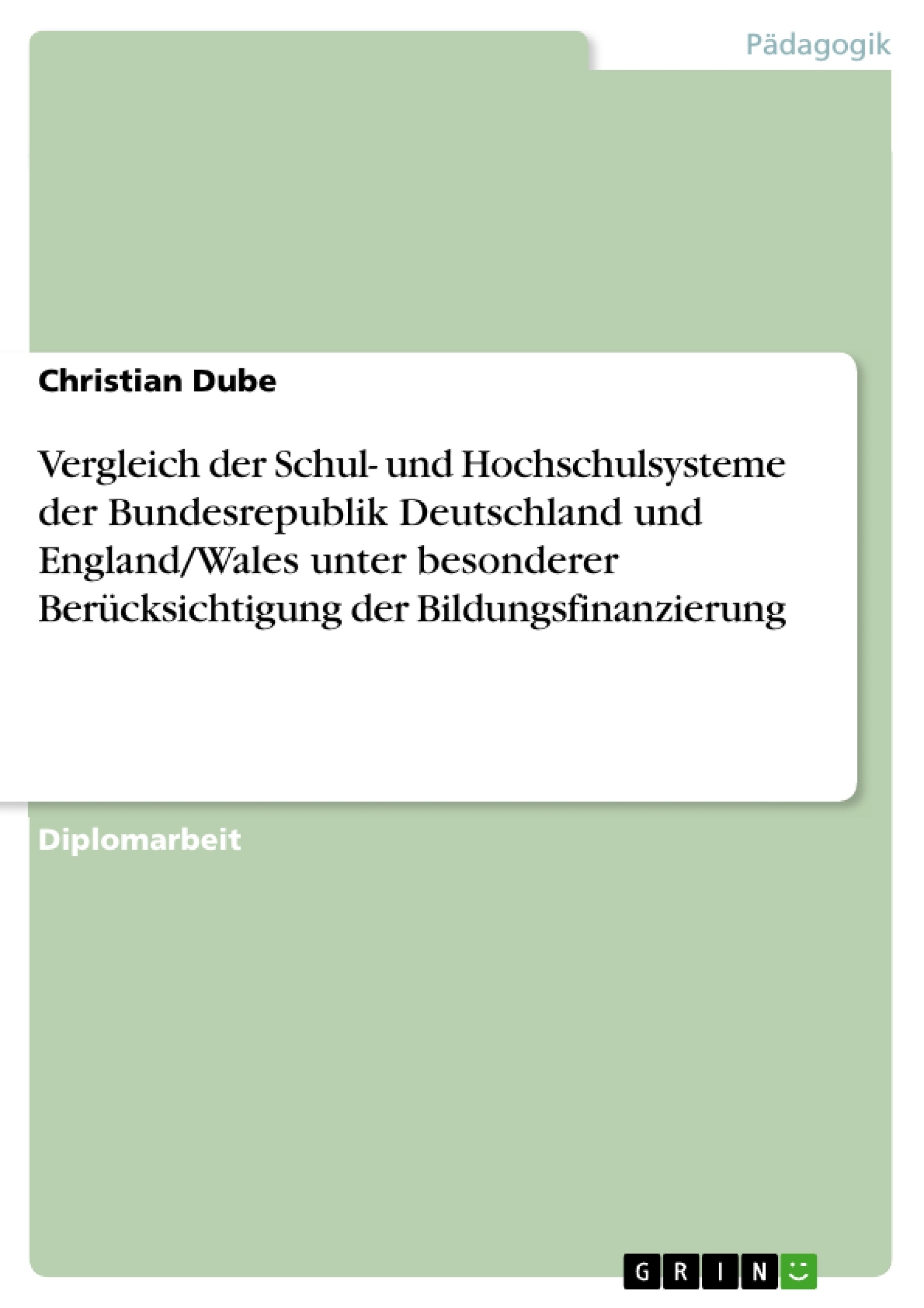Ebenso wie andere öffentliche Bereiche, ist auch das deutsche Bildungswesen von der zunehmenden Konsolidierung der öffentlichen Haushalte betroffen. Die wachsenden Anforderungen leiten sich aus den Diskussionen über das schlechte Abschneiden deutscher Schüler bei internationalen Schulleistungsuntersuchungen und der sich anschließenden Kritik an der Effizienz und Qualität des deutschen Bildungswesens ab. Zudem besteht weithin Einigkeit über die herausragende Bedeutng von Bildung und Ausbildung beim Umstieg von der rohstoffbasierten Produktions- in die Wissens- und Dienstleistungsgesellschaft. Klar ist auch, dass sich die Bildungsphase nicht mehr ausschlißelich auf die Jugendjahre beschränken kann, sondern vielmehr durch einen Prozess des lebenslangen Lernens und Fortbildens überlagert wird.
All dies erfordert Investitionen, die sowohl den öffentlichen als auch privaten Haushalten entstammen können. In beiden Bereichen wird jedoch seit langem über notorische Finanzknappheit geklagt, welche mittelfristig zunehmen wird. Es sind also Abwägungen und die Verlagerung von Präferenzen notwendig, um den gestiegenen Finanzierungsbedarf im Bildungswesen gerecht zu werden. Der Blick auf die internationale Bildungsberichterstattung offenbart für die Finanzierung des deutschen Bildungssystems vordergründig ein eher unterdurchschnittliches Niveau. Bei den Gesamtausgaben für Bildung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt rangiert Deutschland allenfalls im unteren Drittel. Liegen hier bereits Ursachen für das ebenfalls schlechte Abschneiden beim internationalen Vergleich der Schülerleistungen? Der empirische Nachweis steht bisher aus.
Um herauszufinden, ob das deutsche Bildungssystem mit den entsprechenden Ressourcen ausgestattet ist, um den zukünftigen Anforderungen zu genügen, bedarf es einer detaillierten Betrachtung der tatsächlichen Mittelverwendung. Im Zentrum dieser Arbeit stehen daher die Beschreibuzng grundlegender Elemente der Bildungsfinanzierung in Deutschland und Großbritannien sowie die Einordnung der Bildungsinvestitionen beider Länder in den internationalen Kontext. Die Analyse zweier vergleichbarer Industrienationen erschien dabei sinnvoller als die seperate Betrachtung Deutschlands, denn oftmals sind Unterschiede in der internationalen Bildungsberichterstattung auf generelle sozioökonomische und gesellschaftliche Differenzen zurückzuführen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Vorbemerkungen
- 1.1 Begriffsbestimmung: Bildung und Humankapitaltheorie
- 1.2 Revidierte ISCED-97 und OECD-Indikatoren
- 1.3 Der Ausgabenbegriff im Rahmen internationaler Vergleichsstudien
- 1.4 Methodisches Vorgehen
- 2 Die nationalen Schul- und Hochschulsysteme der Bundesrepublik Deutschland und Englands/Wales
- 2.1 Das Bildungswesen in der Bundesrepublik Deutschland
- 2.1.1 Rechtliche Grundlagen
- 2.1.2 Allgemein bildende Schulen
- 2.1.3 Der Tertiäre Bereich
- 2.1.4 Aktuelle Diskussionen und Entwicklungsperspektiven
- 2.2 Das Bildungswesen in England und Wales
- 2.2.1 Rechtliche Grundlagen
- 2.2.2 Allgemein bildende Schulen
- 2.2.3 Der Tertiäre Bereich
- 2.2.4 Aktuelle Diskussionen und Entwicklungsperspektiven
- 3 Bildungsfinanzierung und Ausgaben im Vergleich
- 3.1 Bildungsfinanzierung in Deutschland
- 3.2 Bildungsfinanzierung in England/Wales
- 3.3 Vergleich der Bildungsausgaben anhand ausgewählter OECD-Indikatoren
- 3.3.1 Bildungsausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt
- 3.3.2 Ausgaben für Bildungsleistungen je Schüler/Student
- 3.3.3 Anteile der öffentlichen und privaten Ausgaben für Bildungseinrichtungen
- 3.3.4 Die öffentlichen Gesamtausgaben für Bildung
- 4 Resümee und Perspektiven für das deutsche Bildungswesen
- 4.1 Die wichtigsten Ergebnisse des Vergleichs
- 4.2 Bildungspolitische Reformansätze
- 5 Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit vergleicht die Schul- und Hochschulsysteme Deutschlands und Englands/Wales, mit besonderem Fokus auf die Bildungsfinanzierung. Ziel ist es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Systeme aufzuzeigen und Schlussfolgerungen für das deutsche Bildungssystem zu ziehen.
- Vergleich der rechtlichen Grundlagen und Strukturen der Bildungssysteme
- Analyse der Ausgaben für Bildung in beiden Ländern
- Bewertung der Effizienz und Qualität der Bildungssysteme im Hinblick auf internationale Vergleichsstudien
- Identifizierung von Stärken und Schwächen beider Systeme
- Ableitung von Reformansätzen für das deutsche Bildungssystem
Zusammenfassung der Kapitel
1 Vorbemerkungen: Dieses Kapitel legt den Grundstein der Arbeit, indem es zunächst die Begriffe Bildung und Humankapitaltheorie definiert und die verwendeten OECD-Indikatoren und methodisches Vorgehen erläutert. Es wird die Problematik der zunehmenden Konsolidierungsnot der öffentlichen Haushalte im Kontext steigender Anforderungen an das deutsche Bildungswesen thematisiert und die Notwendigkeit internationaler Vergleichsstudien zur Bewertung der Effizienz und Qualität des deutschen Bildungssystems herausgestellt.
2 Die nationalen Schul- und Hochschulsysteme der Bundesrepublik Deutschland und Englands/Wales: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Bildungssysteme Deutschlands und Englands/Wales. Es werden die rechtlichen Grundlagen, die Struktur der allgemeinbildenden Schulen und des tertiären Bereichs sowie aktuelle Diskussionen und Entwicklungsperspektiven in beiden Ländern analysiert und verglichen. Der Fokus liegt auf den strukturellen Unterschieden und Gemeinsamkeiten der Systeme, um eine Grundlage für den späteren Vergleich der Bildungsfinanzierung zu schaffen.
3 Bildungsfinanzierung und Ausgaben im Vergleich: Dieser Abschnitt analysiert die Bildungsfinanzierung in Deutschland und England/Wales im Detail. Er vergleicht die Ausgaben für Bildung im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, die Ausgaben pro Schüler/Student und die Anteile öffentlicher und privater Ausgaben. Die Analyse stützt sich auf ausgewählte OECD-Indikatoren und beleuchtet die Unterschiede in der Finanzierung und deren mögliche Auswirkungen auf die Qualität und Effizienz der Bildungssysteme. Der Vergleich soll zeigen, wie die unterschiedlichen Finanzierungsmodelle zu den in Kapitel 2 beschriebenen Unterschieden in den Bildungssystemen führen können.
4 Resümee und Perspektiven für das deutsche Bildungswesen: (Diese Zusammenfassung wird ausgelassen, da sie den Schlussfolgerungen und Empfehlungen der Arbeit entspringt, die nicht im Preview enthalten sein sollen.)
Schlüsselwörter
Bildungssystem, Bildungsfinanzierung, Deutschland, England/Wales, OECD-Indikatoren, Schulsystem, Hochschulsystem, internationaler Vergleich, Bildungsausgaben, Humankapitaltheorie, Bildungspolitik, Reformansätze.
FAQ: Vergleich der Schul- und Hochschulsysteme Deutschlands und Englands/Wales
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit vergleicht die Schul- und Hochschulsysteme Deutschlands und Englands/Wales mit besonderem Fokus auf die Bildungsfinanzierung. Ziel ist es, Unterschiede und Gemeinsamkeiten beider Systeme aufzuzeigen und Schlussfolgerungen für das deutsche Bildungssystem zu ziehen.
Welche Aspekte der Bildungssysteme werden verglichen?
Der Vergleich umfasst die rechtlichen Grundlagen und Strukturen der Bildungssysteme, die Analyse der Bildungsausgaben in beiden Ländern, eine Bewertung der Effizienz und Qualität der Systeme anhand internationaler Vergleichsstudien, die Identifizierung von Stärken und Schwächen sowie die Ableitung von Reformansätzen für das deutsche Bildungssystem.
Welche Indikatoren werden zur Analyse der Bildungsfinanzierung verwendet?
Die Analyse der Bildungsfinanzierung stützt sich auf ausgewählte OECD-Indikatoren. Konkret werden der Vergleich der Bildungsausgaben im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt, die Ausgaben pro Schüler/Student und die Anteile öffentlicher und privater Ausgaben betrachtet.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Vorbemerkungen (Definitionen, Methodik), Beschreibung der nationalen Schul- und Hochschulsysteme Deutschlands und Englands/Wales, Vergleich der Bildungsfinanzierung anhand der OECD-Indikatoren, Resümee und Perspektiven für das deutsche Bildungswesen und eine Schlussbemerkung. Jedes Kapitel beinhaltet detaillierte Analysen und Vergleiche.
Welche Themen werden in den Vorbemerkungen behandelt?
Die Vorbemerkungen definieren die Begriffe Bildung und Humankapitaltheorie, erläutern die verwendeten OECD-Indikatoren und das methodische Vorgehen. Außerdem wird die Problematik der Konsolidierungsnot der öffentlichen Haushalte im Kontext steigender Anforderungen an das deutsche Bildungswesen und die Notwendigkeit internationaler Vergleichsstudien thematisiert.
Wie werden die nationalen Bildungssysteme beschrieben?
Kapitel 2 beschreibt detailliert die Bildungssysteme Deutschlands und Englands/Wales. Es werden die rechtlichen Grundlagen, die Struktur der allgemeinbildenden Schulen und des tertiären Bereichs sowie aktuelle Diskussionen und Entwicklungsperspektiven in beiden Ländern analysiert und verglichen. Der Fokus liegt auf den strukturellen Unterschieden und Gemeinsamkeiten.
Welche Ergebnisse liefert der Vergleich der Bildungsfinanzierung?
Der Vergleich der Bildungsfinanzierung in Kapitel 3 analysiert die Ausgaben im Verhältnis zum BIP, die Ausgaben pro Schüler/Student und die Anteile öffentlicher und privater Ausgaben. Die Analyse zeigt Unterschiede in der Finanzierung und deren mögliche Auswirkungen auf die Qualität und Effizienz der Bildungssysteme auf.
Welche Schlussfolgerungen und Empfehlungen werden gezogen?
Die Schlussfolgerungen und Empfehlungen (Kapitel 4) sind in diesem Preview nicht enthalten, da sie die Kernaussagen der vollständigen Arbeit darstellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Bildungssystem, Bildungsfinanzierung, Deutschland, England/Wales, OECD-Indikatoren, Schulsystem, Hochschulsystem, internationaler Vergleich, Bildungsausgaben, Humankapitaltheorie, Bildungspolitik, Reformansätze.
- Quote paper
- Christian Dube (Author), 2006, Vergleich der Schul- und Hochschulsysteme der Bundesrepublik Deutschland und England/Wales unter besonderer Berücksichtigung der Bildungsfinanzierung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60281