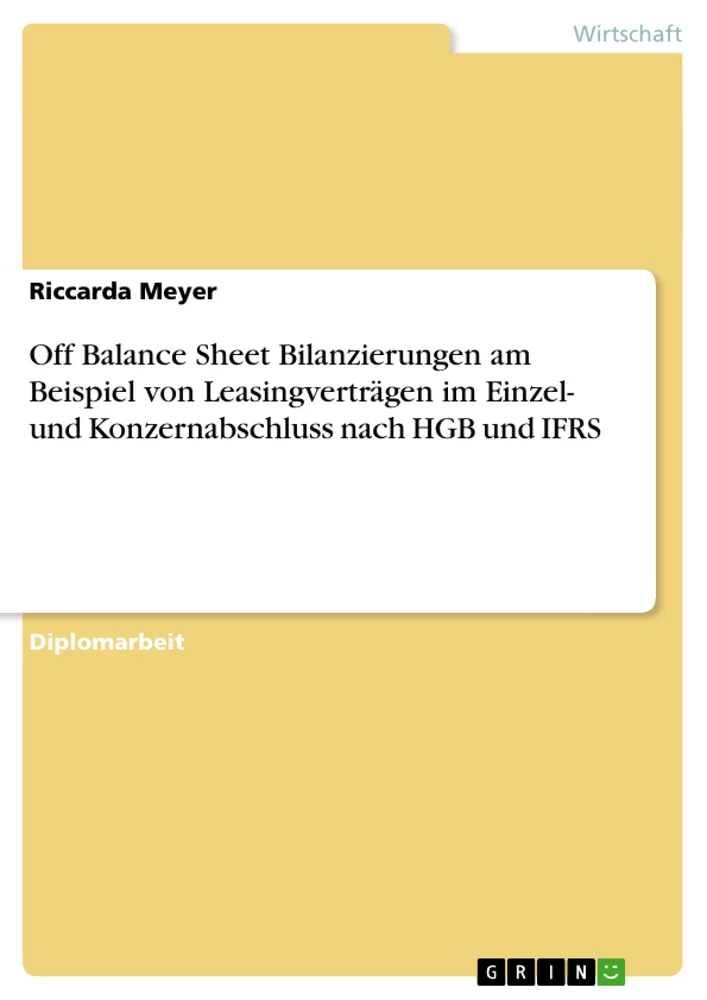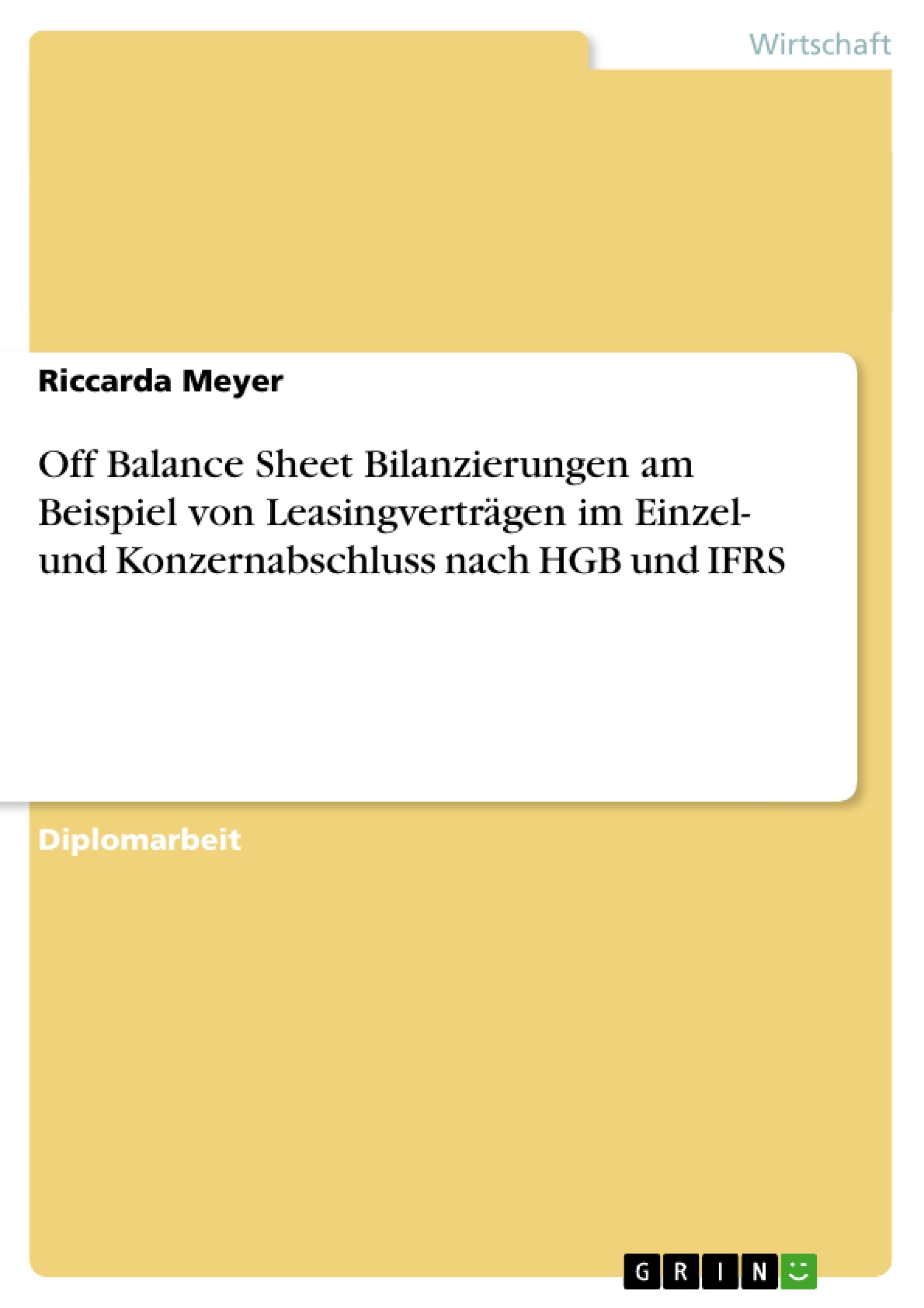Leasing wird aufgrund der Vielzahl möglicher Vertragsgestaltungen in der deutschen sowie in der internationalen Rechnungslegung als eines der komplexesten Bilanzierungsprobleme angesehen. Dabei etabliert sich Leasing zunehmend als die wichtigste Finanzierungsalternative. In Deutschland betrug 2005 das Leasingneugeschäft ca. € 51.1 Mrd., die Leasingquote hatte somit einen Anteil von 19,2% an den gesamtwirtschaftlichen Investitionen im Jahre 2005. Hauptgrund vieler Unternehmer sich für Leasing als Investitionsfunktion zu entscheiden, ist der off- balance sheet Effekt dieser Finanzierungsalternative. Der internationale Begriff der off- balance sheet Finanzierung ist in Deutschland als bilanzneutrales Finanzierungsinstrument bekannt. Eine Beschäftigung mit diesem Themenkomplex, wie er bereits schon in der internationalen Rechnungslegung rege betrieben wird, ist in Deutschland leider noch weitgehend zu vermissen. Die Motivation in diesem Zusammenhang off- balance sheet Finanzierungen als Vergleichkriterium der deutschen Rechnungslegung nach dem HGB und der internationalen Rechnungslegung nach den International Financial Reporting Standards (IFRS) auszuwählen, resultiert aus dem hohen Praxiswert dieser Finanzierungsalternative in Form von Operating Leasingverträge. Des Weiteren stellt es sich als eine Herausforderung dar eines der komplexesten Bilanzierungsprobleme kritisch zu betrachten und zu würdigen. Die Entscheidung, die beiden Rechnungslegungen (IFRS und HGB) als Grundkonzepte meiner Arbeit vergleichend zu betrachten, resultiert aus der wachsenden Internationalisierung der Rechnungslegung. Deutsche Unternehmen müssen sich zunehmend mit einer internationalen Rechnungslegung auseinandersetzen. Zu erwähnen ist insbesondere die Verabschiedung der EUVerordnung Nr. 1606/2002, die für konsolidierte Abschlüsse kapitalmarktorientierter Unternehmen ab dem 1.01.2005 eine Aufstellung nach IFRS vorsieht. Bedanken möchte ich mich in diesem Rahmen bei Herrn Martin Vogel, Senior Manager bei KPMG Frankfurt. Herr Vogel hat mich während der Diplomarbeit fachlich unterstützt und mir mit seiner Sicht als Wirtschaftprüfer stets seine Hilfsbereitschaft angeboten. Des Weiteren möchte ich Herrn Mozzi, Vertriebsleiter der Movesta Finance and Lease GmbH Frankfurt, meinen Dank aussprechen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 1.1 Problem
- 1.2 Gang der Untersuchung
- 2. Off-Balance-Sheet-Finanzierung
- 2.1 Definition
- 2.2 Instrumente
- 2.2.1 Leasing
- 2.2.2 Asset-Backed-Securities (ABS)
- 2.2.3 Spezialfonds
- 2.2.4 Special Purpose Entity (SPE)
- 2.2.4.1 Motive für die Gründung von Special Purpose Entities
- 3. Off-Balance-Sheet-Finanzierungen anhand von Leasingverträgen
- 3.1 Begriff und Merkmal des Leasings
- 3.2 Leasingentwicklung in Deutschland
- 3.3 Vorteile des Leasings
- 3.4 Rechtsnatur des Leasings
- 3.5 Klassifikation von Leasingverträgen in der deutschen Rechnungslegung
- 3.5.1 Operating Leasing
- 3.5.2 Finanzierungsleasing
- 3.5.3 Vertragstypen von Leasingverträgen
- 3.5.3.1 Vollamortisationsverträge
- 3.5.3.2 Teilamortisationsverträge
- 3.6 Leasing in der internationalen Rechnungslegung
- 3.6.1 Finance- und Operating Lease
- 3.7 Die Bilanzneutralität von Leasingverträgen im Einzelabschluss
- 3.8 Handelsrechtliche Rechnungslegung
- 3.9 Die Bilanzierung von Leasingverträgen im Einzelabschluss nach HGB
- 3.9.1 Zurechnung von Leasingobjekten nach HGB
- 3.9.1.1 Grundsätze über das wirtschaftliche Eigentum
- 3.9.1.2 Die steuerlichen Leasingerlasse
- 3.9.1.2.1 Bilanzierung der Leasingverhältnisse bei Zurechnung der Leasingobjekte beim Leasingnehmer
- 3.9.1.2.2 Bilanzierung der Leasingverhältnisse bei Zurechnung der Leasingobjekte beim Leasinggeber
- 3.9.1.3 Angaben im Anhang
- 3.10 Internationale Rechnungslegung
- 3.10.1 Vermögenswerte nach IFRS
- 3.10.2 Leasingbilanzierung nach IFRS
- 3.10.2.1 Die wirtschaftliche Betrachtungsweise (substance over form)
- 3.10.2.2 Kriterien für die Klassifikation als Finance Lease
- 3.10.2.2.1 Die Abbildung von Leasingverhältnissen im Jahresabschluss des Leasingnehmers
- 3.10.2.2.2 Die Abbildung von Leasingverhältnissen im Jahresabschluss des Leasinggebers
- 3.10.2.3 Angaben im Anhang
- 3.11 Vergleichende Betrachtung und kritische Würdigung
- 4. Leasingobjektgesellschaften als Beispiele der Off-Balance-Sheet-Finanzierungen
- 4.1 Grundsätzliches zu Leasingobjektgesellschaften
- 4.2 Off-Balance-Sheet-Effekt durch Leasingobjektgesellschaften
- 4.3 Die Konsolidierung von Leasingobjektgesellschaften nach HGB
- 4.3.1 Aufstellungspflicht eines Konzernabschlusses nach § 290 HGB
- 4.3.1.1 Konsolidierungsmaßnahmen
- 4.3.2 Anhangangaben nach HGB
- 4.4 Die Konsolidierung von Leasingobjektgesellschaften nach IFRS
- 4.4.1 Die Einbeziehung von Tochtergesellschaften nach IAS 27
- 4.4.2 Die Anwendung der Interpretationsnorm SIC 12
- 4.4.2.1 Konsolidierungsmaßnahmen
- 4.4.3 Anhangangaben nach IFRS
- 4.5 Vergleichende Betrachtung und kritische Würdigung
- 5. Bedeutung der Leasingobjektgesellschaften in der Praxis
- 5.1 Beispielhafte Gestaltung einer Leasingobjektgesellschaft
- 5.1.1 Würdigung nach IFRS
- 5.1.2 Würdigung nach HGB
- 5.2 Ausgewählte Geschäftsberichte unter Bezugnahme von Special Purpose Entities
- 5.3 Off-Balance-Sheet-Finanzierungen durch Mietmodelle
- 6. Neuere Entwicklungen zur Leasingbilanzierung nach IFRS
- 6.1 Financial Component Approach
- 6.2 Whole Asset Approach
- 6.3 Vergleichende Betrachtung und kritische Würdigung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Off-Balance-Sheet-Bilanzierung am Beispiel von Leasingverträgen, vergleichend betrachtet nach HGB und IFRS. Ziel ist es, die komplexen Bilanzierungsprobleme im Zusammenhang mit Leasing aufzuzeigen und die Unterschiede in der Behandlung nach deutschem und internationalem Rechnungslegungsrecht zu analysieren.
- Vergleich der Bilanzierung von Leasingverträgen nach HGB und IFRS
- Analyse der Off-Balance-Sheet-Effekte von Leasing
- Untersuchung von Leasingobjektgesellschaften als Instrument der Off-Balance-Sheet-Finanzierung
- Bewertung der Vor- und Nachteile verschiedener Leasingmodelle
- Diskussion aktueller Entwicklungen in der Leasingbilanzierung nach IFRS
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Dieses einführende Kapitel skizziert das Problem der komplexen Bilanzierung von Leasingverträgen und erläutert den Aufbau der Arbeit. Es hebt die Bedeutung von Leasing als Finanzierungsinstrument und den Wunsch nach einer umfassenden Vergleichsbetrachtung von HGB und IFRS hervor.
2. Off-Balance-Sheet-Finanzierung: Dieses Kapitel definiert den Begriff der Off-Balance-Sheet-Finanzierung und beschreibt verschiedene Instrumente, darunter Leasing, Asset-Backed Securities, Spezialfonds und Special Purpose Entities (SPE). Es beleuchtet die Motive hinter der Nutzung solcher Instrumente und legt den Grundstein für die detaillierte Betrachtung von Leasingverträgen in den folgenden Kapiteln.
3. Off-Balance-Sheet-Finanzierungen anhand von Leasingverträgen: Dieses zentrale Kapitel analysiert Leasingverträge detailliert. Es definiert Leasing, beschreibt seine Entwicklung in Deutschland, listet seine Vorteile auf und untersucht seine Rechtsnatur. Die Klassifizierung von Leasingverträgen nach HGB (Operating- und Finanzierungsleasing) wird ebenso behandelt wie die internationale Rechnungslegung nach IFRS (Finance- und Operating Lease). Die Bilanzierung von Leasingverträgen unter HGB und IFRS wird im Detail verglichen, einschließlich der jeweiligen Anhangangaben. Die wirtschaftliche Betrachtungsweise ("substance over form") im Kontext von IFRS wird besonders hervorgehoben.
4. Leasingobjektgesellschaften als Beispiele der Off-Balance-Sheet-Finanzierungen: Dieses Kapitel widmet sich Leasingobjektgesellschaften als spezielle Form der Off-Balance-Sheet-Finanzierung. Es erklärt die grundlegenden Prinzipien, den Off-Balance-Sheet-Effekt und die Konsolidierung dieser Gesellschaften nach HGB und IFRS. Der Vergleich der beiden Rechnungslegungsstandards im Kontext der Konsolidierung und die entsprechenden Anhangangaben werden eingehend behandelt.
5. Bedeutung der Leasingobjektgesellschaften in der Praxis: Dieses Kapitel vertieft die praktische Relevanz von Leasingobjektgesellschaften. Es präsentiert ein Beispiel für die Gestaltung einer solchen Gesellschaft und analysiert diese sowohl unter HGB als auch IFRS. Ausgewählte Geschäftsberichte mit Bezug auf Special Purpose Entities werden diskutiert, um die Anwendung in der Praxis zu veranschaulichen. Zusätzlich werden Off-Balance-Sheet-Finanzierungen durch Mietmodelle betrachtet.
6. Neuere Entwicklungen zur Leasingbilanzierung nach IFRS: Dieses Kapitel befasst sich mit aktuellen Entwicklungen in der IFRS-Leasingbilanzierung, wie dem "Financial Component Approach" und dem "Whole Asset Approach". Die Unterschiede und die Auswirkungen dieser Ansätze werden verglichen und kritisch gewürdigt.
Schlüsselwörter
Off-Balance-Sheet-Finanzierung, Leasing, HGB, IFRS, Bilanzierung, Konzernabschluss, Leasingobjektgesellschaften, Special Purpose Entities (SPE), Finanzierungsleasing, Operating Leasing, wirtschaftliches Eigentum, substance over form, Konsolidierung, IAS 27, SIC 12, Financial Component Approach, Whole Asset Approach.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Off-Balance-Sheet-Finanzierung am Beispiel von Leasingverträgen
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Off-Balance-Sheet-Bilanzierung, insbesondere im Kontext von Leasingverträgen. Sie vergleicht die Bilanzierung nach den deutschen Handelsgesetzbuch (HGB) und den International Financial Reporting Standards (IFRS) und analysiert die Unterschiede in der Behandlung von Leasing.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der Off-Balance-Sheet-Finanzierung, darunter die Definition und verschiedene Instrumente (Leasing, Asset-Backed Securities, Spezialfonds, Special Purpose Entities), die detaillierte Analyse von Leasingverträgen (Klassifizierung, Rechtsnatur, Bilanzierung nach HGB und IFRS), die Rolle von Leasingobjektgesellschaften als Instrument der Off-Balance-Sheet-Finanzierung, deren Konsolidierung nach HGB und IFRS, sowie neuere Entwicklungen in der IFRS-Leasingbilanzierung (Financial Component Approach und Whole Asset Approach).
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die komplexen Bilanzierungsprobleme im Zusammenhang mit Leasing aufzuzeigen und die Unterschiede in der Behandlung nach deutschem und internationalem Rechnungslegungsrecht zu analysieren. Sie vergleicht die Bilanzierung von Leasingverträgen nach HGB und IFRS, analysiert die Off-Balance-Sheet-Effekte von Leasing, untersucht Leasingobjektgesellschaften, bewertet Vor- und Nachteile verschiedener Leasingmodelle und diskutiert aktuelle Entwicklungen in der Leasingbilanzierung nach IFRS.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Kapitel 1 bietet eine Einführung, Kapitel 2 definiert Off-Balance-Sheet-Finanzierung und deren Instrumente. Kapitel 3 analysiert Leasingverträge detailliert unter HGB und IFRS. Kapitel 4 behandelt Leasingobjektgesellschaften und deren Konsolidierung. Kapitel 5 betrachtet die praktische Bedeutung von Leasingobjektgesellschaften und Mietmodellen. Kapitel 6 befasst sich mit aktuellen Entwicklungen in der IFRS-Leasingbilanzierung.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Off-Balance-Sheet-Finanzierung, Leasing, HGB, IFRS, Bilanzierung, Konzernabschluss, Leasingobjektgesellschaften, Special Purpose Entities (SPE), Finanzierungsleasing, Operating Leasing, wirtschaftliches Eigentum, substance over form, Konsolidierung, IAS 27, SIC 12, Financial Component Approach, Whole Asset Approach.
Was sind die zentralen Unterschiede in der Leasingbilanzierung nach HGB und IFRS?
Die Arbeit vergleicht detailliert die Klassifizierung von Leasingverträgen (Operating vs. Finanzierungsleasing nach HGB; Finance vs. Operating Lease nach IFRS), die Bilanzierung der Leasingverträge und die entsprechenden Anhangangaben. Ein Hauptunterschied liegt in der wirtschaftlichen Betrachtungsweise ("substance over form") nach IFRS, die zu einer anderen Zuordnung des wirtschaftlichen Eigentums führen kann.
Welche Rolle spielen Leasingobjektgesellschaften?
Leasingobjektgesellschaften werden als spezielle Form der Off-Balance-Sheet-Finanzierung untersucht. Die Arbeit analysiert, wie diese Gesellschaften den Off-Balance-Sheet-Effekt erzielen und wie sie nach HGB und IFRS konsolidiert werden müssen. Die Unterschiede in der Konsolidierung und die entsprechenden Anhangangaben werden im Detail behandelt.
Welche aktuellen Entwicklungen in der IFRS-Leasingbilanzierung werden diskutiert?
Die Arbeit diskutiert den "Financial Component Approach" und den "Whole Asset Approach" als aktuelle Entwicklungen in der IFRS-Leasingbilanzierung. Die Unterschiede und Auswirkungen dieser Ansätze werden verglichen und kritisch gewürdigt.
- Quote paper
- Riccarda Meyer (Author), 2006, Off Balance Sheet Bilanzierungen am Beispiel von Leasingverträgen im Einzel- und Konzernabschluss nach HGB und IFRS, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/60108