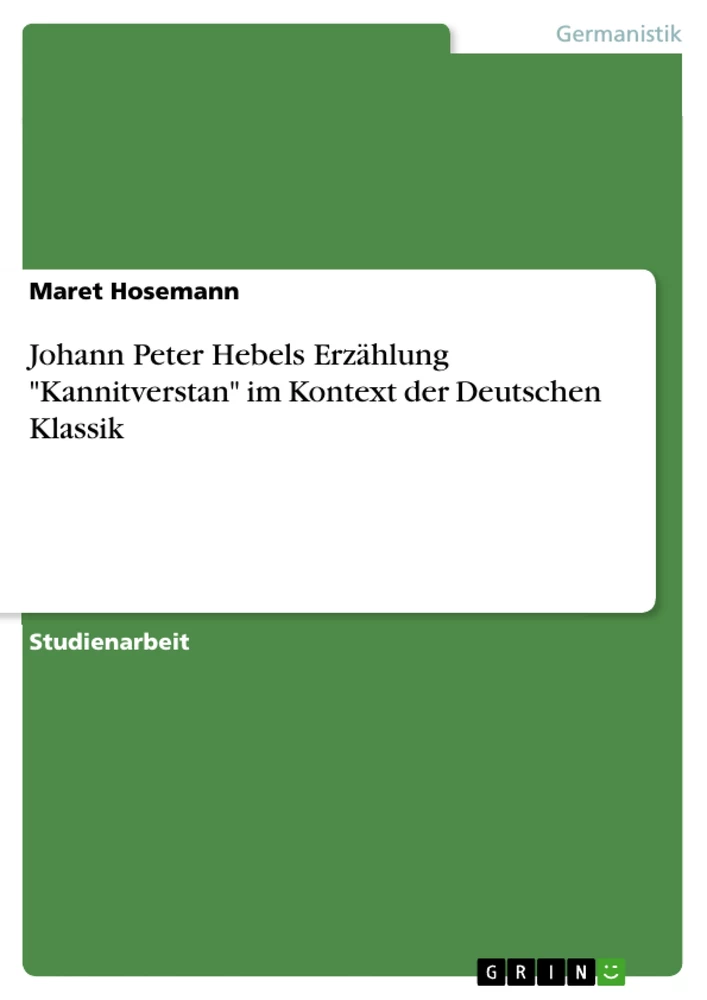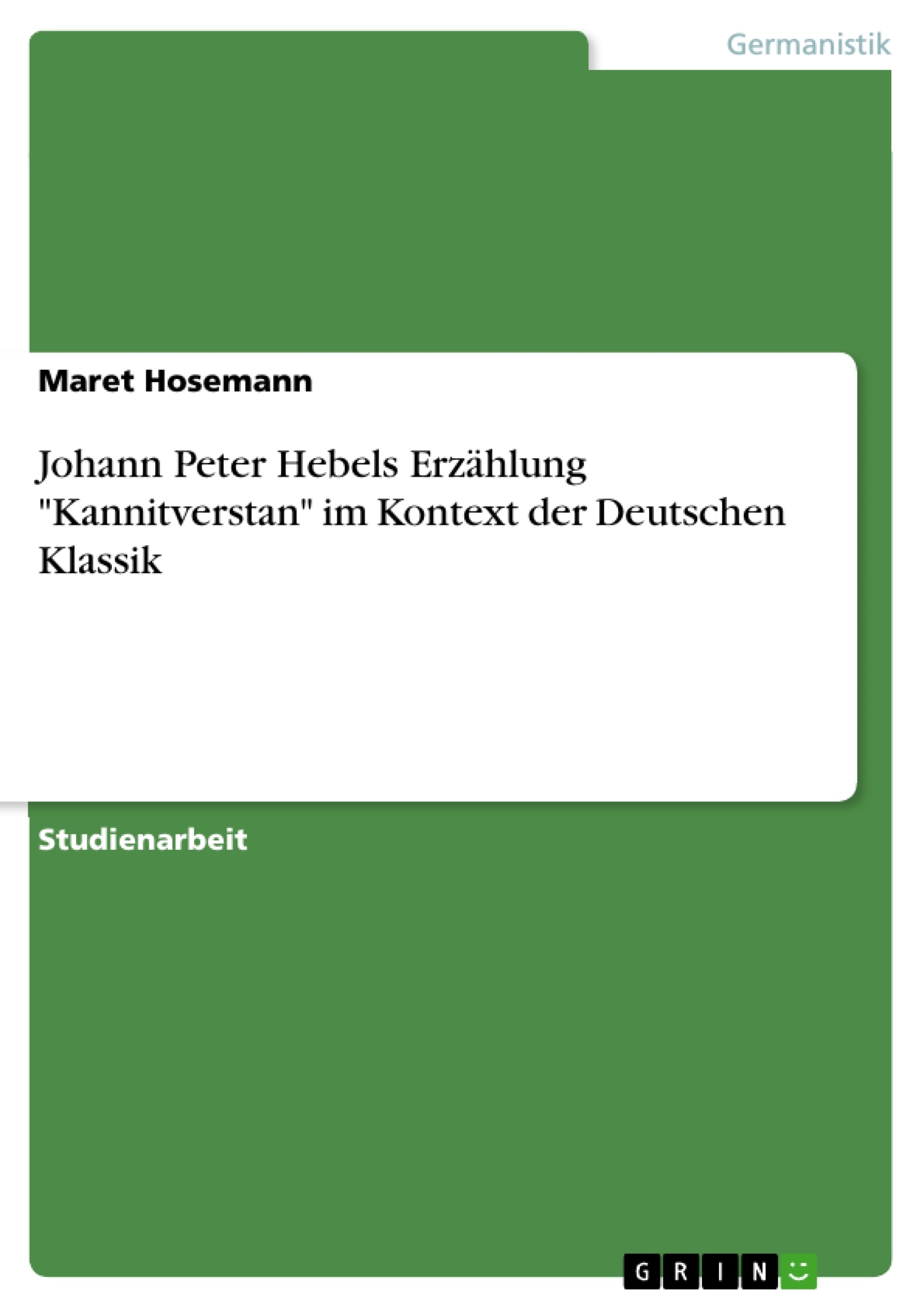Im Jahr 1807 übernahm der evangelische Theologe und Pädagoge Johann Peter Hebel die Schriftleitung und das Amt des Hauptautors beim Badischen Landkalender und benannte diesen in Der Rheinländische Hausfreund um. Hebels Rheinländischer Hausfreund erschien, wie für einen Kalender üblich, jährlich und bestand aus Naturbeschreibungen und Nachrichten, sowie aus zahlreichen Erzählungen. Im Rheinländischen Hausfreund des Jahres 1808 erschien erstmals eine Erzählung, die heute in vielen Schulbüchern zu finden ist und zu den bekanntesten literarischen Werken Hebels zählt: Kannitverstan. Als der Verleger Johann Friedrich Cotta 1811 den Entschluss fasste, einzelne Erzählungen aus den Kalendern in einem Sammelband mit dem Titel Schatzkästlein zu verewigen, gehörte auch Kannitverstan zu den ausgewählten Stücken. In der vorliegenden Hausarbeit soll die Erzählung Kannitverstan im Kontext der Deutschen Klassik untersucht werden. Dabei wird thematisiert, inwieweit sich Johann Peter Hebel als ‚klassischer Autor’ bezeichnen lässt und in welcher Verbindung er zu den bekanntesten Vertretern der Deutschen Klassik, Johann Wolfgang von Goethe und Friedrich Schiller, steht. Des weiteren soll die Erzählung Kannitverstan ausführlich expliziert und kritisch interpretiert werden. Hierfür wird ein hermeneutischer Ansatz gewählt.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1. Fragestellung
- 2. Forschungsstand
- II. Hauptteil
- 1. Hebel und Goethe
- 2. Hebels Kunstauffassung und das Kunstverständnis der Klassik
- 3. Kritik an Kannitverstan und der Aspekt des Quietismus
- 4. Das Motiv des Pantheismus in Kannitverstan
- 5. Das Motiv des Humanismus in Kannitverstan
- 6. Kannitverstan heute
- III. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Johann Peter Hebels Erzählung „Kannitverstan“ im Kontext der Deutschen Klassik. Ziel ist es, Hebels Position als „klassischer Autor“ zu beleuchten, seine Verbindung zu Goethe und Schiller zu ergründen und „Kannitverstan“ ausführlich zu interpretieren. Ein hermeneutischer Ansatz wird verfolgt.
- Hebels Verhältnis zur Deutschen Klassik und seine Einordnung in die literaturgeschichtliche Epoche
- Analyse von Hebels Kunstauffassung im Vergleich zum Klassik-Verständnis
- Interpretation der Erzählung „Kannitverstan“, insbesondere die Motive des Quietismus, Pantheismus und Humanismus
- Rezeption und Kritik an „Kannitverstan“
- Die Aktualität von „Kannitverstan“ in der heutigen Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein, indem sie den Kontext der Entstehung von Hebels Erzählung „Kannitverstan“ im Badischen Landkalender (später Rheinländischer Hausfreund) darstellt. Sie erläutert die Forschungsfrage nach Hebels Einordnung in die Deutsche Klassik und skizziert den Forschungsstand zu Gattung, Epoche und Kunstauffassung des Autors. Die bestehenden Kontroversen in der Literaturwissenschaft bezüglich Hebels Klassik-Zugehörigkeit und unterschiedlichen Interpretationen seiner Erzählkunst werden hervorgehoben, um den Rahmen der Untersuchung abzustecken. Die methodische Herangehensweise, ein hermeneutischer Ansatz, wird kurz erläutert.
II. Hauptteil: Dieser Teil der Arbeit analysiert verschiedene Aspekte von Hebels Werk und seiner Beziehung zur Deutschen Klassik. Er beginnt mit der Untersuchung der persönlichen und literarischen Beziehung zwischen Hebel und Goethe, inklusive einer Auseinandersetzung mit Goethes Rezension der Alemannischen Gedichte und deren Interpretationen in der Forschung. Es folgt eine eingehende Analyse von Hebels Kunstauffassung und ihrer Einordnung in das Kunstverständnis der Klassik, unter Berücksichtigung der widersprüchlichen Positionen der Literaturwissenschaft. Die folgenden Unterkapitel befassen sich mit Kritik an "Kannitverstan", sowie der eingehenden Untersuchung der Motive des Quietismus, Pantheismus und Humanismus in der Erzählung. Die Arbeit gipfelt in einer Betrachtung der Relevanz von "Kannitverstan" für die heutige Zeit.
Schlüsselwörter
Johann Peter Hebel, Kannitverstan, Deutsche Klassik, Goethe, Schiller, Kalendergeschichte, Kunstauffassung, Quietismus, Pantheismus, Humanismus, Alemannische Gedichte, Literaturwissenschaft, Interpretation, Hermeneutik.
Häufig gestellte Fragen zu: Interpretation von Hebels "Kannitverstan" im Kontext der Deutschen Klassik
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert Johann Peter Hebels Erzählung "Kannitverstan" im Kontext der Deutschen Klassik. Sie untersucht Hebels Position als "klassischer Autor", seine Verbindung zu Goethe und Schiller und interpretiert "Kannitverstan" ausführlich unter Verwendung eines hermeneutischen Ansatzes.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Hebels Verhältnis zur Deutschen Klassik und seine Einordnung in die literaturgeschichtliche Epoche; Analyse von Hebels Kunstauffassung im Vergleich zum Klassik-Verständnis; Interpretation von "Kannitverstan", insbesondere der Motive des Quietismus, Pantheismus und Humanismus; Rezeption und Kritik an "Kannitverstan"; Die Aktualität von "Kannitverstan" in der heutigen Zeit.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Teile: Eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss. Die Einleitung stellt die Forschungsfrage und den Forschungsstand vor. Der Hauptteil analysiert die Beziehung zwischen Hebel und Goethe, Hebels Kunstauffassung, die Kritik an "Kannitverstan" und die zentralen Motive der Erzählung. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie ist die Beziehung zwischen Hebel und Goethe dargestellt?
Die Arbeit untersucht die persönliche und literarische Beziehung zwischen Hebel und Goethe, einschließlich einer Auseinandersetzung mit Goethes Rezension der Alemannischen Gedichte und deren Interpretationen in der Forschung.
Welche Motive werden in "Kannitverstan" analysiert?
Die Arbeit analysiert eingehend die Motive des Quietismus, Pantheismus und Humanismus in Hebels Erzählung "Kannitverstan".
Welche Methode wird angewendet?
Die Arbeit verwendet einen hermeneutischen Ansatz zur Interpretation von "Kannitverstan".
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Johann Peter Hebel, Kannitverstan, Deutsche Klassik, Goethe, Schiller, Kalendergeschichte, Kunstauffassung, Quietismus, Pantheismus, Humanismus, Alemannische Gedichte, Literaturwissenschaft, Interpretation, Hermeneutik.
Welche Zusammenfassung der Kapitel bietet die Arbeit?
Die Arbeit bietet detaillierte Zusammenfassungen der Einleitung und des Hauptteils, die die jeweiligen Inhalte und Forschungsansätze erläutern. Die Einleitung stellt den Kontext der Entstehung von "Kannitverstan" dar und skizziert den Forschungsstand. Der Hauptteil beschreibt die Analyse von Hebels Werk und seiner Beziehung zur Deutschen Klassik, inklusive der Untersuchung der genannten Motive.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, Hebels Position als "klassischer Autor" zu beleuchten, seine Verbindung zu Goethe und Schiller zu ergründen und "Kannitverstan" ausführlich zu interpretieren.
- Quote paper
- Maret Hosemann (Author), 2006, Johann Peter Hebels Erzählung "Kannitverstan" im Kontext der Deutschen Klassik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59951