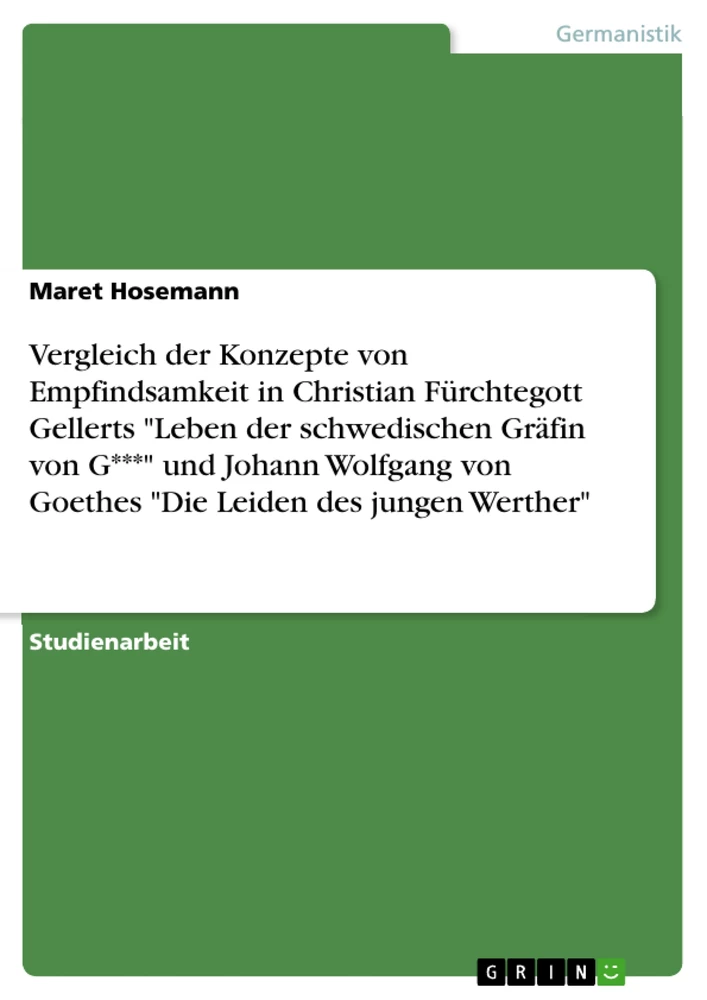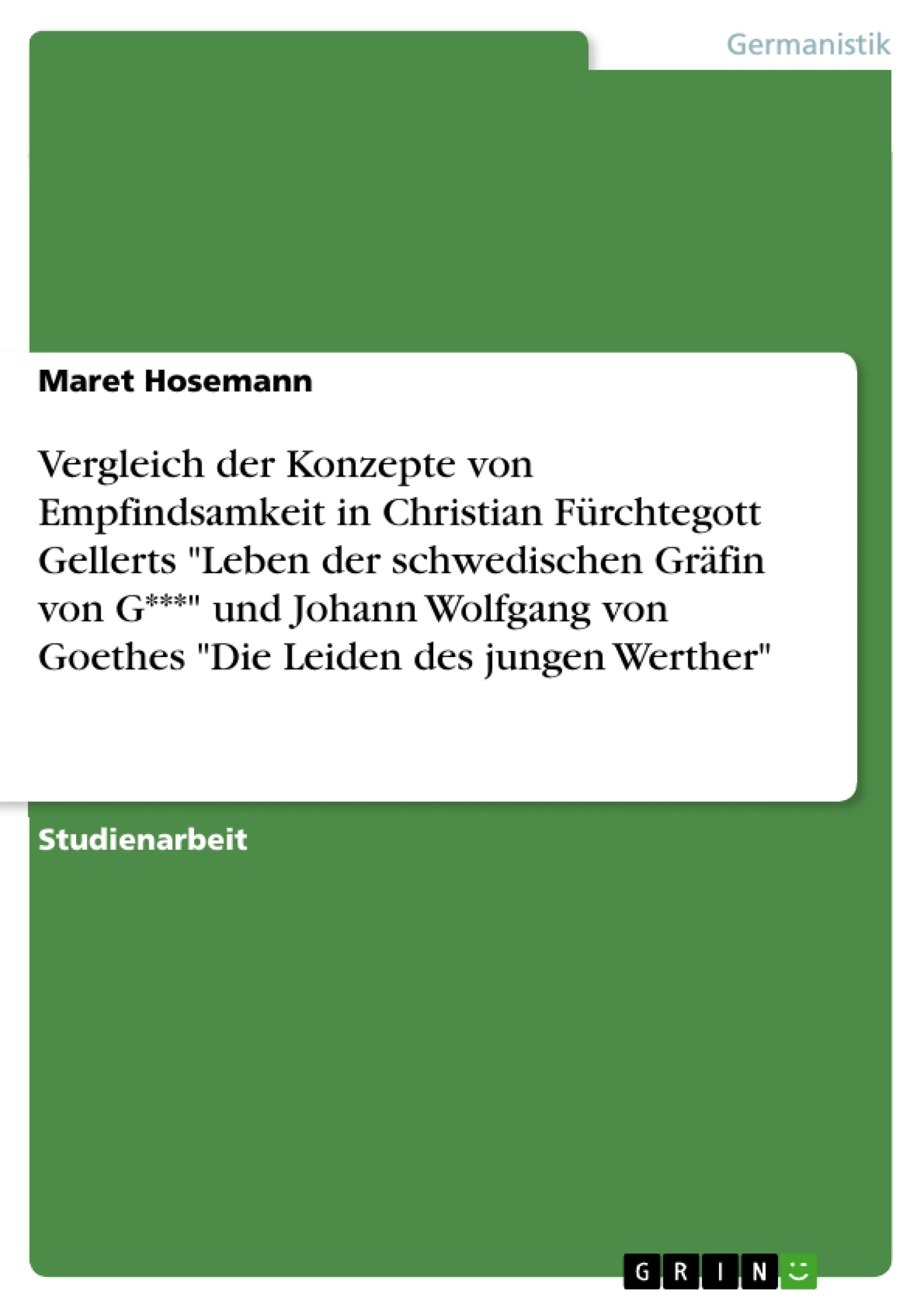In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhundert begann in Deutschland die Epoche der Empfindsamkeit. Nach Nikolaus Wegemann beschreibe der Terminus ‚Empfindsamkeit‘ in seiner Grundbedeutung „ die Fähigkeit zur Erfahrung sinnlich angenehmer Empfindungen und Gefühle, deren legitimer sozialer Ort die altruistische, gänzliche moralische und nur Gegenseitiger Zuwendung verpflichteter Geselligkeit ist“1. Um die Mitte des 18. Jahrhunderts, in den Jahren 1747 und 1748, veröffentlichte Christian Fürchtegott Gellert die beiden Teile seines Romans Leben der schwedischen Gräfin von G***. Sowohl Wegemann als auch Thomas Kahlcke charakterisieren Gellerts Roman als den ersten, großen „Durchbruch“ der Empfindsamkeit in Deutschland. Im Jahre 1774 kam es zu einem Ereignis, das Wegemann als das „spektakulärste“ in der Geschichte der Empfindsamkeit bezeichnet: der Roman Die Leiden des jungen Werther von Johann Wolfgang von Goethe erschien in seiner ersten Auflage. In der vorliegenden Hausarbeit soll der Versuch unternommen werden, diese beiden Romane in Bezug auf ihre dargestellten Konzepte von Empfindsamkeit miteinander zu vergleichen. Die ersten Analogien zwischen Gellerts Leben der schwedischen Gräfin von G*** und Goethes Die Leiden des jungen Werther lassen sich auf der Ebene der Personenkonstellation erkennen. In beiden Romanen finden wir Beziehungsdreiecke, die sich zusammensetzen aus einer Frau, ihrem Gemahl und einem Dritten, der die schon Vergebene liebt. So heiratet Gellerts Ich-Erzählerin, die schwedische Gräfin von G**, nach dem vermeintlichen Tod ihres Ehemannes dessen besten Freund Herrn R**, den sie „so zärtlich als meinen ersten Gemahl“ (LSG 37) liebt. Als der totgeglaubte Graf zurückkehrt, nimmt die Gräfin ihre Ehe mit ihm wieder auf, während Herr R** als Freund in der Gesellschaft der Vermählten bleibt. In Goethes Roman liebt Werther die schöne Lotte, die bereits mit Albert verlobt und später verheiratet ist. Auch hier bleibt der ‚Dritte‘ Werther als ein „Glied der liebenswürdigen Familie“ (W 49) in unmittelbarer Nähe des Paares. Auf den folgenden Seiten sollen nun zunächst die in beiden Romanen behandelten Liebeskonzeptionen untersucht und miteinander verglichen werden. Im Anschluß wird der Versuch unternommen, die Beziehungsdreiecke, für die ich den Terminus ‚Liebestriaden‘ verwende, zu analysieren und dabei darzulegen, ob und wie es den Romanfiguren gelingt, ihre Affekte zu transformieren und miteinander zu kommunizieren.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1.2 Methodik
- Forschungsstand
- Die Liebeskonzeptionen in Gellerts Leben der schwedischen Gräfin von G*** und Goethes Die Leiden des jungen Werther
- 3.1 Das Konzept der vernünftigen Liebe
- 3.2 Das Konzept der leidenschaftlichen Liebe
- Die Liebestriaden in Gellerts Leben der schwedischen Gräfin von G*** und Goethes Die Leiden des jungen Werther
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit einem Vergleich der Konzepte von Empfindsamkeit in Christian Fürchtegott Gellerts „Leben der schwedischen Gräfin von G***“ und Johann Wolfgang von Goethes „Die Leiden des jungen Werther“. Ziel des Vergleichs ist es, die verschiedenen Liebeskonzeptionen und Beziehungsdynamiken in den beiden Romanen zu analysieren und ihre Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten.
- Die Konzepte der vernünftigen und leidenschaftlichen Liebe in beiden Romanen
- Die Darstellung von Beziehungsdreiecken (Liebestriaden) und deren Einfluss auf die Figuren
- Die Rolle der Affekte und deren Transformation im Kontext der Empfindsamkeit
- Die Anwendung der Methode der Intertextualität im Vergleich der beiden Werke
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Diese Einleitung stellt die Epoche der Empfindsamkeit in Deutschland vor und beleuchtet die Bedeutung von Gellerts „Leben der schwedischen Gräfin von G***“ und Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ in diesem Kontext. Die Hausarbeit fokussiert auf den Vergleich der beiden Romane im Hinblick auf ihre Konzepte von Empfindsamkeit.
- Methodik: Der Abschnitt beschreibt die literaturwissenschaftliche Methode der Intertextualität, die zur Analyse und zum Vergleich der beiden Romane angewendet wird. Hier wird auf Gérard Genettes Werk „Palimpseste“ Bezug genommen, das die Intertextualität als Abhängigkeit von Texten untereinander definiert.
- Forschungsstand: Dieser Abschnitt beleuchtet die Forschungsliteratur zu den beiden Romanen und präsentiert unterschiedliche Interpretationen. Es werden die Auffassungen über die Darstellung von Affekten in Gellerts Roman und die psychologischen und soziologischen Interpretationen von Goethes „Die Leiden des jungen Werther“ vorgestellt. Es wird jedoch betont, dass der Fokus der Hausarbeit nicht auf dem Verhältnis von Bürgerlichkeit und Empfindsamkeit liegt.
Schlüsselwörter
Empfindsamkeit, Liebeskonzeptionen, Vernunft, Leidenschaft, Liebestriaden, Beziehungsdreiecke, Affekte, Intertextualität, „Leben der schwedischen Gräfin von G***“, „Die Leiden des jungen Werther“, Gellert, Goethe.
- Quote paper
- Maret Hosemann (Author), 2005, Vergleich der Konzepte von Empfindsamkeit in Christian Fürchtegott Gellerts "Leben der schwedischen Gräfin von G***" und Johann Wolfgang von Goethes "Die Leiden des jungen Werther", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59937