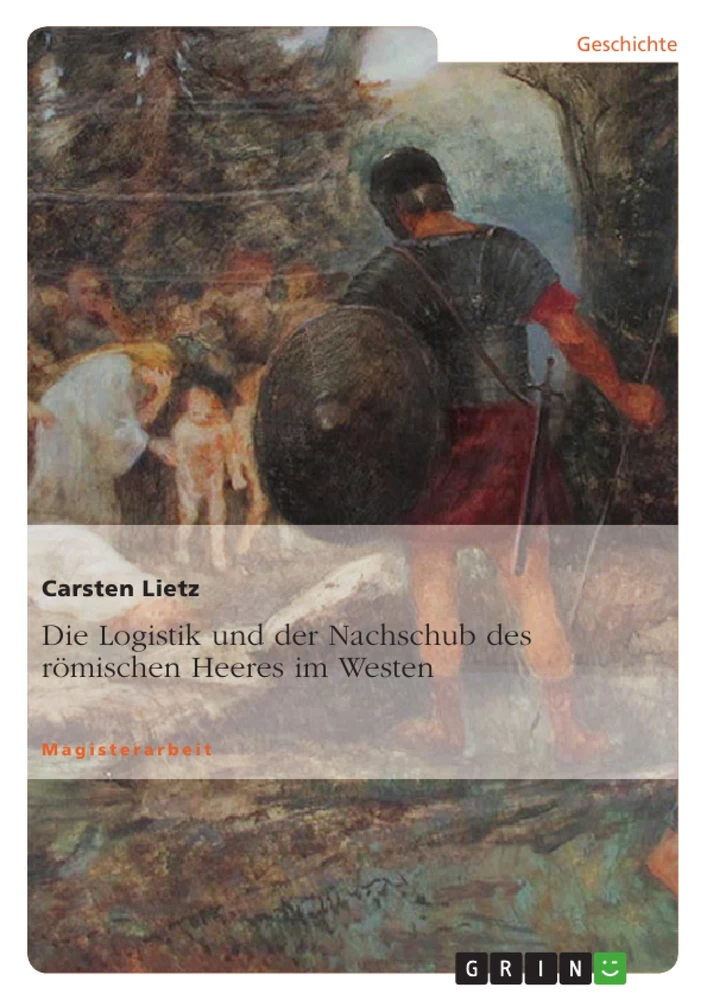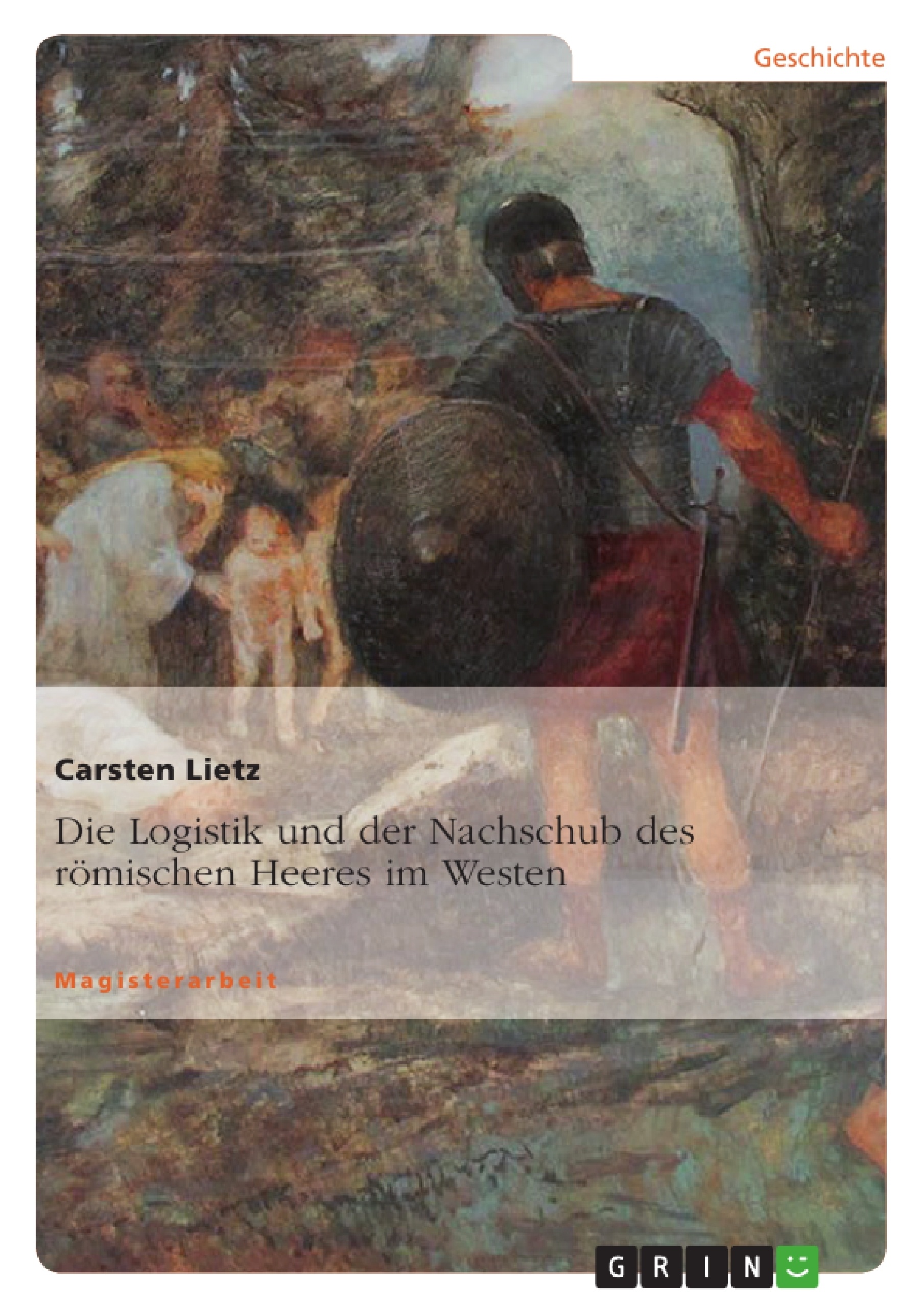In der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts setzte sich das Römische Reich im Westen letztmalig offensiv gegen die Angriffe germanischer Stämme zur Wehr. Der Hergang der einzelnen Feldzüge ist in der Forschung diskutiert und in wesentlichen unstrittig. Die Debatte fand vorrangig vor dem Hintergrund der römischen Außenpolitik oder der Leistungen einzelner Kaiser statt. Weitgehend unberücksichtigt blieben die logistischen Grundlagen der Feldzüge, die sich der Überlieferung zufolge oft entscheidend auf das militärische Potenzial ausgewirkt hatten.
Zunächst werden die einzelnen Expeditionen auf Grundlage der Überlieferung weitgehend unabhängig voneinander untersucht. Mit den so gewonnenen Ergebnissen sollen die wesentlichen Elemente des Nachschubs systematisch beschrieben werden: Feldzugvorbereitungen, Troß, rückwärtiger Nachschub aus dem Landesinnern, die Einbindung Reichsfremder und die Bedeutung von Plünderungen. Diese Überlegungen können sich auf eine breite Forschungsbasis zur spätrömischen Administration stützen. Beschaffung und Verwaltungsabläufe sind weitgehend bekannt und werden einführend referiert.
Wegen einer häufig unbefriedigenden Quellenbasis bleiben zahlreiche Detailfragen offen, bei anderen ist jedoch durch Analogien zu anderen Reichsteilen eine Annäherung möglich. Eine vollständige Darstellung spätrömischer Logistik scheitert am Fehlen wesentlicher statistischer Daten: Truppen- und Bevölkerungsstärken sind in der Forschung höchst umstritten.
Aus den Bereichen der Logistik interessiert für diese Arbeit besonders der Nachschub, weil er die unmittelbarsten Auswirkungen auf die Einsatzbereitschaft der Truppen hat. Sanitäts- und Unterkunftwesen und Ausrüstung bleiben ausgeklammert, soweit sie auf den Nachschub keine Auswirkungen haben. Kämpfe und Feldzüge infolge innerrömischer Auseinandersetzungen bleiben aus methodischen Gründen unberücksichtigt. Die Versorgung einer durch römisches Territorium gegen einen römischen Gegner ziehenden Armee ist mit der im Barbaricum naturgemäß nicht vergleichbar.
Eine Begrenzung des Untersuchungszeitraums ergab sich aus der Quellenlage. Eine sinnvolle Auseinandersetzung mit einzelnen Feldzügen unter logistischen Gesichtspunkten ist nur beim Vorliegen einer einigermaßen detaillierten, zeitlich möglichst nahen Überlieferung möglich. Diese Voraussetzung ist durch die Res Gestae des Ammianus Marcellinus erfüllt, von der die Überlieferung der Jahre 353-378 erhalten sind.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Überlieferungssituation
- 2.1 Logistik in der antiken Überlieferung
- 2.2 Einzelne Quellen
- 3 Grundlagen
- 3.1 Versorgungsstrukturen
- 3.1.1 Die Annona militaris und ihre Verwaltung
- 3.1.2 Zum System der Horrea mit militärischer Funktion
- 3.1.3 Transportwege
- 3.1.4 Versorgung im Winterlager
- 3.2 Zu den Versorgungsgütern
- 3.2.1 Bestandteile der Heeresverpflegung
- 3.2.2 Schwierigkeit der Bedarfsberechnung
- 3.1 Versorgungsstrukturen
- 4 Ausgewählte Fälle der Überlieferung
- 4.1 Untersuchung der Feldzüge
- 4.1.1 Feldzug Constantius II. gegen die Alamannen 354
- 4.1.2 Vorbereitungen für Julians Feldzug des Jahres 357
- 4.1.3 Julians Feldzug gegen Alamannen 357
- 4.1.4 Julians Feldzüge des Jahres 358
- 4.1.5 Julians Feldzug gegen Franken 360
- 4.1.6 Feldzug Valentinian I. gegen Alamannen 368
- 4.1.7 Feldzug Valentinian I. gegen Quaden 375
- 4.2 Maßnahmen struktureller Bedeutung
- 4.2.1 Öffnung des Nachschubweges von Britannien 359
- 4.2.2 Zu den Grenzbefestigungen Valentinian I.
- 4.1 Untersuchung der Feldzüge
- 5 Systematische Zusammenfassung
- 5.1 Logistische Vorbereitungen
- 5.2 Tross und mitgeführte Vorräte
- 5.3 Rückwärtiger Nachschub
- 5.4 Einbindung Reichsfremder in den Nachschub
- 5.5 Funktion und Bedeutung der Plünderungen
- 6 Ergebnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Logistik des römischen Heeres im Westen des Römischen Reiches während der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, insbesondere den Nachschub. Die Arbeit analysiert ausgewählte Feldzüge, um die logistischen Grundlagen und deren Einfluss auf das militärische Potential zu beleuchten. Die Untersuchung berücksichtigt die unterschiedlichen Bedingungen der Feldzüge und die ständigen Veränderungen der Infrastruktur.
- Logistische Vorbereitungen römischer Feldzüge
- Nachschubsysteme und -wege des römischen Heeres
- Die Rolle von Plünderungen in der Versorgung des Heeres
- Verwaltung und Organisation der Annona militaris
- Die Bedeutung der Infrastruktur (Befestigungen, Transportwege) für die Logistik
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt den Forschungsstand zur Logistik der römischen Feldzüge im späten 4. Jahrhundert. Sie hebt die Forschungslücke hervor, die diese Arbeit durch die detaillierte Untersuchung der logistischen Aspekte ausgewählter Feldzüge zu schließen versucht. Die Bedeutung der Logistik für den militärischen Erfolg wird betont und die Methodik der Arbeit dargelegt, die auf einer unabhängigen Analyse einzelner Feldzüge und deren anschließender systematischer Zusammenfassung basiert.
2 Überlieferungssituation: Dieses Kapitel befasst sich mit den Quellen, die für die Untersuchung der römischen Militärlogistik zur Verfügung stehen. Es analysiert die antiken Überlieferungen, die Informationen über die Logistik enthalten, und untersucht einzelne Quellen auf ihren Aussagewert. Die Herausforderungen aufgrund der oft fragmentarischen und unvollständigen Quellen werden thematisiert und die Notwendigkeit analoger Schlussfolgerungen für die Rekonstruktion des Systems wird deutlich.
3 Grundlagen: Kapitel 3 erläutert die grundlegenden Strukturen der römischen Militärversorgung. Es beschreibt die Annona militaris, das System der Horrea, die Transportwege und die besonderen Herausforderungen der Versorgung im Winterlager. Es geht außerdem auf die Zusammensetzung der Versorgungsgüter und die Schwierigkeiten der Bedarfsermittlung ein. Dieses Kapitel liefert die notwendigen Grundlagen für die Analyse der im Folgenden untersuchten Feldzüge.
4 Ausgewählte Fälle der Überlieferung: Hier werden einzelne Feldzüge detailliert untersucht, um die logistischen Abläufe zu rekonstruieren. Die Analyse umfasst die Vorbereitungen, den Tross, den rückwärtigen Nachschub, die Einbindung von Nicht-Römern und die Rolle von Plünderungen. Die einzelnen Feldzüge werden im Kontext der damaligen politischen und militärischen Situation analysiert, um ein umfassendes Bild der Logistik zu zeichnen. Die Auswahl der Feldzüge dient der Repräsentativität der untersuchten Zeitperiode.
5 Systematische Zusammenfassung: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der Einzelanalysen der Feldzüge systematisch zusammen und beschreibt die wesentlichen Elemente des römischen Nachschubs. Es ordnet die gewonnenen Erkenntnisse und stellt die Bedeutung der einzelnen logistischen Komponenten im Kontext zueinander dar. Hier werden die gewonnenen Erkenntnisse der vorherigen Kapitel synthetisiert, um ein umfassendes Bild der römischen Militärlogistik zu präsentieren.
Schlüsselwörter
Römische Militärlogistik, Nachschub, Annona militaris, Horrea, Feldzüge 4. Jahrhundert, Spätantike, Alamannen, Franken, Germanen, Grenzsicherung, Transportwege, Versorgung, Plünderungen, militärisches Potential.
Häufig gestellte Fragen zur Magisterarbeit: Logistik des römischen Heeres im Westen des Römischen Reiches während der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts
Was ist der Gegenstand dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Logistik des römischen Heeres im Westen des Römischen Reiches während der zweiten Hälfte des 4. Jahrhunderts, mit besonderem Fokus auf den Nachschub. Analysiert werden ausgewählte Feldzüge, um die logistischen Grundlagen und deren Einfluss auf das militärische Potential zu beleuchten. Die Arbeit berücksichtigt die unterschiedlichen Bedingungen der Feldzüge und die ständigen Veränderungen der Infrastruktur.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Logistische Vorbereitungen römischer Feldzüge, Nachschubsysteme und -wege des römischen Heeres, die Rolle von Plünderungen in der Versorgung des Heeres, Verwaltung und Organisation der Annona militaris, und die Bedeutung der Infrastruktur (Befestigungen, Transportwege) für die Logistik.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit analysiert die antiken Überlieferungen, die Informationen über die Logistik enthalten, und untersucht einzelne Quellen auf ihren Aussagewert. Die Herausforderungen aufgrund der oft fragmentarischen und unvollständigen Quellen werden thematisiert. Die Notwendigkeit analoger Schlussfolgerungen für die Rekonstruktion des Systems wird deutlich.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sechs Kapitel gegliedert: Einleitung, Überlieferungssituation, Grundlagen, Ausgewählte Fälle der Überlieferung, Systematische Zusammenfassung und Ergebnis. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der römischen Militärlogistik. Die Einleitung beschreibt den Forschungsstand und die Methodik. Die Kapitel 2 und 3 legen die Grundlagen für die Analyse der ausgewählten Feldzüge. Kapitel 4 analysiert detailliert mehrere Feldzüge. Kapitel 5 fasst die Ergebnisse systematisch zusammen, während Kapitel 6 das Ergebnis präsentiert.
Welche Feldzüge werden im Detail untersucht?
Die Arbeit untersucht detailliert folgende Feldzüge: Feldzug Constantius II. gegen die Alamannen 354, Vorbereitungen für Julians Feldzug des Jahres 357, Julians Feldzug gegen Alamannen 357, Julians Feldzüge des Jahres 358, Julians Feldzug gegen Franken 360, Feldzug Valentinian I. gegen Alamannen 368, und Feldzug Valentinian I. gegen Quaden 375. Zusätzlich werden Maßnahmen struktureller Bedeutung wie die Öffnung des Nachschubweges von Britannien 359 und die Grenzbefestigungen Valentinian I. analysiert.
Welche Aspekte der Logistik werden besonders betrachtet?
Die Arbeit betrachtet insbesondere logistische Vorbereitungen, den Tross und mitgeführte Vorräte, den rückwärtigen Nachschub, die Einbindung Reichsfremder in den Nachschub und die Funktion und Bedeutung der Plünderungen.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit synthetisiert die gewonnenen Erkenntnisse zu einem umfassenden Bild der römischen Militärlogistik im späten 4. Jahrhundert. Die genauen Schlussfolgerungen sind im Kapitel "Ergebnis" zusammengefasst, welches die wesentlichen Elemente des römischen Nachschubs beschreibt und die Bedeutung der einzelnen logistischen Komponenten im Kontext zueinander darstellt.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Römische Militärlogistik, Nachschub, Annona militaris, Horrea, Feldzüge 4. Jahrhundert, Spätantike, Alamannen, Franken, Germanen, Grenzsicherung, Transportwege, Versorgung, Plünderungen, militärisches Potential.
- Quote paper
- Carsten Lietz (Author), 1999, Die Logistik und der Nachschub des römischen Heeres im Westen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5989