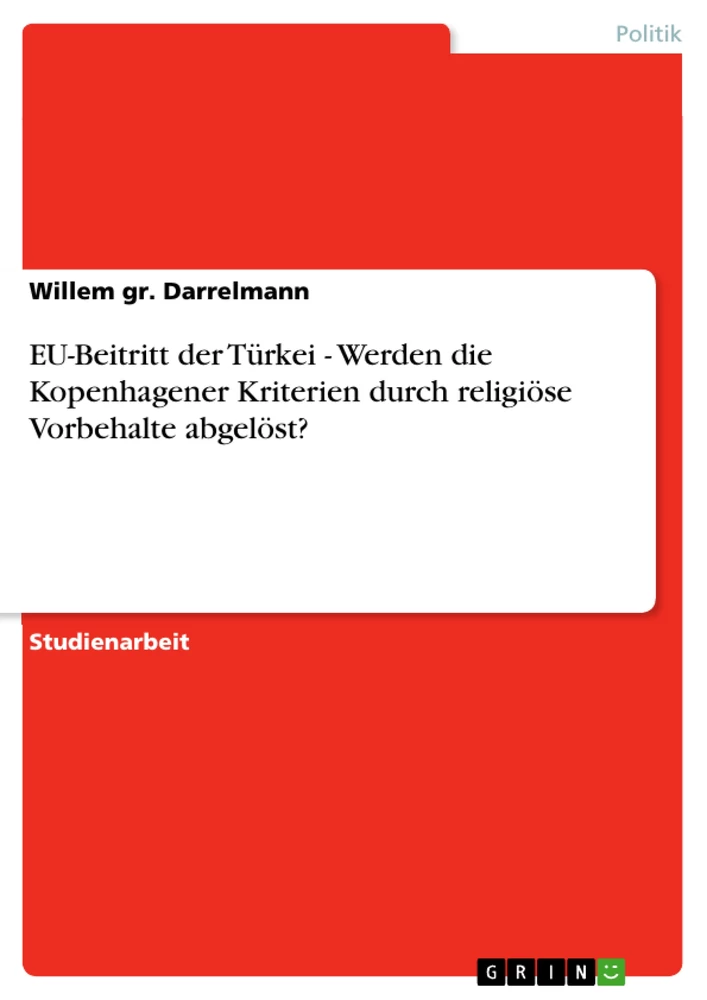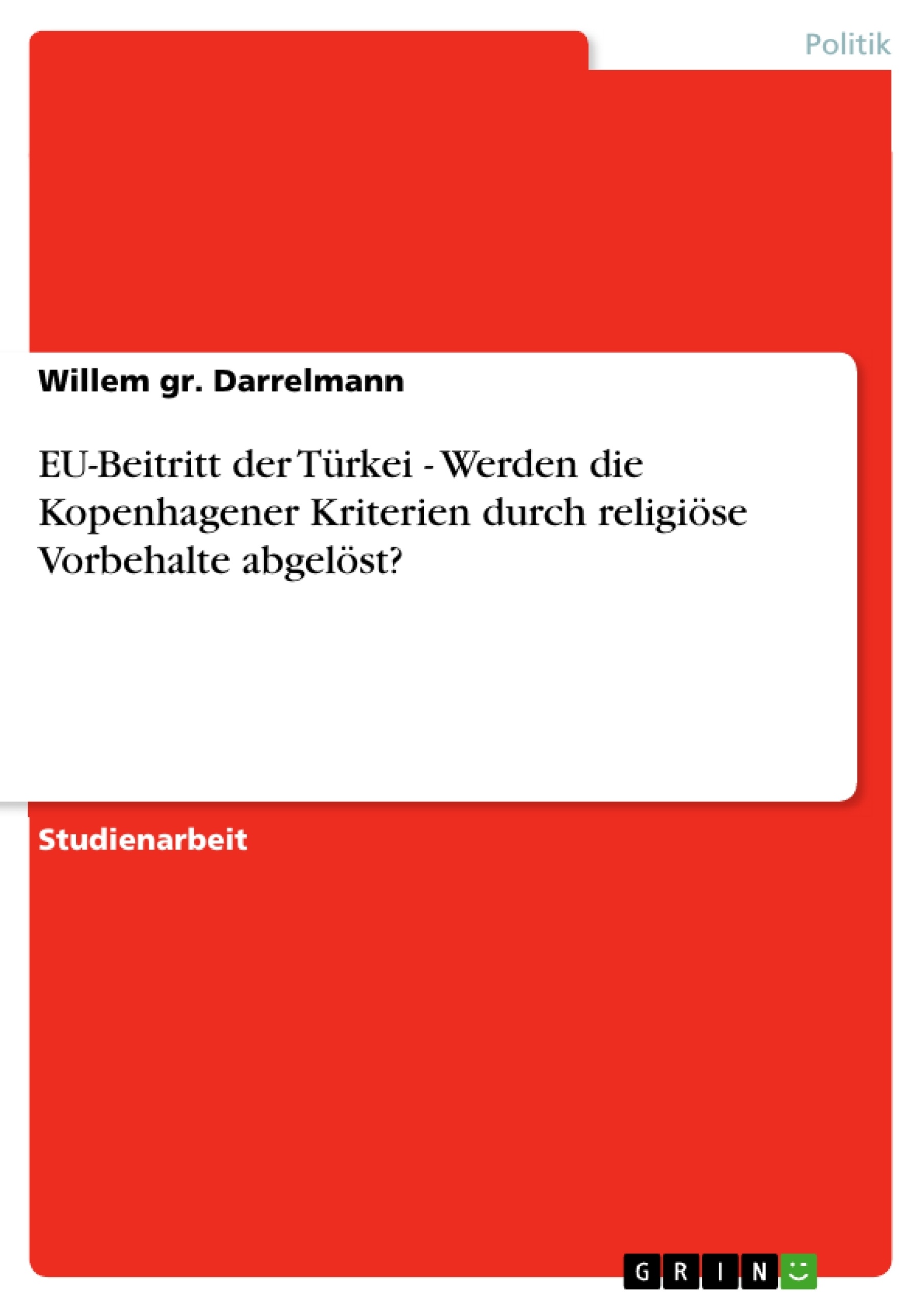Gerhard Schröder faßte in einem Interview mit der türkischen Zeitung Hürriyet den offiziellen Standpunkt der Europäischen Union (EU) folgendermaßen zusammen: „Alle Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union haben 1999 in Helsinki gesagt, daß für die Türkei dieselben Kriterien gelten wie für die anderen Beitrittskandidaten auch.“ (Hürriyet 2004). Läßt sich der europäische Standpunkt zur Türkeifrage mittlerweile in diesem kurzen Statement präzise zusammenfassen, scheinen die nationalen Diskussionen um den EU-Beitritt der Türkei erst an ihrem Anfang zu stehen und wesentlich kontroverser geführt zu werden. Die Unterschiede sind ein spannendes Forschungsgebiet für Theorien der europäischen Integration. Bevor diese jedoch angewandt werden können, müssen die Diskussionen in der EU und den Nationalstaaten analysiert werden. Als einer der größten Abweichungen zwischen den nationalen und supranationalen Diskussionen hat sich das Aufkommen von religiös motivierten Argumenten herausgestellt (vgl. Toggenburg 2004:30), deren Auftreten im Verlauf der deutschen Diskussion Forschungsschwerpunkt dieser Arbeit sein wird. In der weiteren Untersuchung soll der Frage nachgegangen werden, ob in der deutschen Diskussion um den EU-Beitritt der Türkei der Anteil der Argumente steigt, die auf den religiösen Faktor abzielen, während die Kopenhagener Kriterien durch ihre Erfüllung an Bedeutung verlieren. Zur Beantwortung dieser Frage werden zuerst die verwendeten Begriffe definiert, damit anhand der Arbeitsdefinitionen ein klarer Wortgebrauch möglich ist. Bevor die deutsche Diskussion theoretisch und empirisch betrachtet wird, soll noch einmal die Bedeutung der nationalen Diskussionen für die EU dargestellt werden. Abschließend wird zur Überprüfung der Forschungsfrage eine eigene empirische Erhebung von Zeitungskommentaren vorgenommen, die im Anschluß ausgewertet und dargestellt wird.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Begriffsbestimmungen
- 2.1. EU-Beitritt der Türkei
- 2.2. Diskussion um den EU-Beitritt der Türkei
- 2.3. Kopenhagener Kriterien und religiöser Faktor
- 2.5. Bedeutung
- 3. Einfluß der nationalen Diskussionen auf die EU
- 4. Betrachtung der deutschen Diskussion um den EU-Beitritt der Türkei
- 5. Datenerhebung
- 5.1. Untersuchungsplanung
- 5.2. Hypothesenbildung
- 5.3. Operationalisierung
- 6. Datenauswertung
- 6.1. Allgemeine Statistik
- 6.2. Hypothesenprüfung
- 6.3. Beurteilung der internen und externen Validität
- 7. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die deutsche Debatte um den EU-Beitritt der Türkei und die Rolle religiös motivierter Argumente. Das Hauptziel ist es, zu analysieren, ob die Bedeutung der Kopenhagener Kriterien in der öffentlichen Diskussion durch religiöse Vorbehalte abgelöst wird. Die Arbeit analysiert die Entwicklung des Beitrittsprozesses und beleuchtet die unterschiedlichen Diskurse auf nationaler und supranationaler Ebene.
- Der EU-Beitrittsprozess der Türkei
- Die Rolle der Kopenhagener Kriterien
- Der Einfluss religiöser Argumente in der deutschen Debatte
- Vergleich nationaler und supranationaler Diskurse
- Empirische Untersuchung der deutschen Medienberichterstattung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt die Forschungsfrage nach dem Einfluss religiöser Argumente auf die deutsche Debatte um den EU-Beitritt der Türkei in den Mittelpunkt. Sie verweist auf den offiziellen Standpunkt der EU, der die gleichen Kriterien für die Türkei wie für andere Beitrittskandidaten vorsieht, und hebt den Kontrast zu den kontroverseren nationalen Diskussionen hervor. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse religiös motivierter Argumente in der deutschen Debatte und untersucht, ob diese an Bedeutung gewinnen, während die Kopenhagener Kriterien durch ihre Erfüllung an Bedeutung verlieren. Die Methodik der Arbeit, die Definitionen wichtiger Begriffe und die Bedeutung der nationalen Diskussionen für den EU-Prozess werden skizziert.
2. Begriffsbestimmungen: Dieses Kapitel definiert zentrale Begriffe der Arbeit, insbesondere den "EU-Beitritt der Türkei" als langfristigen Prozess der Annäherung, die "Diskussion um den EU-Beitritt der Türkei" mit ihren verschiedenen Ebenen (EU-Institutionen, Mitgliedsstaaten, Türkei), und die "Kopenhagener Kriterien" als formale Beitrittskriterien der EU. Es wird zudem der "religiöse Faktor" definiert und die Schwierigkeit, religiös motivierte Argumente von anderen zu unterscheiden, thematisiert. Der Abschnitt legt den Grundstein für eine präzise und eindeutige Verwendung der zentralen Begriffe in der weiteren Analyse.
3. Einfluß der nationalen Diskussionen auf die EU: Dieses Kapitel würde die Bedeutung der nationalen Diskussionen in den Mitgliedsstaaten für den gesamten EU-Beitrittsprozess der Türkei untersuchen. Es würde den Einfluss nationaler Meinungen auf die Entscheidungen der EU-Institutionen beleuchten und möglicherweise den Grad der Einflussnahme unterschiedlicher nationaler Positionen analysieren. Der Fokus liegt hier auf der Auswirkung der nationalen Diskussionen auf die supranationale Ebene.
4. Betrachtung der deutschen Diskussion um den EU-Beitritt der Türkei: Dieses Kapitel analysiert die spezifischen Argumente und Positionen innerhalb der deutschen Debatte um den EU-Beitritt der Türkei. Es untersucht, wie der Diskurs in Deutschland geführt wurde und welche Akteure maßgeblich daran beteiligt waren. Es wird vermutlich die unterschiedlichen Positionen und Meinungen im deutschen politischen Spektrum zu diesem Thema beleuchten.
5. Datenerhebung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der empirischen Untersuchung. Es erläutert die Untersuchungsplanung, die Hypothesenbildung und die Operationalisierung der verwendeten Variablen. Der Fokus liegt auf der detaillierten Beschreibung des methodischen Vorgehens, um die Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.
Schlüsselwörter
EU-Beitritt, Türkei, Kopenhagener Kriterien, religiöse Vorbehalte, nationale Diskussionen, europäische Integration, Islam, deutsche Politik, Medienanalyse, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: "Der Einfluss religiös motivierter Argumente auf die deutsche Debatte um den EU-Beitritt der Türkei"
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die deutsche öffentliche Debatte über den EU-Beitritt der Türkei und analysiert, inwieweit religiös motivierte Argumente in dieser Debatte eine Rolle spielen und ob sie die Bedeutung der Kopenhagener Kriterien möglicherweise verdrängen.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Analyse des Einflusses religiös motivierter Argumente auf die deutsche Debatte um den EU-Beitritt der Türkei. Es soll untersucht werden, ob die Erfüllung der Kopenhagener Kriterien durch die zunehmende Bedeutung religiöser Vorbehalte an Relevanz verliert. Die Arbeit analysiert den Beitrittsprozess und vergleicht nationale und supranationale Diskurse.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den EU-Beitrittsprozess der Türkei, die Rolle der Kopenhagener Kriterien, den Einfluss religiöser Argumente in der deutschen Debatte, einen Vergleich nationaler und supranationaler Diskurse und eine empirische Untersuchung der deutschen Medienberichterstattung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Begriffsbestimmungen (inkl. EU-Beitritt der Türkei, Diskussion um den Beitritt, Kopenhagener Kriterien und religiöser Faktor), Einfluss nationaler Diskussionen auf die EU, Betrachtung der deutschen Diskussion, Datenerhebung (inkl. Untersuchungsplanung, Hypothesenbildung und Operationalisierung), Datenauswertung (inkl. Statistik, Hypothesenprüfung und Validität) und Zusammenfassung.
Welche Begriffe werden in der Arbeit definiert?
Zentrale Begriffe wie "EU-Beitritt der Türkei", "Diskussion um den EU-Beitritt der Türkei" auf verschiedenen Ebenen, "Kopenhagener Kriterien" und der "religiöse Faktor" werden präzise definiert, um eine eindeutige Verwendung in der Analyse zu gewährleisten.
Wie wird die empirische Untersuchung durchgeführt?
Die Arbeit beinhaltet eine empirische Untersuchung, die in den Kapiteln 5 (Datenerhebung) und 6 (Datenauswertung) detailliert beschrieben wird. Es werden Untersuchungsplanung, Hypothesenbildung, Operationalisierung, statistische Auswertung und die Beurteilung der internen und externen Validität erläutert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Zusammenfassung (Kapitel 7) fasst die Ergebnisse der Untersuchung zusammen und zieht Schlussfolgerungen zum Einfluss religiös motivierter Argumente auf die deutsche Debatte um den EU-Beitritt der Türkei.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: EU-Beitritt, Türkei, Kopenhagener Kriterien, religiöse Vorbehalte, nationale Diskussionen, europäische Integration, Islam, deutsche Politik, Medienanalyse, empirische Forschung.
- Quote paper
- Willem gr. Darrelmann (Author), 2005, EU-Beitritt der Türkei - Werden die Kopenhagener Kriterien durch religiöse Vorbehalte abgelöst?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59853