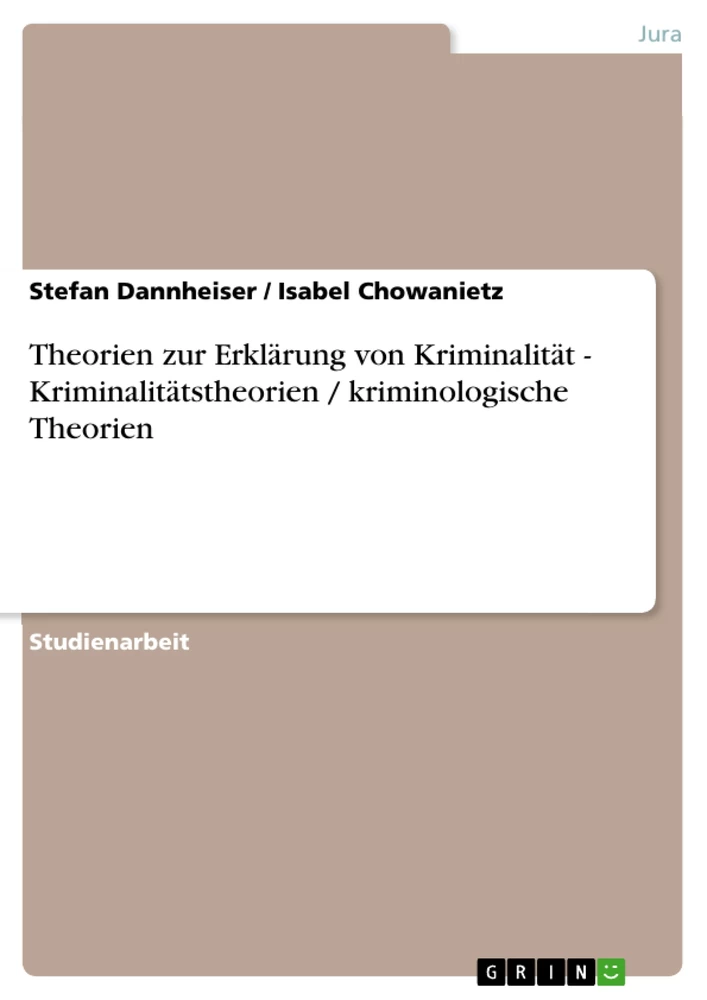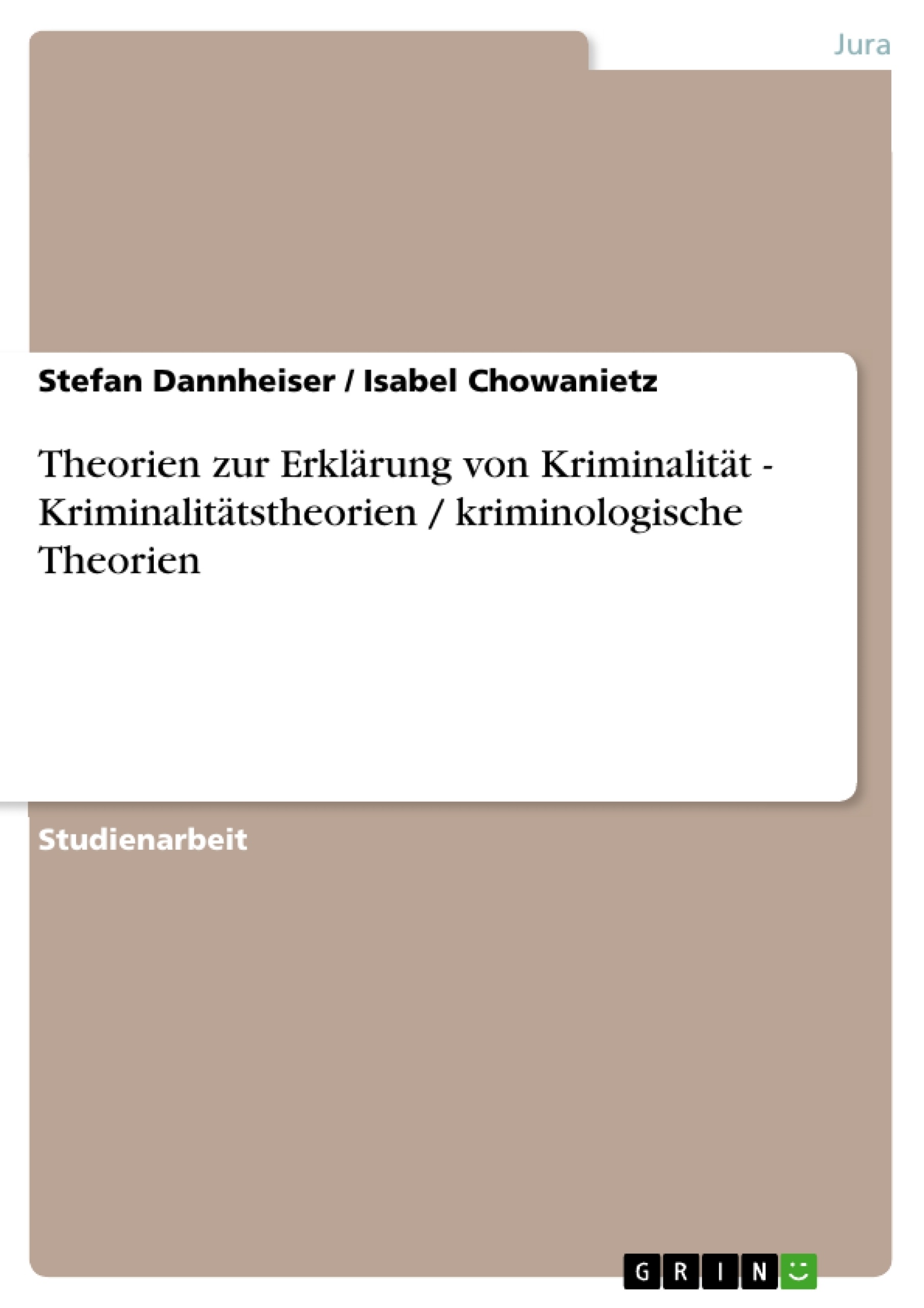In dem Seminar „Einführung in die Kriminologie“ unter der Leitung von W.M. Christian Behrens widmeten wir uns dem Begriff der Kriminologie an sich und den verschiedenen Erscheinungsformen der Kriminalität. Eingangs beschäftigten wir uns mit der Frage, wo der Ursprung der Kriminologie zu suchen sei, erörterten den Begriff des „Verbrechens“ und legten das Aufgabengebiet der Kriminologen fest. Wir erfuhren, dass die Kriminologie in vier Ebenen unterteilt werden kann (Tat, Täter, Opfer und Gesellschaft) und dass die Kriminologie zu den nichtjuristischen Kriminalwissenschaften gehört. Als Definition arbeiteten wir heraus, dass Kriminologie eine interdisziplinäre Tatsachenwissenschaft ist, die Tat, Täter und Opfer eines möglicherweise strafbaren Verhaltens, seine gesellschaftlichen Ursachen sowie die Reaktion auf Kriminalität durch Polizei und Justiz untersucht. Im weiteren Verlauf sprachen wir über die wichtige Stellung der Kriminalstatistik und über das damit verbundene Dunkelfeld. Anschließend widmeten wir uns den verschiedenen Formen der Kriminalität wie der Kinder- und Jugendkriminalität, der Ausländerkriminalität oder der Gewaltkriminalität. In der nun folgenden Ausarbeitung wollen wir verschiedene Theorien zur Erklärung von Kriminalität vorstellen. Nachdem wir eine kurze Einleitung in das Thema gegeben und die Aufgaben der Theorien geklärt haben, werden wir auf wichtige personenbezogene Theorien und Ansätze eingehen, diese näher erläutern und kritisch betrachten. Danach werden wir uns den gesellschaftsbezogenen Theorien und Ansätzen zuwenden, wichtige Vertreter dieser Richtung vorstellen und die einzelnen Theorien ebenfalls kritisch beleuchten. Ferner möchten wir uns vertiefend mit dem Thema „freier Wille“ auseinandersetzten und zum Abschluss die Theorien und Ansätze kritisch würdigen und ein Fazit ziehen. Die vorliegende Arbeit setzt sich wie folgt zusammen: Die Punkte 1; 3 - 3.1.2 sowie 4 - 5 wurden von Isabel Chowanietz, die Punkte 3.2 - 3.3.2.3; 6 von Stefan Dannheiser erarbeitet. Der übrige Punkt (2) entstand in gemeinsamer Zusammenarbeit. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Grundlagen und Theoriebegriff
- Personenbezogene Theorien und Ansätze
- Biologische Theorien / Anlagetheorien
- Lombroso
- Anlage-Umwelt-Theorie
- Psychologische Ansätze
- Psychoanalyse
- Freud
- „Sündenbocktheorie“
- Psychopathie und Soziopathie
- Psychoanalyse
- Sozialpsychologische Ansätze
- Lerntheorien
- differentielle Kontakte (n. Sutherland)
- differentielle Identifikation (n. Glaser)
- Differentielle Verstärkung (n. Burgess/Akers)
- Eysencks Kriminalitätstheorie
- Der Kontrollansatz (Halt- und Bindungstheorien)
- Reiss
- Reckless
- Hirschi
- Lerntheorien
- Biologische Theorien / Anlagetheorien
- Gesellschaftsbezogene Theorien und Ansätze
- Sozialstruktur und Kriminalität (Anomietheorie)
- n. Durkheim
- n. Merton
- Kultur und Kriminalität
- Theorie des Kulturkonflikts (n. Sellin)
- Subkulturtheorien
- n. Cloward u. Ohlin
- n. Cohen
- Sozialstruktur und Kriminalität (Anomietheorie)
- „Am Ende steht der freie Wille“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit verschiedenen Theorien zur Erklärung von Kriminalität. Sie analysiert und erläutert unterschiedliche Ansätze, sowohl auf individueller Ebene (personenbezogene Theorien) als auch auf gesellschaftsbezogener Ebene. Das Ziel ist es, die vielfältigen Perspektiven auf Kriminalität aufzuzeigen und ihre jeweiligen Stärken und Schwächen zu beleuchten.
- Biologische und psychologische Faktoren als Einflussfaktoren auf Kriminalität
- Sozialpsychologische Lerntheorien und Kontrollansätze
- Anomietheorie und die Rolle von Sozialstruktur und Kriminalität
- Kulturkonflikt und Subkulturtheorien als Erklärungen für Kriminalität
- Der „freie Wille“ als entscheidender Faktor in der Kriminalität
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Arbeit stellt den Kontext des Seminars „Einführung in die Kriminologie“ und die Thematik der Arbeit, nämlich die verschiedenen Theorien zur Erklärung von Kriminalität, vor. Sie skizziert den Aufbau und die Inhalte der folgenden Kapitel.
- Grundlagen und Theoriebegriff: Dieses Kapitel beleuchtet den Begriff der Kriminalität, die verschiedenen Perspektiven auf Normabweichung und die Rolle des Willens. Es analysiert drei Hauptströme (Determinismus, Indeterminismus, relativer Indeterminismus) und die Bedeutung von Theorien in der Kriminologie.
- Personenbezogene Theorien und Ansätze: Dieses Kapitel befasst sich mit Theorien, die Kriminalität auf individuelle Faktoren zurückführen. Es werden biologische Theorien (Lombroso, Anlage-Umwelt-Theorie), psychologische Ansätze (Psychoanalyse, Psychopathie) und sozialpsychologische Lerntheorien und Kontrollansätze (Sutherland, Glaser, Burgess/Akers, Eysenck, Reiss, Reckless, Hirschi) vorgestellt.
- Gesellschaftsbezogene Theorien und Ansätze: Dieses Kapitel analysiert Theorien, die Kriminalität als Ergebnis gesellschaftlicher Faktoren betrachten. Es behandelt die Anomietheorie (Durkheim, Merton), die Theorie des Kulturkonflikts (Sellin) und Subkulturtheorien (Cloward/Ohlin, Cohen).
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Themen der Kriminologie. Wichtige Schlüsselwörter sind: Kriminalität, Normabweichung, Theorien, Personenbezogene Ansätze, Gesellschaftsbezogene Ansätze, Biologische Faktoren, Psychologische Faktoren, Lerntheorien, Kontrollansätze, Anomietheorie, Kulturkonflikt, Subkulturtheorien, freier Wille.
- Quote paper
- Dipl.-Sozialpäd. Stefan Dannheiser (Author), Isabel Chowanietz (Author), 2005, Theorien zur Erklärung von Kriminalität - Kriminalitätstheorien / kriminologische Theorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59658