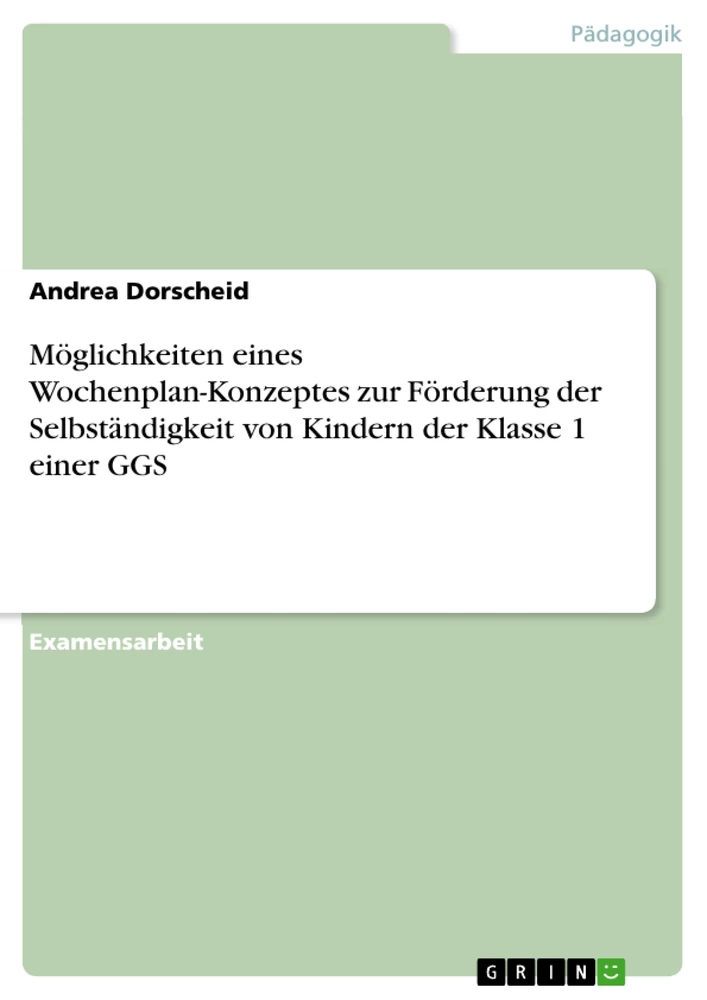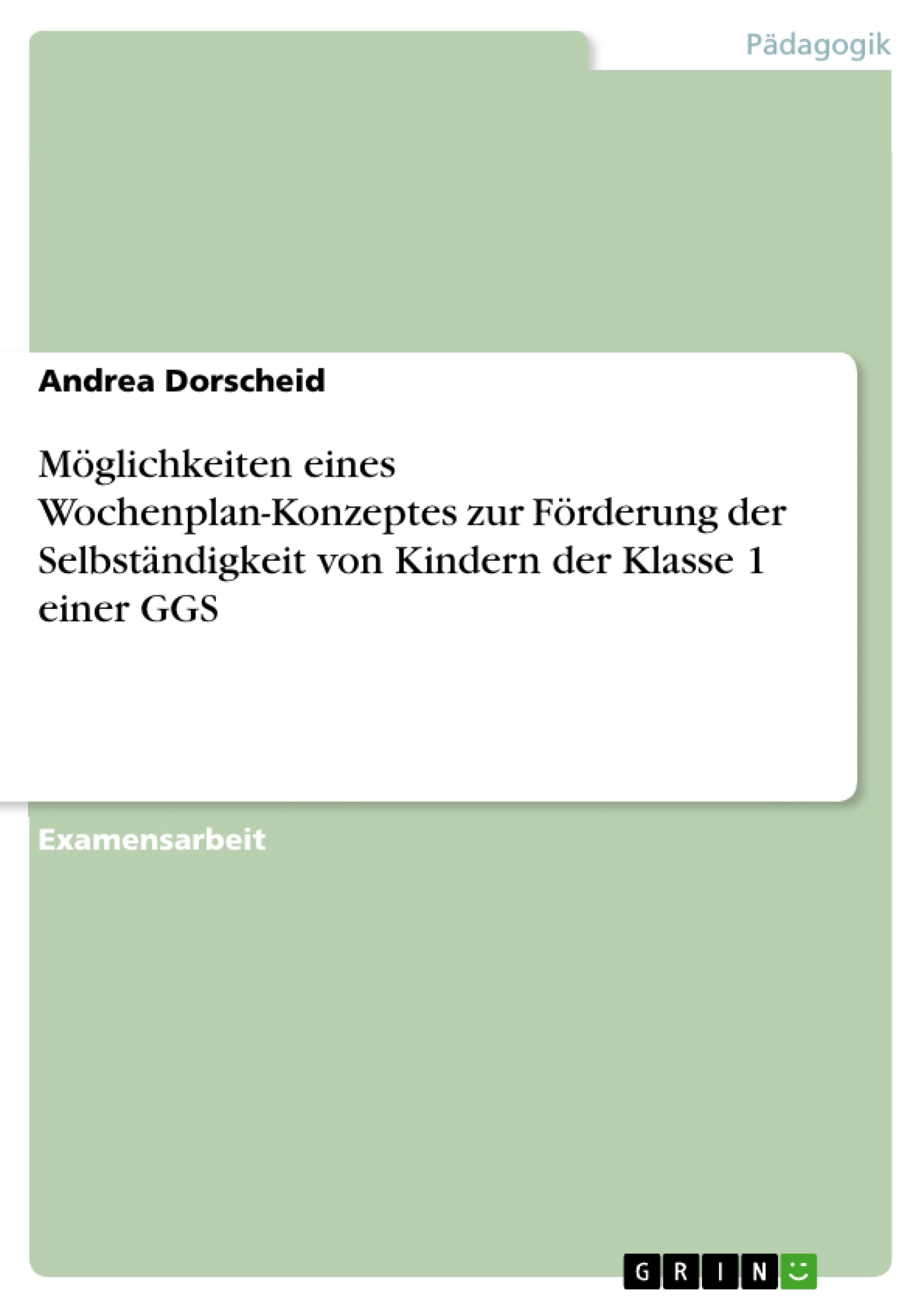Im Mittelpunkt aller pädagogischer Überlegungen und Anstrengungen steht das einzelne Kind mit seinen individuellen Besonderheiten, Interessen und Fähigkeiten. Die Richtlinien des Landes Nordrhein-Westfalen besagen deshalb, dass die Grundschule ihren Bildungs- und Erziehungsauftrag nur dann erfüllt, “wenn sie ihre Schülerinnen und Schüler als Kinder ernst nimmt und ihre jeweiligen Lebensbedingungen berücksichtigt. Sie darf für die Kinder nicht allein Unterrichtsstätte, sondern muß zugleich Lebens-, Lern- und Erfahrungsraum sein”. Dementsprechend sind in der pädagogischen Diskussion immer wieder Ziele wie Selbständigkeit, Selbststeuerung und die Mit- und Eigenverantwortung der Kinder für die Grundschule formuliert worden. Analog dazu fordern auch die Richtlinien einen differenzierten Unterricht, welcher “das bewußte, selbständige Lernen und Handeln jedes einzelnen Kindes” fördert und die Kinder dazu befähigt, “ihren Lernprozeß weitgehend selbständig zu planen und zu gestalten”. In der Klasse 1 der GGS X, in welcher ich seit Schuljahresbeginn sechs Stunden Sachunterricht und Sprache sowohl unter Anleitung als auch bedarfsdeckend unterrichte, haben die Klassenlehrerin Frau S. und ich auf verschiedene Weise versucht, diese pädagogischen Postulate zu berücksichtigen. Sowohl die tägliche freie Arbeit, Gruppen- und Partnerarbeit als auch das regelmäßige Arbeiten an Stationen sollten den Kindern von Anfang an die Möglichkeit bieten, die grundlegenden Ziele entsprechend ihren individuellen Lern- und Arbeitsvoraussetzungen, ihrer unterschiedlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Selbstkonzepten selbständig zu erreichen. Diese Versuche, den eigenen Unterricht “zu öffnen”, können jedoch nur als erster Schritt angesehen werden Es ist zwingend erforderlich, sie durch weitere Unterrichtsformen, welche den Kindern kontinuierlich Raum für selbständiges Lernen und für eigenverantwortliches Handeln überlassen, zu erweitern und auszubauen. Zwar gelingt es einigen Kindern der Klasse 1 während der Bearbeitung eines Stationenbetriebes bereits zunehmend, ihre Arbeitszeit selbst einzuteilen, die Reihenfolge von Arbeiten selbst zu bestimmen und mit verschiedenen Partnern zu kooperieren. [...]
Inhaltsverzeichnis
- A. EINLEITUNG
- B. WOCHENPLANUNTERRICHT IN DER PRIMARSTUFE
- I. Was ist ein Wochenplan?
- II. Ziele des Wochenplanunterrichtes
- C. ENTWICKLUNG EINES EIGENEN WOCHENPLAN-KONZEPTES ZUR FÖRDERUNG DER SELBSTÄNDIGKEIT DER KINDER DER KLASSE 1
- I. Voraussetzungen der Kinder im Hinblick auf das Vorhaben und die Zielsetzung
- II. Selbständigkeit als Zielsetzung des Wochenplan-Konzeptes
- III. Aufbau des Wochenplanes
- 1. Formaler Aufbau des Wochenplanes
- 2. Inhaltlicher Aufbau des Wochenplanes
- IV. Organisation des Wochenplanunterrichtes
- 1. Räumliche Voraussetzungen und Materialien
- 2. Zeit
- 3. Regeln im Wochenplanunterricht
- V. Die Rolle der Lehrerin
- D. DURCHFÜHRUNG DES ENTWICKELTEN WOCHENPLAN-KONZEPTES
- I. Die schrittweise Einführung
- 1. Verlauf der Einführung
- 2. Reflexion
- II. Die ersten Wochenpläne
- 1. Verlauf des Wochenplanunterrichtes
- 2. Reflexion
- I. Die schrittweise Einführung
- E. REFLEXION DES DURCHGEFÜHRTEN WOCHENPLAN-KONZEPTES – INWIEWEIT WURDE EINE FÖRDERUNG DER SELBSTÄNDIGKEIT ERREICHT?
- I. Gezielte Beobachtungen
- II. Aussagen der Kinder
- III. Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese schriftliche Hausarbeit befasst sich mit der Entwicklung und Implementierung eines Wochenplan-Konzeptes in der Klasse 1 einer Grundschule, um die Selbständigkeit der Kinder zu fördern. Das Ziel der Arbeit ist es, zu analysieren, inwieweit der Einsatz von Wochenplänen den Kindern ermöglicht, ihren Lernprozess selbständig zu planen und zu gestalten.
- Einführung des Wochenplan-Konzeptes in der Grundschule
- Förderung der Selbständigkeit der Kinder
- Entwicklung eines individuellen Wochenplan-Konzeptes
- Organisation und Durchführung des Wochenplanunterrichtes
- Reflexion der erreichten Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die die pädagogischen Hintergründe und die Bedeutung der Förderung der Selbständigkeit von Kindern im Grundschulalter beleuchtet. Kapitel B führt in das Thema Wochenplanunterricht in der Primarstufe ein und erläutert die grundlegenden Inhalte und Ziele dieses Unterrichtsformates.
In Kapitel C wird die Entwicklung eines eigenen Wochenplan-Konzeptes für die Klasse 1 der GGS X beschrieben. Dabei werden die Voraussetzungen der Kinder, die Zielsetzung des Konzeptes und die einzelnen Komponenten des Wochenplanes – vom formalen und inhaltlichen Aufbau bis hin zur Organisation und Durchführung – detailliert dargestellt. Die Rolle der Lehrerin im Wochenplanunterricht wird ebenfalls beleuchtet.
Kapitel D beschäftigt sich mit der schrittweisen Einführung des entwickelten Wochenplan-Konzeptes in die Klasse 1 und beschreibt den Verlauf der Einführungsphase, die Reflexion der ersten Wochenpläne sowie die Erfahrungen der Kinder im Wochenplanunterricht.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Wochenplanunterricht, Förderung der Selbständigkeit, Primarstufe, individuelles Lernen, Lernprozessgestaltung, Klassenführung, Reflexion, Unterrichtsorganisation.
- Arbeit zitieren
- Andrea Dorscheid (Autor:in), 2000, Möglichkeiten eines Wochenplan-Konzeptes zur Förderung der Selbständigkeit von Kindern der Klasse 1 einer GGS, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59565