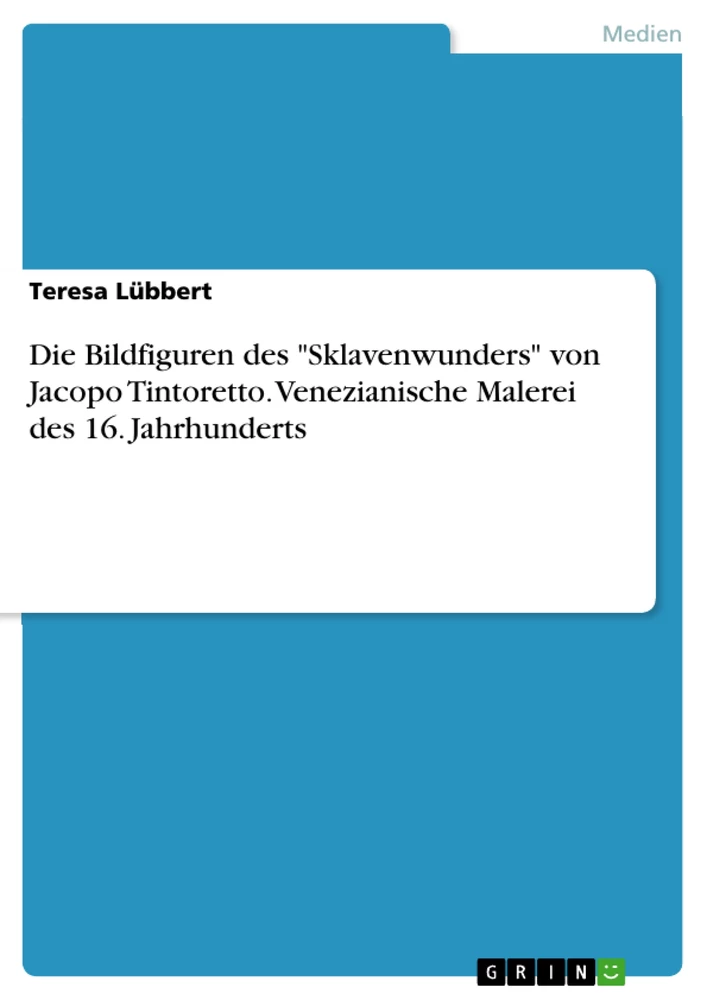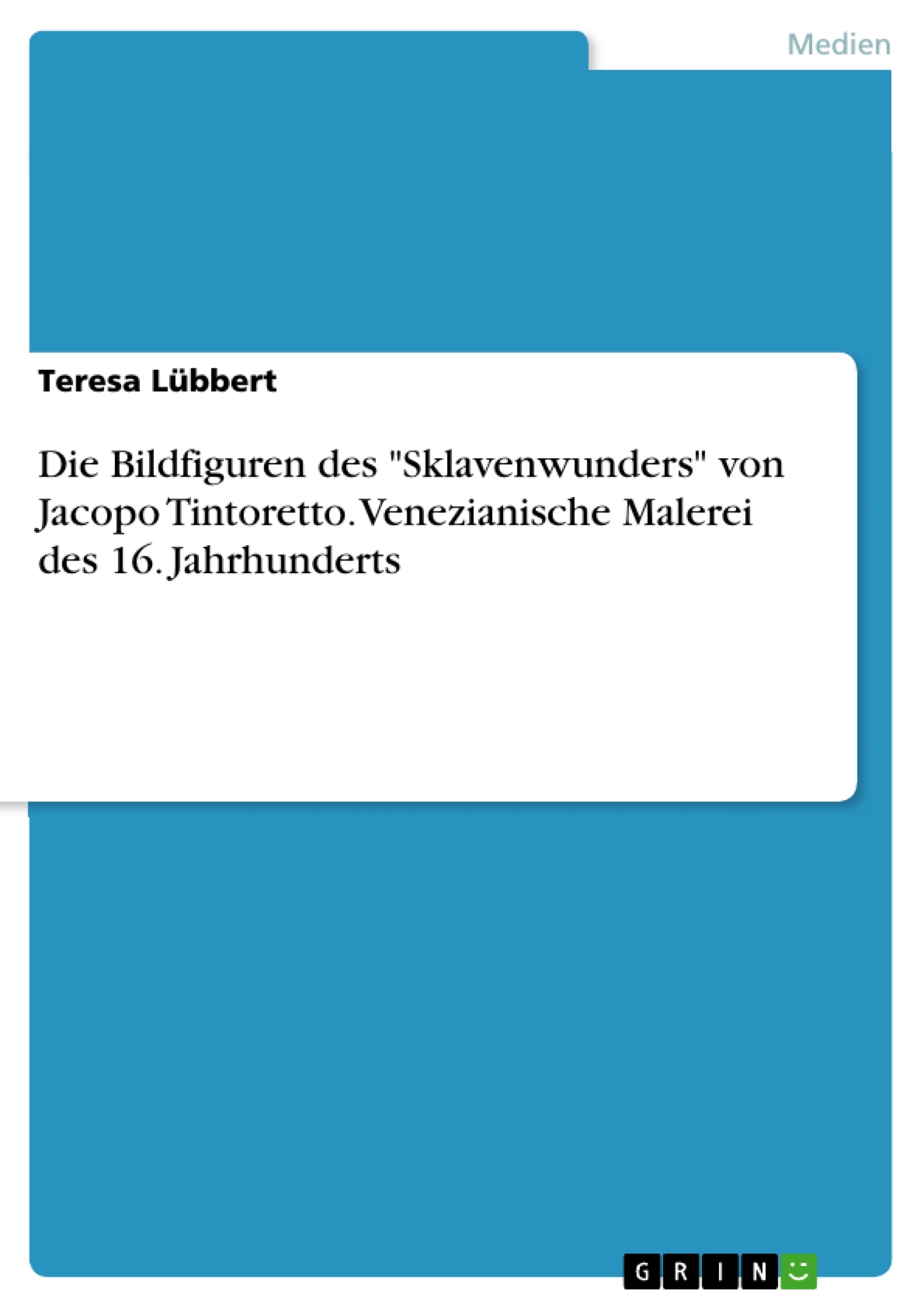In der Arbeit werden die Bildfiguren des „Sklavenwunders“, sowie deren Komposition genauer beschrieben. Jacopo Robusti, genannt Jacopo Tintoretto (* 29. September 1518 in Venedig; † 31. Mai 1594 in Venedig) war ein venezianischer Maler. Sein Name, welcher übersetzt so viel heißt wie „das Färberlein“, leitet sich von dem Handwerk seines Vaters ab.
Eines der berühmtesten Werke Tintorettos stellt das Gemälde „Das Wunder des hl. Markus“ (oder auch genannt „Sklavenwunder“) dar, welches Tintoretto im Auftrag der venezianischen Bruderschaft Scuola di San Marco malte und das ihm viel Lob einbrachte. Das „Sklavenwunder“ ist neben drei weiteren Auftragsbildern („Die Entführung der Leiche des hl. Markus“, „Die Auffindung der Leiche vom Hl. Markus“, „Der hl. Markus errettet einen Sarazenen“) für die Scuola di San Marco in das Frühwerk Tintorettos einzuordnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Das Sklavenwunder als Massenkomposition.
- 1.1. Vorbild: Andrea Mantegna
- 1.2. Vorbild: Andreas Vesalius
- 1.3. Vorbild: Tizian
- 1.4. Vorbild: Raffaello Santi
- 2. Die Frau mit Kind
- 3. Der stehende Scherge.
- 4. Der Sklave
- 5. Markus
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit befasst sich mit den Bildfiguren von Jacopo Tintorettos Gemälde „Das Wunder des hl. Markus“, auch bekannt als „Sklavenwunder“. Das Werk wurde im Auftrag der Scuola di San Marco in Venedig geschaffen und ist ein bedeutendes Beispiel für Tintorettos Frühwerk. Die Arbeit analysiert die Komposition des Gemäldes und beleuchtet die Gestaltung einzelner Figuren sowie deren Bezug zu Vorbildern anderer Künstler.
- Analyse der Komposition des "Sklavenwunders" und Vergleich mit Vorbildern
- Interpretation der Bildfiguren und deren Bedeutung im Kontext des Gemäldes
- Identifizierung von kunsthistorischen Einflüssen und Stilmerkmalen
- Zusammenhang zwischen der Darstellung und der Geschichte der Scuola di San Marco
- Bedeutung des "Sklavenwunders" innerhalb des Gesamtwerks von Tintoretto
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel befasst sich mit der Gesamtkomposition des Gemäldes und beleuchtet die verschiedenen Vorbilder, die Tintoretto für die Gestaltung des "Sklavenwunders" nutzte. Dabei werden Werke von Andrea Mantegna, Andreas Vesalius, Tizian und Raffaello Santi analysiert und ihre Einflüsse auf Tintorettos Komposition aufgezeigt.
Im zweiten Kapitel wird die Figur der Frau mit Kind untersucht. Ihre Positionierung im Bild, ihre Gestik und ihr Blick werden interpretiert. Der Zusammenhang zwischen der Figur und der christlichen Tugend der Karitas wird aufgezeigt.
Das dritte Kapitel analysiert die Gestalt des stehenden Schergen. Die Blickführung des Betrachters wird beschrieben und die Bedeutung des Schergen als Wendepunkt der dargestellten Ereignisse hervorgehoben. Darüber hinaus werden Vorbilder für die Figur des Schergen aus der Kunst Tizians und der Antike vorgestellt.
Im vierten Kapitel wird der liegende Sklave im Mittelpunkt der Betrachtung stehen. Die besondere Verkürzung des Körpers und die Verwendung der "figura serpentinata" werden analysiert und im Kontext der kunsthistorischen Entwicklungen betrachtet.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bildfiguren des „Sklavenwunders“ von Tintoretto. Dabei werden Themen wie Komposition, Vorbilder, Figureninterpretation, kunsthistorische Einflüsse, Stilmerkmale, christliche Symbolik und die Bedeutung des Kunstwerks im Kontext der Scuola di San Marco behandelt. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Massenkomposition, Vorbilder, Andrea Mantegna, Andreas Vesalius, Tizian, Raffaello Santi, Karitas, "figura serpentinata", Manierismus, Michelangelos "Conversione di Saulo", plastisches Hilfsmodell, Scuola di San Marco.
- Quote paper
- Teresa Lübbert (Author), 2013, Die Bildfiguren des "Sklavenwunders" von Jacopo Tintoretto. Venezianische Malerei des 16. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/594593