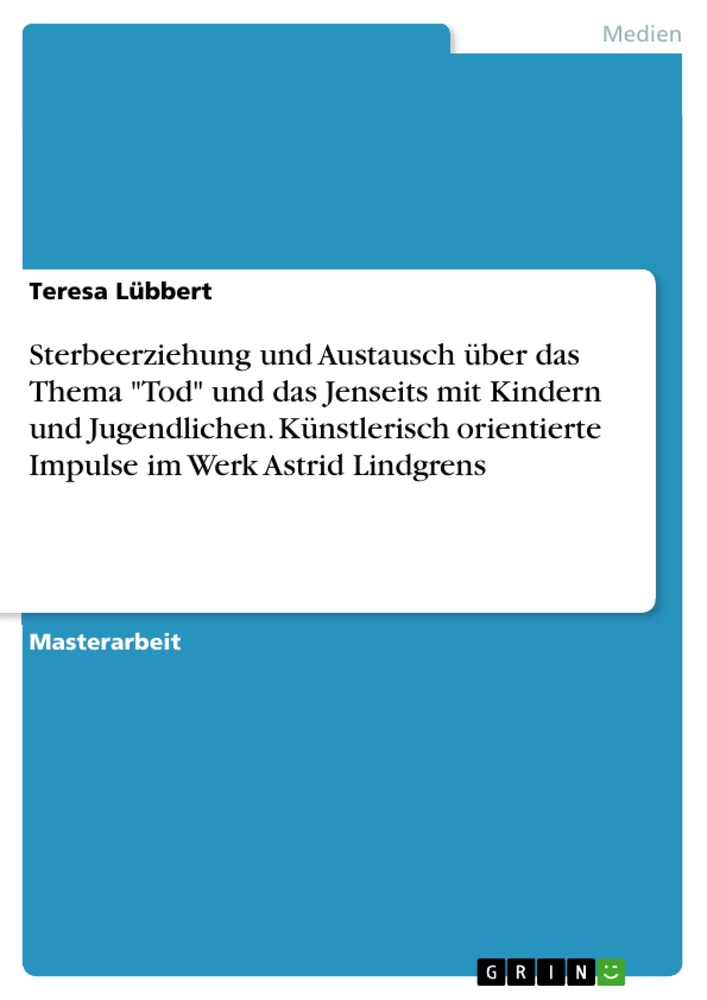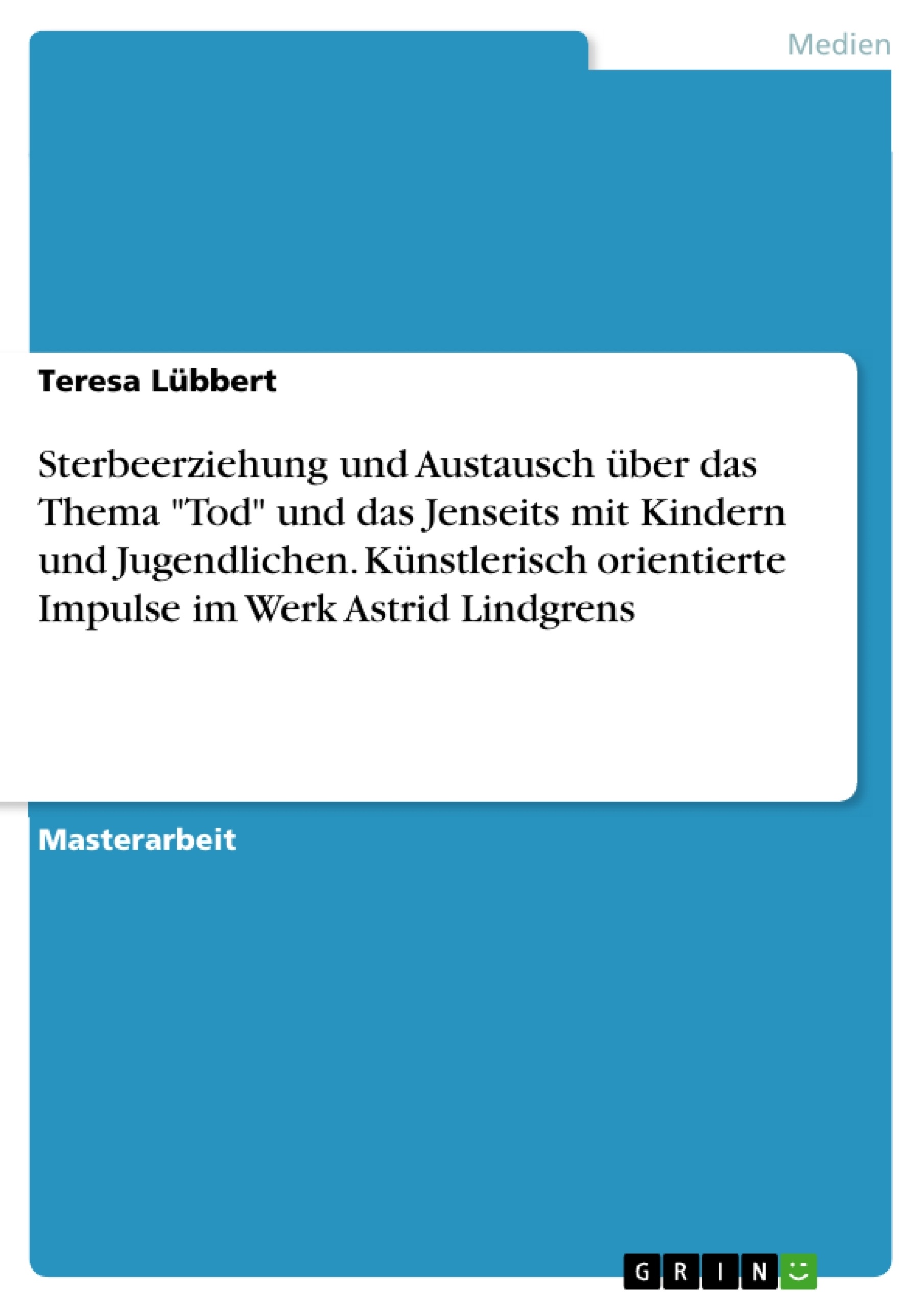Im Mittelpunkt dieser Arbeit stehen die folgenden Fragen: Wie vermittelt Lindgren solch schwierige Thematiken wie den Tod? Welche Vorstellungen vom Tod sowie dem Leben danach bietet und vermittelt sie ihren Leserinnen und Lesern und welche kindlichen oder religiösen Vorstellungen greift sie auf? Und wie lassen sich ihre Werke für eine einfühlsame künstlerisch orientierte Sterbeerziehung nutzbar machen? Um diese Fragen beantworten zu können werden im Folgenden fünf ausgewählte den Tod thematisierende Werke Lindgrens genauer betrachtet und auf die vermittelten Vorstellung sowie die Herangehensweisen Lindgrens hin analysiert.
Im Anschluss jeden Abschnittes werden Impulse für Gespräche über die jeweilige Geschichte Lindgrens und die damit in Zusammenhang stehenden Todeskonzepte sowie Vorstellungen vom Tod und Jenseits aufgeführt. Außerdem wird je eine künstlerische Aufgabe vorgeschlagen, die den Kindern eine hoffnungsvolle und persönliche Auseinandersetzung mit dem Tod ermöglichen soll. So könnte es ein Ziel sein, beispielsweise im Klassenverband, in Kleingruppen oder auch mit Einzelpersonen, durch die malerischen Auseinandersetzungen mit unterschiedlichen Vorstellungen von Tod und Jenseits, eine Wand zu gestalten, um die Vielfalt an gedanklichen Bildern sichtbar zu machen und solchen Kindern, die gerade keine Vorstellung und keinen Glauben haben, der sie tröstet, neue hoffnungsvolle Bilder und Sichtweisen anzubieten. Hierbei ist es für eine einfühlsame Sterbeerziehung zentral, dass kein Glaube aufgezwängt oder verteufelt wird, sondern jedes Kind dazu angeregt wird seine eigene individuelle Vorstellung vom Tod und Jenseits zu entwickeln.
Als Vorreitern näherte sich Astrid Lindgren bereits 1949 in ihrer Erzählung "Im Land der Dämmerung" dem zuvor "totgeschwiegenen" Thema Tod vorsichtig an. Als absoluten Tabubruch sahen 1973 viele Kritiker ihren Roman "Die Brüder Löwenherz". Seit Lindgrens Pionierwerk folgten viele weitere Kinder- und Jungendbücher, die die Thematik des Todes, des Sterbens und des Abschieds immer weiter aus seiner gesellschaftlichen Tabuzone rückten. So leistete Lindgren für die heutige Sterbeerziehung einen wichtigen Beitrag, indem sie zeigt, wie der Tod im Kinderbuch kindgerecht und einfühlsam aufbereitet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Weltdokumentenerbe
- 2. Todeskonzept und Sterbeerziehung
- 3. Die Todesthematik in Astrid Lindgrens Werken
- 3.1 Im Land der Dämmerung (1949)
- 3.2 Mio mein Mio (1954)
- 3.3 Klingt meine Linde (1959)
- 3.4 Die Brüder Löwenherz (1973)
- 3.5 Sonnenau (1980)
- 4. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Darstellung von Tod und Jenseits in den Werken Astrid Lindgrens und deren Eignung für eine künstlerisch orientierte Sterbebegleitung. Sie beleuchtet den Kontext des Weltdokumentenerbes und analysiert Lindgrens Konzept des Todes im Vergleich zu pädagogischen Ansätzen der Sterbebegleitung. Die Arbeit untersucht, wie Lindgren existenzielle Fragen kindgerecht und einfühlsam aufgreift.
- Astrid Lindgrens literarische Auseinandersetzung mit dem Tod und dem Jenseits.
- Der Vergleich von Lindgrens Darstellung mit aktuellen pädagogischen Ansätzen der Sterbebeziehung.
- Die Rolle des Weltdokumentenerbes und des Lindgren-Archivs in diesem Kontext.
- Die Eignung von Lindgrens Werken für die Sterbebegleitung von Kindern.
- Die Entwicklung des kindlichen Todeskonzeptes und die Bedeutung der Literatur dabei.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Weltdokumentenerbe: Dieses Kapitel beschreibt das internationale Netzwerk "Memory of the World" der UNESCO und den Eintrag des Lindgren-Archivs. Es wird hervorgehoben, dass das Archiv nicht nur die Manuskripte Lindgrens, sondern auch Zeugnis ihres Engagements für Kinderrechte darstellt, welches weit über den literarischen Bereich hinausreichte und die öffentliche Debatte beeinflusste. Die Aufnahme ins Weltdokumentenerbe unterstreicht die Bedeutung von Lindgrens Werk für die Weltkultur und ihr pädagogisches Potential.
2. Todeskonzept und Sterbeerziehung: Das Kapitel behandelt die Ambivalenz von Tod und Sterben – Angst und Faszination – und deren Entwicklung im Kindesalter. Es beschreibt das kindliche Todeskonzept als vierdimensionale Struktur (Nonfunktionalität, Irreversibilität, Kausalität, Universalität) und betont die Bedeutung von Erfahrung und Offenheit im Umgang mit dem Tod für die kindliche Entwicklung. Der Text kritisiert die Tabuisierung des Themas in der Vergangenheit und hebt die Bedeutung kindgerechter Literatur für die Auseinandersetzung mit dem Tod hervor, insbesondere im Vergleich zur repressiven Darstellung in der Kinderliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts, wo der Tod oft als Strafe dargestellt wurde.
Schlüsselwörter
Astrid Lindgren, Kinderliteratur, Tod, Sterben, Jenseits, Sterbebegleitung, Todeskonzept, Kinderrechte, Weltdokumentenerbe, Lindgren-Archiv, existenzielle Fragen, pädagogischer Ansatz.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse der Todesthematik in Astrid Lindgrens Werken
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit analysiert die Darstellung von Tod und Jenseits in den Werken Astrid Lindgrens und untersucht deren Eignung für eine künstlerisch orientierte Sterbebegleitung. Sie betrachtet den Kontext des Weltdokumentenerbes und vergleicht Lindgrens Todeskonzept mit pädagogischen Ansätzen der Sterbebegleitung. Ein Schwerpunkt liegt auf der kindgerechten und einfühlsamen Behandlung existentieller Fragen durch Lindgren.
Welche Werke von Astrid Lindgren werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Werke Astrid Lindgrens, darunter "Im Land der Dämmerung" (1949), "Mio, mein Mio" (1954), "Klingt meine Linde" (1959), "Die Brüder Löwenherz" (1973) und "Sonnenau" (1980).
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet Astrid Lindgrens literarische Auseinandersetzung mit Tod und Jenseits, vergleicht ihre Darstellung mit aktuellen pädagogischen Ansätzen der Sterbebegleitung, untersucht die Rolle des Weltdokumentenerbes und des Lindgren-Archivs, bewertet die Eignung von Lindgrens Werken für die Sterbebegleitung von Kindern und analysiert die Entwicklung des kindlichen Todeskonzeptes und die Bedeutung von Literatur dabei.
Welche Rolle spielt das Weltdokumentenerbe?
Das Kapitel über das Weltdokumentenerbe beschreibt die Bedeutung des Lindgren-Archivs als Teil des UNESCO-Netzwerks "Memory of the World". Es betont nicht nur die literarische Bedeutung der Manuskripte, sondern auch Lindgrens Engagement für Kinderrechte und deren Einfluss auf die öffentliche Debatte. Die Aufnahme ins Weltdokumentenerbe unterstreicht die globale Bedeutung von Lindgrens Werk und sein pädagogisches Potential.
Wie wird das Thema "Todeskonzept und Sterbeerziehung" behandelt?
Dieses Kapitel untersucht die Ambivalenz von Tod und Sterben im Kindesalter (Angst und Faszination), beschreibt das kindliche Todeskonzept als vierdimensionale Struktur (Nonfunktionalität, Irreversibilität, Kausalität, Universalität) und betont die Wichtigkeit von Erfahrung und Offenheit im Umgang mit dem Tod. Es kritisiert die frühere Tabuisierung des Themas und hebt die Bedeutung kindgerechter Literatur, insbesondere im Vergleich zur repressiven Darstellung des Todes in der Kinderliteratur des 18. und 19. Jahrhunderts, hervor.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Astrid Lindgren, Kinderliteratur, Tod, Sterben, Jenseits, Sterbebegleitung, Todeskonzept, Kinderrechte, Weltdokumentenerbe, Lindgren-Archiv, existenzielle Fragen, pädagogischer Ansatz.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu: Weltdokumentenerbe, Todeskonzept und Sterbeerziehung, die Todesthematik in Astrid Lindgrens Werken (mit Unterkapiteln zu einzelnen Werken) und ein Fazit.
- Quote paper
- Teresa Lübbert (Author), 2017, Sterbeerziehung und Austausch über das Thema "Tod" und das Jenseits mit Kindern und Jugendlichen. Künstlerisch orientierte Impulse im Werk Astrid Lindgrens, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/594582