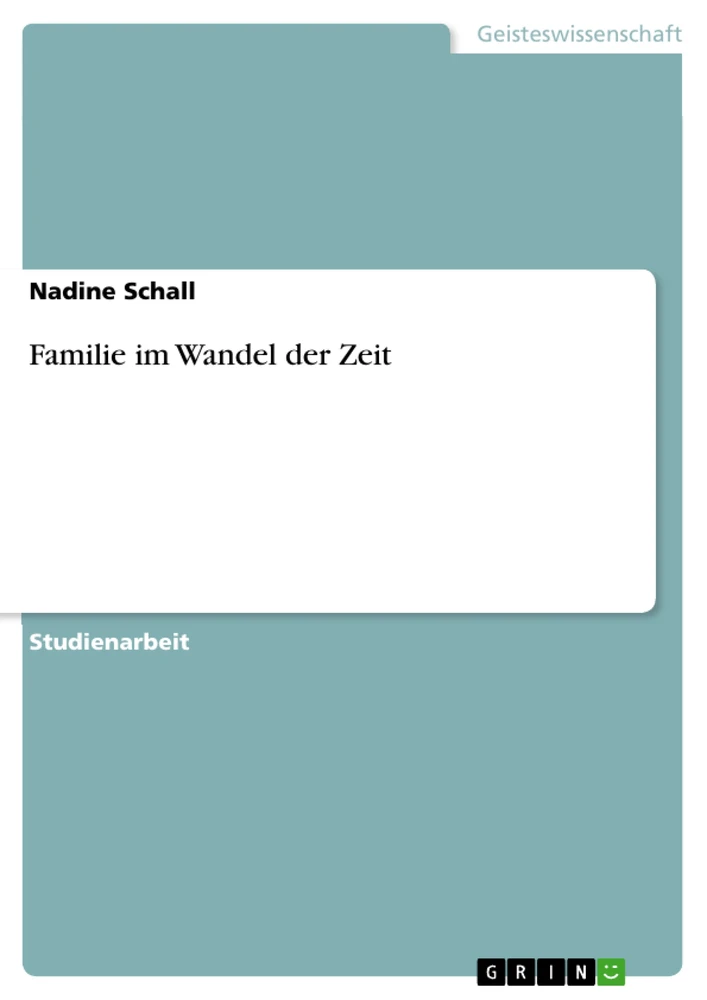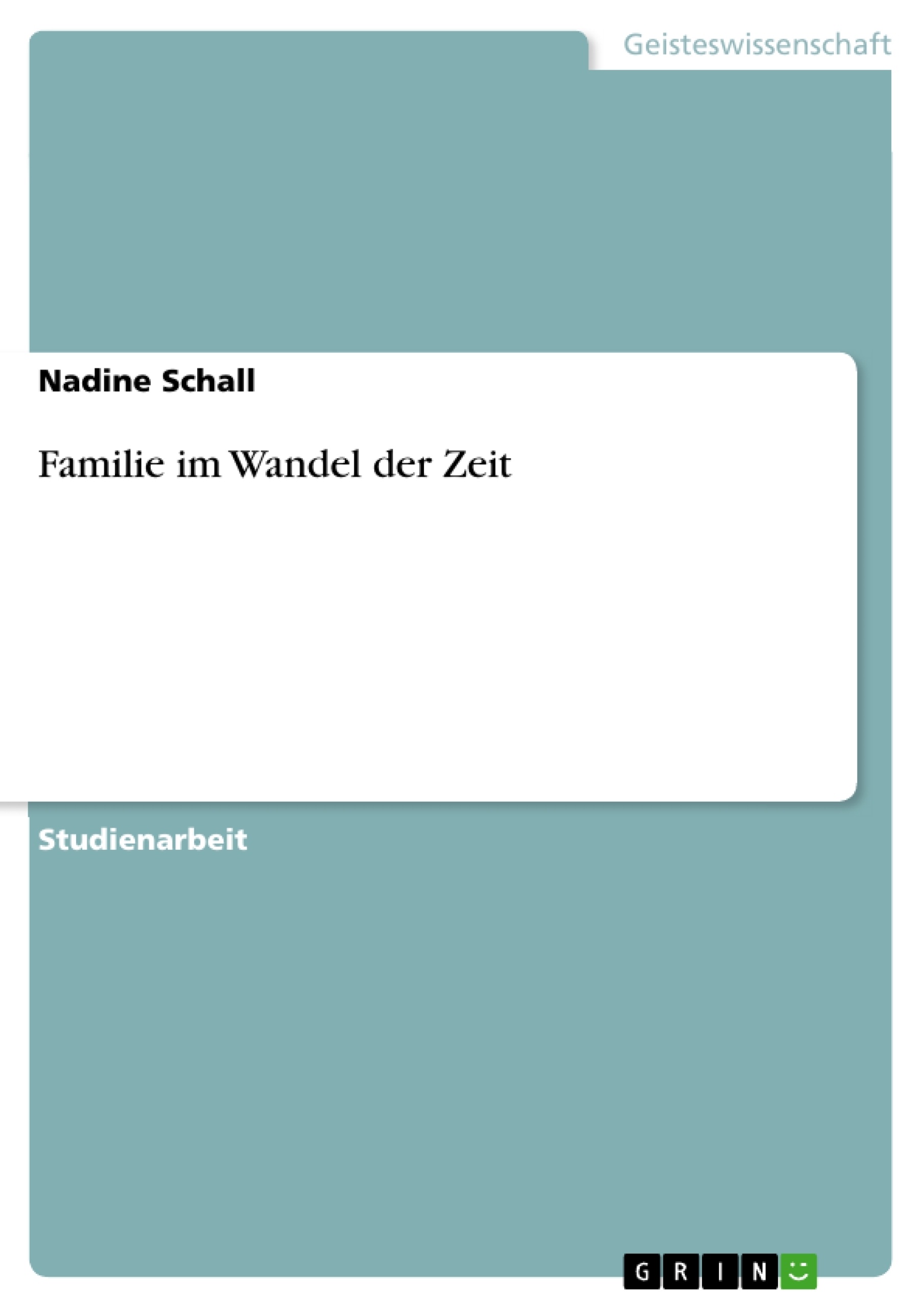Nahezu jeder Mensch wächst in einer Familie auf und wird durch sie geprägt. Sie ist die primäre Sozialisationsinstanz und spielt demnach eine große Bedeutung für alle Menschen. Wenn aber von Familie gesprochen wird, verbindet jeder etwas anderes damit. Sie wird nach vielen Kriterien differenziert, wie zum Beispiel Blutsverwandtschaft, Zusammensetzung der Familienmitglieder oder sozialem Zugehörigkeitsgefühl. Jeder hat also seine eigene Vorstellung einer Familie, wobei die meisten an dem Idealbild der Kernfamilie (Vater, Mutter und Kinder) festhalten. Gibt es aber auch eine von allen anerkannte, alles umfassende, einheitliche Definition des Begriffs Familie? Die Antwort lautet: nein.
Es existieren aber mehrere Ansätze, die versuchen, diesem Anspruch gerecht zu werden. Allerdings gelingt es keinem, alle Aspekte einer Familie zu berücksichtigen. Nun stellen sich neue Fragen: Seit wann gibt es den Familienbegriff schon? Was kennzeichnete eine Familie in früheren Zeiten und welche Bedeutung hatte sie? Auf diese Fragen wird im folgenden Hauptteil ausführlich eingegangen. Da dieses Thema jedoch sehr umfassend ist, wird es auf Deutschland ab dem 17. Jahrhundert spezialisiert. Außerdem wird für jeden Abschnitt einer Epoche eine soziale Schicht beschrieben, die beispielhaft und bedeutend für die jeweilige Zeit ist. Unter Berücksichtigung der Zusammensetzung der Familie, der Beziehungen der Familienmitglieder untereinander sowie der Arbeits- und Wohnsituation soll das Bild der Familie in den vergangenen Epochen verdeutlicht werden.
Damit die Darstellung der Familienentwicklung nicht aus ihrem Zusammenhang gerissen wird, steht sie zudem in ihrem geschichtlichen und gesellschaftlichen Kontext. Es gibt nämlich verschiedene Einflüsse, die auf Familien einwirken. Besonders eindrucksvoll wird dies durch das Ebenen-Modell von Bronfenbrenner deutlich. Er unterscheidet zwischen Mikro-, Meso-, Exo- und Makrosystemen. Die Familie stellt das Mikrosystem dar, "das eingebettet ist in übergreifende Systeme wie das Mesosystem (zum Beispiel Bekanntschafts-, Freundschafts- und Verwandtschaftsbeziehungen), das Exosystem (zum Beispiel Gemeindeorganisation, Unternehmensstruktur, Schulsystem) sowie das Makrosystem (zum Beispiel die kulturelle, politische, rechtliche oder wirtschaftliche Orientierung einer Gesellschaft)" (Oerter und Montada 1998).
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 „Familie“ im Wandel der Zeit
- 2.1 Das ganze Haus
- 2.2 Das bürgerliche Familienmodell
- 3 Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Entwicklung des Familienbegriffs in Deutschland vom 17. Jahrhundert bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf der Darstellung der Veränderungen in der Familienstruktur, den Beziehungen innerhalb der Familie und den sozioökonomischen Bedingungen, die diese Veränderungen beeinflusst haben. Die Arbeit beschränkt sich dabei exemplarisch auf bestimmte soziale Schichten.
- Wandel des Familienbegriffs im Laufe der Zeit
- Vergleich verschiedener Familienmodelle (bäuerliche Großfamilie vs. bürgerliche Kernfamilie)
- Einfluss von gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Faktoren auf die Familienstruktur
- Arbeitsteilung und Rollenverteilung innerhalb der Familie
- Rechtliche Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen auf die Familie
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beleuchtet die Vielschichtigkeit des Familienbegriffs. Sie verdeutlicht die Schwierigkeiten, eine allgemeingültige Definition zu finden und führt zwei beispielhafte Definitionen an, die jedoch den Aspekt der wahrgenommenen Familie nicht vollständig erfassen. Die Arbeit kündigt die Untersuchung der historischen Entwicklung des Familienbegriffs in Deutschland an, wobei der Fokus auf ausgewählte soziale Schichten und Epochen gelegt wird, um die Komplexität des Themas zu bewältigen. Der Bezug zum Ebenenmodell von Bronfenbrenner wird hergestellt, um die Einbettung der Familie in verschiedene soziale Systeme hervorzuheben.
2 „Familie“ im Wandel der Zeit: Dieser Abschnitt gliedert sich in zwei Unterkapitel, die jeweils verschiedene Familienmodelle und deren gesellschaftlichen Kontext beleuchten. Der Wandel des Familienbegriffs wird anhand von zwei zentralen Epochen untersucht. Im ersten Unterkapitel wird die bäuerliche Großfamilie des 17. bis 18. Jahrhunderts analysiert, wobei die Arbeitsteilung, die soziale Organisation des „ganzen Hauses“ und die Rolle der Kinder im Kontext der bäuerlichen Wirtschaft im Vordergrund stehen. Im zweiten Unterkapitel wird die Entstehung des bürgerlichen Familienmodells im ausgehenden 18. Jahrhundert erörtert. Hierbei werden die Veränderungen im Rechtsrahmen, die Privatisierung der Kernfamilie und das sich entwickelnde Familienidyll des Bildungsbürgertums untersucht.
Schlüsselwörter
Familie, Familienbegriff, Familienentwicklung, Familienmodell, bäuerliche Familie, bürgerliche Familie, Wandel, Gesellschaft, Geschichte, Deutschland, Sozialisation, Arbeitsteilung, Rollenverteilung, Rechtslage.
Häufig gestellte Fragen zur Hausarbeit: Entwicklung des Familienbegriffs in Deutschland (17.-18. Jahrhundert)
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die Entwicklung des Familienbegriffs in Deutschland vom 17. bis zum ausgehenden 18. Jahrhundert. Der Fokus liegt auf den Veränderungen der Familienstruktur, den Beziehungen innerhalb der Familie und den sozioökonomischen Einflüssen auf diese Veränderungen. Die Arbeit konzentriert sich exemplarisch auf bestimmte soziale Schichten.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel des Familienbegriffs im Laufe der Zeit, vergleicht bäuerliche Großfamilien mit bürgerlichen Kernfamilien, untersucht den Einfluss gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Faktoren auf die Familienstruktur, analysiert Arbeitsteilung und Rollenverteilung innerhalb der Familie und beleuchtet die rechtlichen Rahmenbedingungen und deren Auswirkungen.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit besteht aus einer Einleitung, einem Hauptteil mit zwei Unterkapiteln ("Das ganze Haus" und "Das bürgerliche Familienmodell") und einem Schluss. Die Einleitung führt in das Thema ein und erläutert die Komplexität des Familienbegriffs. Der Hauptteil analysiert die bäuerliche Großfamilie des 17. bis 18. Jahrhunderts und die Entstehung des bürgerlichen Familienmodells im ausgehenden 18. Jahrhundert. Der Schluss fasst die Ergebnisse zusammen.
Wie wird der Familienbegriff in der Einleitung definiert?
Die Einleitung betont die Vielschichtigkeit des Familienbegriffs und die Schwierigkeit, eine allgemeingültige Definition zu finden. Sie präsentiert beispielhafte Definitionen, weist aber auf deren Unvollständigkeit hin, insbesondere hinsichtlich der wahrgenommenen Familie. Es wird der Bezug zum Ebenenmodell von Bronfenbrenner hergestellt, um die Einbettung der Familie in verschiedene soziale Systeme zu verdeutlichen.
Was wird in Kapitel 2, Unterkapitel 2.1 ("Das ganze Haus") behandelt?
Unterkapitel 2.1 analysiert die bäuerliche Großfamilie des 17. bis 18. Jahrhunderts. Schwerpunkte sind die Arbeitsteilung, die soziale Organisation des „ganzen Hauses“ und die Rolle der Kinder im Kontext der bäuerlichen Wirtschaft.
Was wird in Kapitel 2, Unterkapitel 2.2 ("Das bürgerliche Familienmodell") behandelt?
Unterkapitel 2.2 erörtert die Entstehung des bürgerlichen Familienmodells im ausgehenden 18. Jahrhundert. Es werden Veränderungen im Rechtsrahmen, die Privatisierung der Kernfamilie und das sich entwickelnde Familienidyll des Bildungsbürgertums untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Familie, Familienbegriff, Familienentwicklung, Familienmodell, bäuerliche Familie, bürgerliche Familie, Wandel, Gesellschaft, Geschichte, Deutschland, Sozialisation, Arbeitsteilung, Rollenverteilung, Rechtslage.
Welche Zielsetzung verfolgt die Hausarbeit?
Die Zielsetzung der Hausarbeit ist die Untersuchung der Entwicklung des Familienbegriffs in Deutschland vom 17. bis zum 18. Jahrhundert, unter Berücksichtigung der Veränderungen in der Familienstruktur, den Beziehungen innerhalb der Familie und den sozioökonomischen Bedingungen, die diese Veränderungen beeinflusst haben.
- Quote paper
- Nadine Schall (Author), 2009, Familie im Wandel der Zeit, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/594033