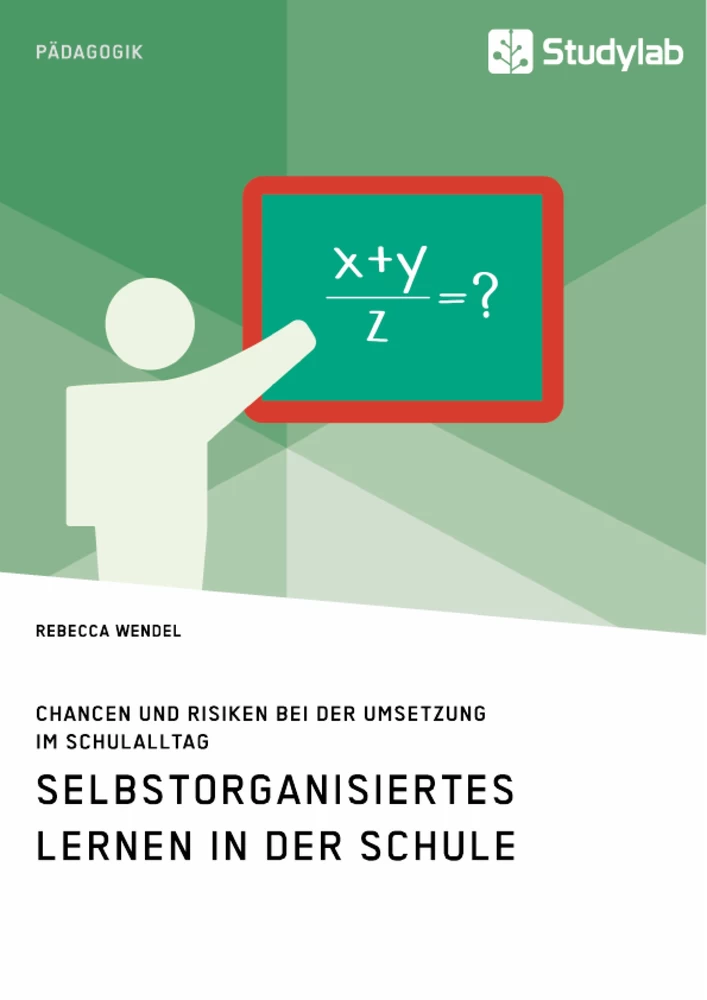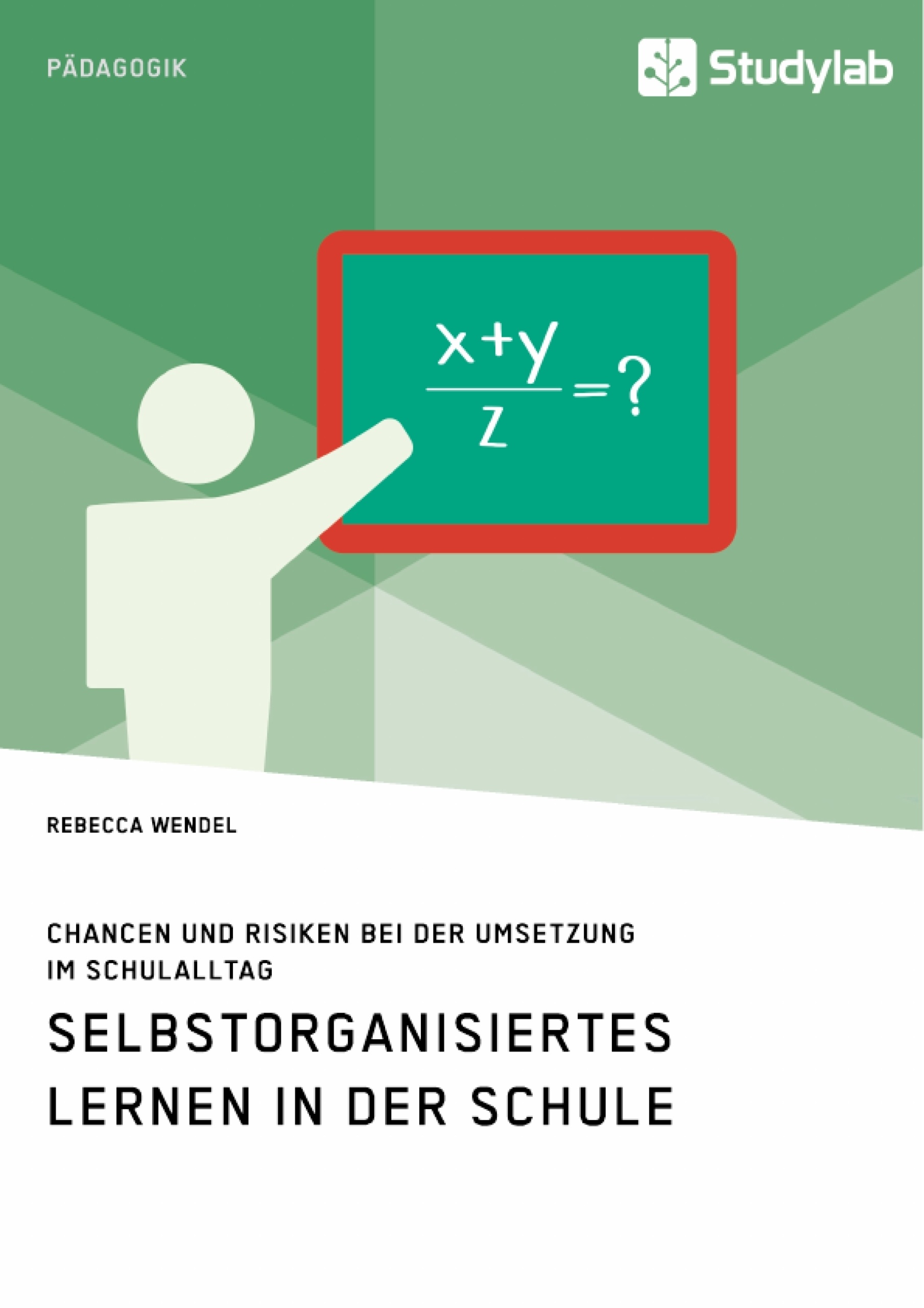In der Schule üben sich Schüler*Innen im selbstständigen Lernen. Selbstorganisation, Selbststeuerung und Selbstbestimmung spielen dabei eine zentrale Rolle. Das Konzept des Selbstorganisierten Lernens ist für Lehrende eine Möglichkeit, Schüler*Innen zu motivieren und zu einem erfolgreichen Lernen zu verhelfen.
Aber wie gelingt die Umsetzung des Selbstorganisierten Lernens in der Schule? Welche Chancen ergeben sich für die Schüler*Innen? Und welche Nachteile und Risiken birgt das Konzept des Selbstorganisierten Lernens?
Rebecca Wendel stellt in ihrer Publikation das Konzept des Selbstorganisierten Lernens dar. Dabei zeigt sie auf, wie Lehrende das Konzept erfolgreich in den schulischen Alltag integrieren und wie Schüler*Innen durch die Anwendung an Kompetenz und Eigenverantwortung gewinnen.
Aus dem Inhalt:
- Schulalltag;
- Selbstorganisation;
- Lernprozess;
- Schüler;
- Didaktik;
- Kooperatives Lernen
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Theoretische Grundlagen
- 2.1 Fraktale als Organisationsform und lebende Systeme
- 2.2 Zum Begriff SOL
- 3 Selbstorganisiertes Lernen in der Praxis
- 3.1 Der Advance Organizer
- 3.2 Das Gruppenpuzzle und das Sandwichprinzip
- 3.3 Autonomie, Eingebundensein und Erfolg
- 3.4 Weitere didaktisch-methodische Prinzipien
- 3.5 Rahmenbedingungen
- 4 Ziele Selbstorganisierten Lernens und potentielle Gefahren
- 4.1 Empirische Befunde zu Selbstorganisiertem Lernen
- 5 Qualitative Inhaltsanalyse
- 5.1 Begründung der Forschungsmethode
- 5.2 Methode
- 5.3 Analysetechnik und Ablaufmodell
- 6 Zusammenstellung der Ergebnisse
- 6.1 Hauptkategorie 1: Begriffsverständnis
- 6.2 Hauptkategorie 2: Verankerung innerhalb der Einzelschule
- 6.3 Hauptkategorie 3: Ziele
- 6.4 Hauptkategorie 4: Chancen
- 6.5 Hauptkategorie 5: Risiken
- 6.6 Hauptkategorie 6: Bedingungen
- 7 Diskussion der Ergebnisse
- 7.1 Diskussion Hypothese 1
- 7.2 Diskussion Hypothese 2
- 7.3 Diskussion Hypothese 3
- 7.4 Diskussion Hypothese 4
- 7.5 Diskussion Hypothese 5
- 7.6 Gütekriterien
- 7.7 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Masterarbeit untersucht die Umsetzung von Selbstorganisiertem Lernen (SOL) in der Schule. Ziel ist es, SOL zu definieren, von ähnlichen Konzepten abzugrenzen und die praktische Umsetzung im Schulalltag zu beschreiben. Dabei werden Chancen und Risiken für Lehrer, Schüler und das Bildungssystem analysiert. Die Forschungsfrage lautet: Wie gelingt die Umsetzung Selbstorganisierten Lernens in der Schule und welche Chancen und Risiken ergeben sich dabei?
- Definition und Abgrenzung von Selbstorganisiertem Lernen
- Praktische Umsetzung von SOL im Schulalltag
- Chancen von SOL für Schüler und Lehrer
- Risiken und Herausforderungen bei der Umsetzung von SOL
- Bedingungen für eine erfolgreiche Implementierung von SOL
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Selbstorganisiertes Lernen (SOL) ein und stellt die Forschungsfrage vor, die im Rahmen der Arbeit untersucht wird: Wie gelingt die Umsetzung Selbstorganisierten Lernens in der Schule und welche Chancen und Risiken ergeben sich dabei? Sie skizziert den Aufbau der Arbeit und gibt einen Überblick über die Methodik.
2 Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis von SOL. Es definiert den Begriff und grenzt ihn von verwandten Konzepten ab. Es beleuchtet relevante Theorien und Modelle, die das Verständnis von selbstgesteuerten Lernprozessen im schulischen Kontext ermöglichen. Der Fokus liegt auf der Klärung der Begrifflichkeiten und der Schaffung einer gemeinsamen Basis für die weitere Analyse.
3 Selbstorganisiertes Lernen in der Praxis: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene methodische Ansätze und Prinzipien zur praktischen Umsetzung von SOL im Unterricht. Es werden konkrete Beispiele wie der Advance Organizer, das Gruppenpuzzle und das Sandwichprinzip vorgestellt und deren Anwendung im schulischen Kontext erläutert. Der Abschnitt beleuchtet zudem die notwendigen Rahmenbedingungen und die Rolle der Lehrkraft bei der Gestaltung und Begleitung selbstorganisierten Lernens.
4 Ziele Selbstorganisierten Lernens und potentielle Gefahren: Dieses Kapitel beleuchtet die angestrebten Ziele von SOL und diskutiert mögliche Risiken und Herausforderungen bei der Implementierung. Es werden empirische Befunde präsentiert, die den Erfolg und die potenziellen Probleme von SOL belegen. Der Fokus liegt auf der Abwägung der Chancen und Risiken, um ein realistisches Bild der Methode zu vermitteln.
5 Qualitative Inhaltsanalyse: In diesem Kapitel wird die gewählte Forschungsmethode, die qualitative Inhaltsanalyse, detailliert beschrieben und begründet. Es wird der Ablauf der Analyse, die verwendeten Techniken und das zugrundeliegende Analysemdell erklärt. Dieser Teil dient der Transparenz und Nachvollziehbarkeit der Ergebnisse.
6 Zusammenstellung der Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse, strukturiert nach verschiedenen Hauptkategorien. Es fasst die Befunde der Experteninterviews zusammen und beleuchtet die verschiedenen Aspekte von SOL, wie Begriffsverständnis, Verankerung in der Schule, Ziele, Chancen, Risiken und Bedingungen.
Schlüsselwörter
Selbstorganisiertes Lernen (SOL), Selbstgesteuertes Lernen, Selbstbestimmtes Lernen, Schulalltag, didaktische Prinzipien, qualitative Inhaltsanalyse, Experteninterviews, Chancen, Risiken, Kompetenzentwicklung, Schülerautonomie, Lehrerrolle, methodische Ansätze.
Häufig gestellte Fragen zur Masterarbeit: Selbstorganisiertes Lernen (SOL) in der Schule
Was ist der Gegenstand der Masterarbeit?
Die Masterarbeit untersucht die Umsetzung von Selbstorganisiertem Lernen (SOL) in der Schule. Sie befasst sich mit der Definition und Abgrenzung von SOL, der praktischen Umsetzung im Schulalltag, den Chancen und Risiken für Lehrer, Schüler und das Bildungssystem sowie den Bedingungen für eine erfolgreiche Implementierung.
Welche Forschungsfrage wird behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Wie gelingt die Umsetzung Selbstorganisierten Lernens in der Schule und welche Chancen und Risiken ergeben sich dabei?
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung, Theoretische Grundlagen, Selbstorganisiertes Lernen in der Praxis, Ziele Selbstorganisierten Lernens und potentielle Gefahren, Qualitative Inhaltsanalyse, Zusammenstellung der Ergebnisse und Diskussion der Ergebnisse. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt der Forschungsfrage.
Was sind die theoretischen Grundlagen der Arbeit?
Kapitel 2 legt die theoretischen Grundlagen für das Verständnis von SOL dar. Es definiert den Begriff, grenzt ihn von ähnlichen Konzepten ab und beleuchtet relevante Theorien und Modelle zu selbstgesteuerten Lernprozessen im schulischen Kontext.
Wie wird SOL in der Praxis umgesetzt?
Kapitel 3 beschreibt methodische Ansätze und Prinzipien zur praktischen Umsetzung von SOL im Unterricht. Es werden konkrete Beispiele wie der Advance Organizer, das Gruppenpuzzle und das Sandwichprinzip vorgestellt und deren Anwendung erläutert. Die notwendigen Rahmenbedingungen und die Rolle der Lehrkraft werden ebenfalls beleuchtet.
Welche Ziele und potenziellen Gefahren von SOL werden betrachtet?
Kapitel 4 beleuchtet die angestrebten Ziele von SOL und diskutiert mögliche Risiken und Herausforderungen. Es werden empirische Befunde zum Erfolg und zu potenziellen Problemen präsentiert.
Welche Methode wurde zur Datenerhebung und -analyse verwendet?
Kapitel 5 beschreibt die qualitative Inhaltsanalyse als gewählte Forschungsmethode. Der Ablauf der Analyse, die verwendeten Techniken und das Analysemdell werden detailliert erklärt.
Wie werden die Ergebnisse der Studie präsentiert?
Kapitel 6 präsentiert die Ergebnisse der qualitativen Inhaltsanalyse, strukturiert nach Hauptkategorien wie Begriffsverständnis, Verankerung in der Schule, Ziele, Chancen, Risiken und Bedingungen.
Wie werden die Ergebnisse diskutiert?
Kapitel 7 diskutiert die Ergebnisse im Hinblick auf aufgestellte Hypothesen und beleuchtet die Gütekriterien der Studie. Es gibt außerdem einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen.
Welche Schlüsselwörter sind relevant für die Arbeit?
Relevante Schlüsselwörter sind: Selbstorganisiertes Lernen (SOL), Selbstgesteuertes Lernen, Selbstbestimmtes Lernen, Schulalltag, didaktische Prinzipien, qualitative Inhaltsanalyse, Experteninterviews, Chancen, Risiken, Kompetenzentwicklung, Schülerautonomie, Lehrerrolle, methodische Ansätze.
- Quote paper
- Rebecca Wendel (Author), 2021, Selbstorganisiertes Lernen in der Schule. Chancen und Risiken bei der Umsetzung im Schulalltag, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/593911