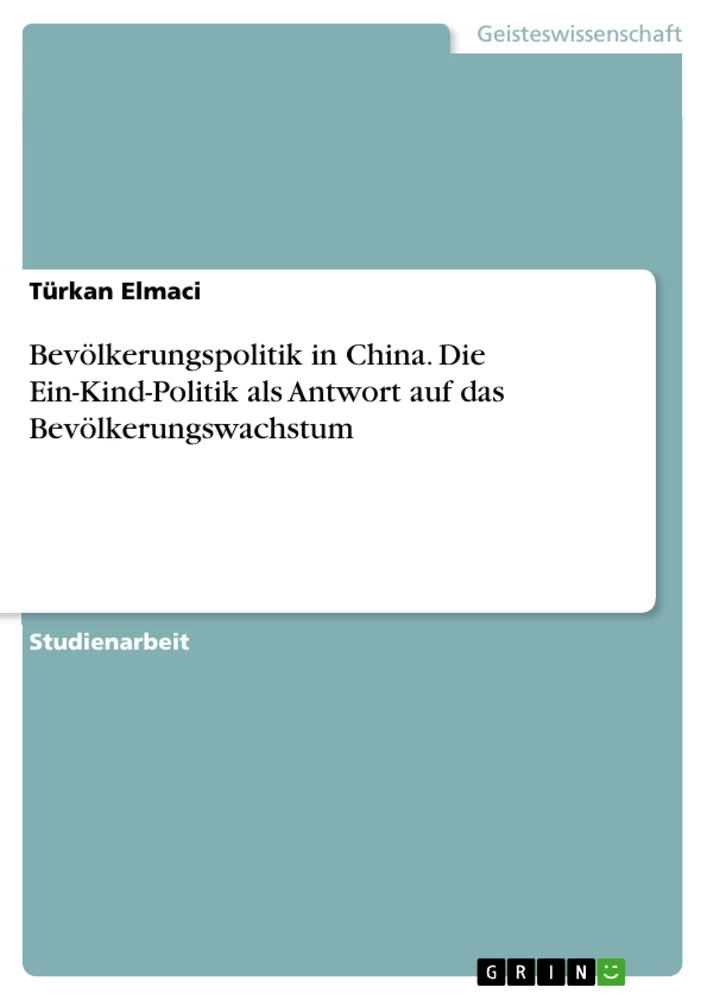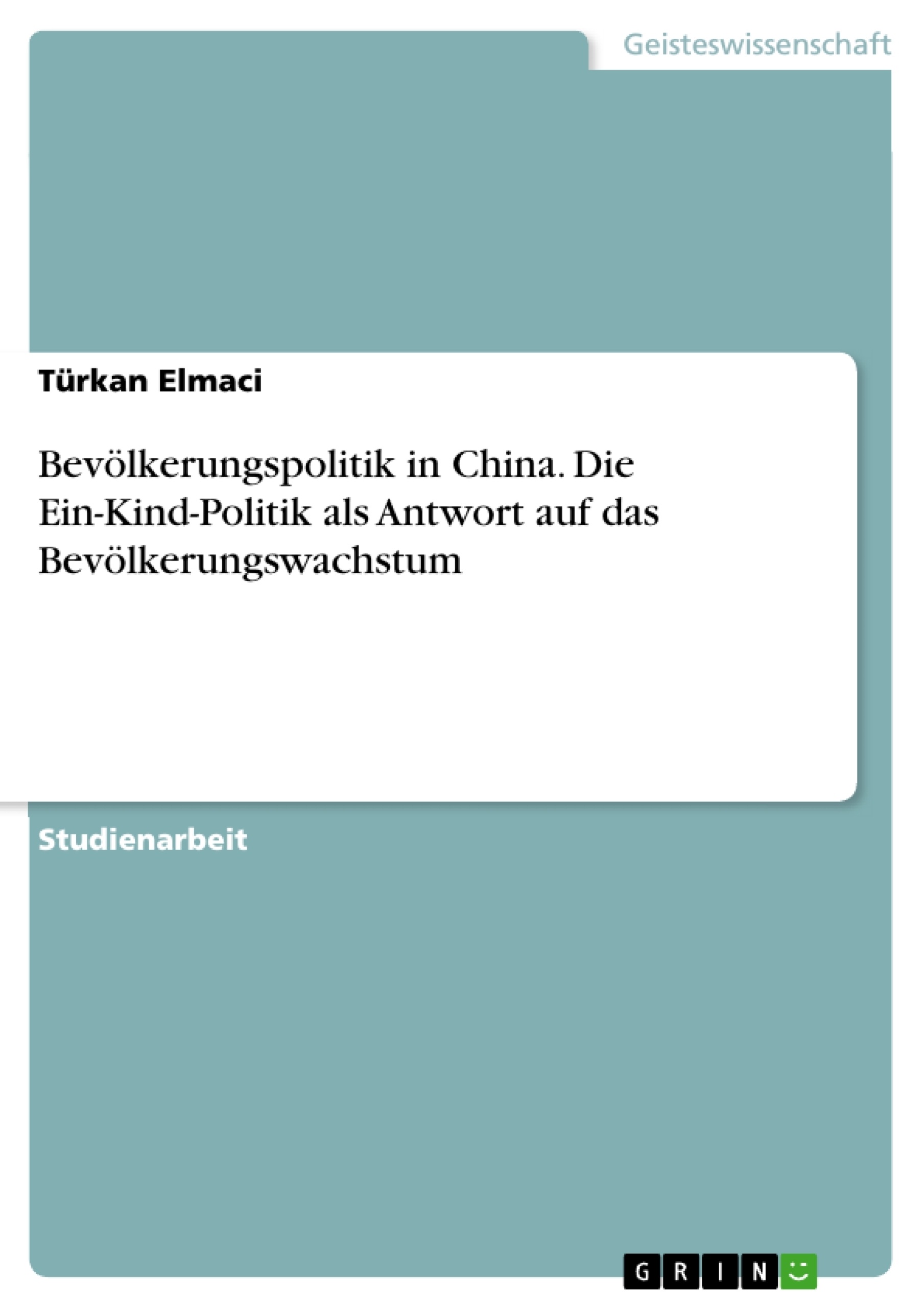Die Volksrepublik China gilt als das bevölkerungsreichste Land der Erde: mit ca. 1,3 Milliarden Menschen stellen die Chinesen 20,52 % der Weltbevölkerung dar. Das heißt, fast jeder fünfte Mensch ist ein Chinese. Diese Entwicklung ist eine Folge des starken Bevölkerungswachstums in China. (s. Abb. 1 und 2) Während in Deutschland seit längerer Zeit der Geburtenrückgang, vor allem im Hinblick auf die Altersversorgung, kritisiert wird, führte die hohe Bevölkerungszahl in der VR China zu massiven Wirtschafts- und Versorgungsproblemen. Daher versuchte man die anwachsende Bevölkerungszahl durch eine gezielte Familienplanungspolitik unter Kontrolle zu bringen. Waren in den frühen 50er Jahren Abtreibungen und Verhütungsmittel verboten, weil Geburtenplanung als imperialistisches Komplott und Mord am chinesischen Volk galt, startete 1954 langsam eine groß angelegte Kampagne zur Geburtenkontrolle. Diese wurde 1958 bereits beendet und erst nach einer großen Hungerkatastrophe begann ab 1963/64 eine zweite Geburtenplanungskampagne, in der Verhütungsmittel kostenlos abgegeben und Abtreibungen liberalisiert wurden. Ab 1971 wurde die dritte Geburtenplanungskampagne schrittweise durchgeführt und beinhaltete die Erhöhung des Heiratsalters und eine Zwei-Kind-Beschränkung sowie Planziffern für den Bevölkerungszuwachs. Ethnische Minderheiten waren von diesen Vorschriften nicht betroffen. 1 Mit Beginn der chinesischen Wirtschaftsreformen sahen die Chinesen die Überbevölkerung nun als Haupthindernis für die Modernisierung des Landes an und so startete Anfang der 80er Jahre eine Massenkampagne, die den Übergang von der Zwei-Kind- zur Ein-Kind-Politik beinhaltete. Die 1979 vom Nationalen Volkskongreß proklamierte Ein-Kind-Familie stellt heute die wichtigste und einschneidenste Methode der chinesischen Familienplanung dar.
Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, ob die Ein-Kind-Politik als Antwort auf das hohe Bevölkerungswachstum in China erfolgreich war. Dazu werden die Ursachen, die Durchsetzungsmethoden und -probleme sowie die Ergebnisse dieser Ein-Kin-Politik untersucht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ursachen für das Bevölkerungswachstum
- Wertevorstellung
- Bildungsstand der Eltern
- Kinder als Altersvorsorge
- Ein-Kind-Politik
- Maßnahmen zur Durchsetzung
- Sanktionen
- Belohnungen
- Durchsetzungsprobleme
- Folgen der Ein-Kind-Politik
- Geschlechterverhältnis
- Überalterung
- Ein-Kind-Politik versus Menschenrechte
- Maßnahmen zur Durchsetzung
- Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die chinesische Ein-Kind-Politik und bewertet ihren Erfolg als Antwort auf das hohe Bevölkerungswachstum. Die Analyse umfasst die Ursachen des Bevölkerungswachstums, die Methoden zur Durchsetzung der Ein-Kind-Politik, die damit verbundenen Probleme und schließlich die langfristigen Folgen dieser Politik.
- Ursachen des rasanten Bevölkerungswachstums in China vor Einführung der Ein-Kind-Politik
- Durchsetzung der Ein-Kind-Politik: Maßnahmen, Erfolge und Schwierigkeiten
- Folgen der Ein-Kind-Politik für die Geschlechterverteilung
- Sozioökonomische Auswirkungen der Ein-Kind-Politik
- Ethische und menschenrechtliche Aspekte der Ein-Kind-Politik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung stellt die Volksrepublik China als bevölkerungsreichstes Land der Erde vor und beschreibt das starke Bevölkerungswachstum als Ursache für wirtschaftliche und soziale Probleme. Sie führt verschiedene Phasen der chinesischen Geburtenkontrollpolitik vor der Einführung der Ein-Kind-Politik auf und benennt die Forschungsfrage der Arbeit: die Erfolgsbewertung der Ein-Kind-Politik als Antwort auf das Bevölkerungswachstum.
1. Ursachen des Bevölkerungswachstums: Dieses Kapitel untersucht die Ursachen des starken Bevölkerungswachstums in China. Es beleuchtet die pro-natalistische Politik Maos, traditionelle Wertevorstellungen, die den Wunsch nach vielen Söhnen betonen, den Einfluss des niedrigen Bildungsstands der Eltern auf die Kinderzahl und die Rolle von Kindern als Altersvorsorge in einem Land ohne umfassendes Rentensystem. Die Verknüpfung von Armut, geringem Bildungsstand und hoher Kinderzahl wird als Teufelskreis dargestellt, während der Wunsch nach Söhnen als Sicherung im Alter die Geschlechterungleichheit verdeutlicht.
2. Ein-Kind-Politik: Dieses Kapitel beschreibt die Ein-Kind-Politik in ihren verschiedenen Phasen. Es detailliert die Maßnahmen zur Durchsetzung, inklusive Sanktionen wie Lohnabzüge und Strafen, und Belohnungen wie finanzielle Anreize und bevorzugte Behandlung für Einzelkinder. Der Unterschied zwischen der Durchsetzung in Stadt und Land wird hervorgehoben, wobei die ländliche Bevölkerung aufgrund der Abhängigkeit von Söhnen als Altersvorsorge einem höheren Druck ausgesetzt war. Ausnahmegenehmigungen für Zweitkinder in verschiedenen Situationen werden ebenfalls erläutert.
2.2 Durchsetzungsprobleme der Ein-Kind-Politik: Dieses Kapitel analysiert die Probleme bei der Durchsetzung der Ein-Kind-Politik. Es beschreibt verschiedene Strategien der Bevölkerung, die Regelung zu umgehen, wie z.B. die Unterdrückung von Geburten, Adoptionen und die Registrierung als Angehörige ethnischer Minderheiten. Die mangelnde finanzielle Tragfähigkeit der Anreizsysteme und die nachlässige Verhütung werden als weitere Herausforderungen genannt. Die unzuverlässigen Daten und die fehlende Transparenz und Planungssicherheit aufgrund häufig wechselnder regionaler Vorschriften erschweren die Erfolgsmessung zusätzlich. Der höhere Geburtenzuwachs bei den ethnischen Minderheiten wird als weiterer Faktor beleuchtet.
2.3 Folgen der Ein-Kind-Politik: Dieses Kapitel untersucht die Folgen der Ein-Kind-Politik. Der Fokus liegt auf dem stark unausgewogenen Geschlechterverhältnis aufgrund von Abtreibungen weiblicher Föten und Tötungen weiblicher Säuglinge. Der Artikel analysiert die langfristigen sozialen und wirtschaftlichen Folgen dieses Missverhältnisses und beleuchtet das Problem der Überalterung der chinesischen Gesellschaft, obwohl dieses durch die teilweise Umgehung der Politik gemildert wurde. Schließlich werden ethische Bedenken und die Verletzung von Menschenrechten im Kontext der Zwangsmaßnahmen diskutiert.
Schlüsselwörter
Ein-Kind-Politik, Bevölkerungswachstum, China, Geburtenkontrolle, Familienplanung, Geschlechterverhältnis, Überalterung, Menschenrechte, Sozioökonomie, Bevölkerungspolitik, Traditionelle Werte, Wirtschaftliche Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen zur Ein-Kind-Politik Chinas
Was ist der Gegenstand dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über die chinesische Ein-Kind-Politik. Es enthält ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Stichwortverzeichnis. Der Fokus liegt auf der Analyse der Ursachen des Bevölkerungswachstums, der Durchsetzung der Politik, der damit verbundenen Probleme und der langfristigen Folgen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Themen: die Ursachen des rasanten Bevölkerungswachstums in China vor der Ein-Kind-Politik, die Durchsetzung der Ein-Kind-Politik inklusive der angewandten Maßnahmen, Erfolge und Schwierigkeiten, die Folgen der Ein-Kind-Politik für die Geschlechterverteilung, die sozioökonomischen Auswirkungen, sowie die ethischen und menschenrechtlichen Aspekte.
Welche Ursachen für das Bevölkerungswachstum in China werden genannt?
Das Dokument nennt verschiedene Ursachen: die pronatalistische Politik Maos, traditionelle Wertevorstellungen mit dem Wunsch nach vielen Söhnen, der niedrige Bildungsstand der Eltern und die Rolle von Kindern als Altersvorsorge in Abwesenheit eines umfassenden Rentensystems. Armut, geringer Bildungsstand und hohe Kinderzahl werden als Teufelskreis dargestellt, der Wunsch nach Söhnen verstärkt die Geschlechterungleichheit.
Wie wurde die Ein-Kind-Politik durchgesetzt?
Die Durchsetzung erfolgte mittels verschiedener Maßnahmen: Sanktionen wie Lohnabzüge und Strafen, und Belohnungen wie finanzielle Anreize und bevorzugte Behandlung für Einzelkinder. Die Durchsetzung unterschied sich zwischen Stadt und Land, wobei ländliche Bevölkerung aufgrund der Abhängigkeit von Söhnen stärker unter Druck stand. Ausnahmegenehmigungen für Zweitkinder wurden in bestimmten Situationen gewährt.
Gab es Probleme bei der Durchsetzung der Ein-Kind-Politik?
Ja, die Durchsetzung war mit Problemen behaftet. Die Bevölkerung fand Strategien, die Regelung zu umgehen (z.B. Unterdrückung von Geburten, Adoptionen, Registrierung als Angehörige ethnischer Minderheiten). Mangelnde finanzielle Tragfähigkeit der Anreizsysteme, nachlässige Verhütung, unzuverlässige Daten, fehlende Transparenz und häufig wechselnde regionale Vorschriften erschwerten die Erfolgsmessung. Der höhere Geburtenzuwachs bei ethnischen Minderheiten stellte ein weiteres Problem dar.
Welche Folgen hatte die Ein-Kind-Politik?
Die Ein-Kind-Politik führte zu einem stark unausgewogenen Geschlechterverhältnis aufgrund von Abtreibungen weiblicher Föten und Tötungen weiblicher Säuglinge. Langfristige soziale und wirtschaftliche Folgen dieses Missverhältnisses, sowie das Problem der Überalterung der chinesischen Gesellschaft (obwohl durch die teilweise Umgehung der Politik gemildert) werden analysiert. Ethische Bedenken und die Verletzung von Menschenrechten im Kontext der Zwangsmaßnahmen werden ebenfalls diskutiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht das Dokument?
Das Dokument bewertet den Erfolg der Ein-Kind-Politik als Antwort auf das hohe Bevölkerungswachstum Chinas. Die Zusammenfassung der Kapitel bietet detaillierte Einblicke in die Ursachen, die Durchsetzung und die Folgen der Politik. Die ethischen und menschenrechtlichen Aspekte werden kritisch beleuchtet. Ein Fazit und Ausblick fehlen in der vorliegenden Vorschau.
Welche Schlüsselwörter beschreiben das Dokument am besten?
Schlüsselwörter sind: Ein-Kind-Politik, Bevölkerungswachstum, China, Geburtenkontrolle, Familienplanung, Geschlechterverhältnis, Überalterung, Menschenrechte, Sozioökonomie, Bevölkerungspolitik, Traditionelle Werte, Wirtschaftliche Entwicklung.
- Arbeit zitieren
- Türkan Elmaci (Autor:in), 2005, Bevölkerungspolitik in China. Die Ein-Kind-Politik als Antwort auf das Bevölkerungswachstum, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59387