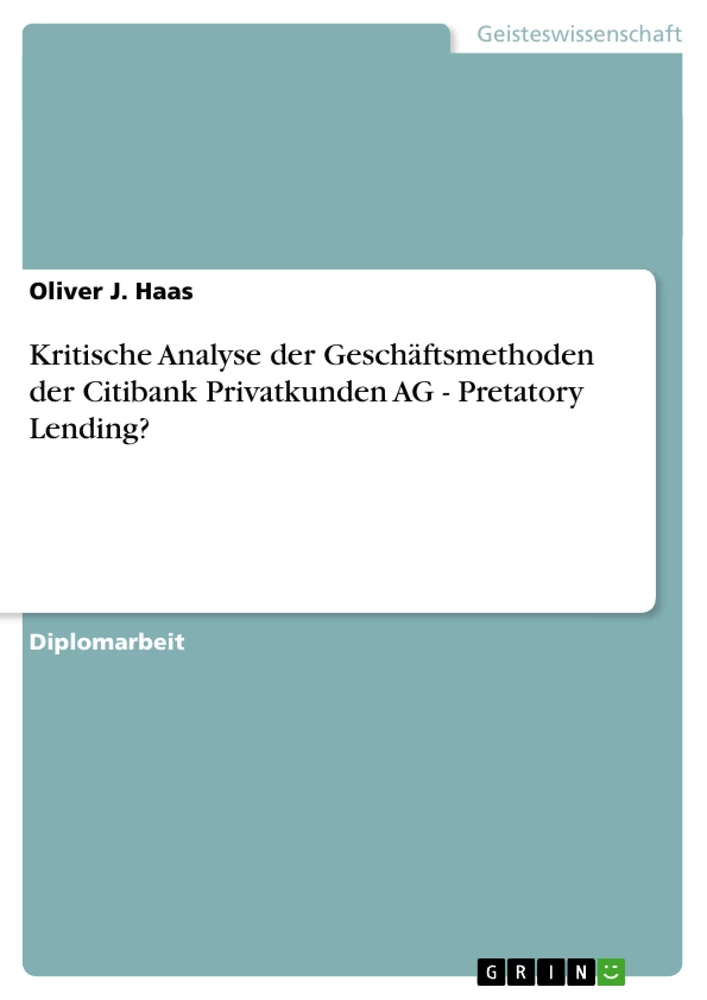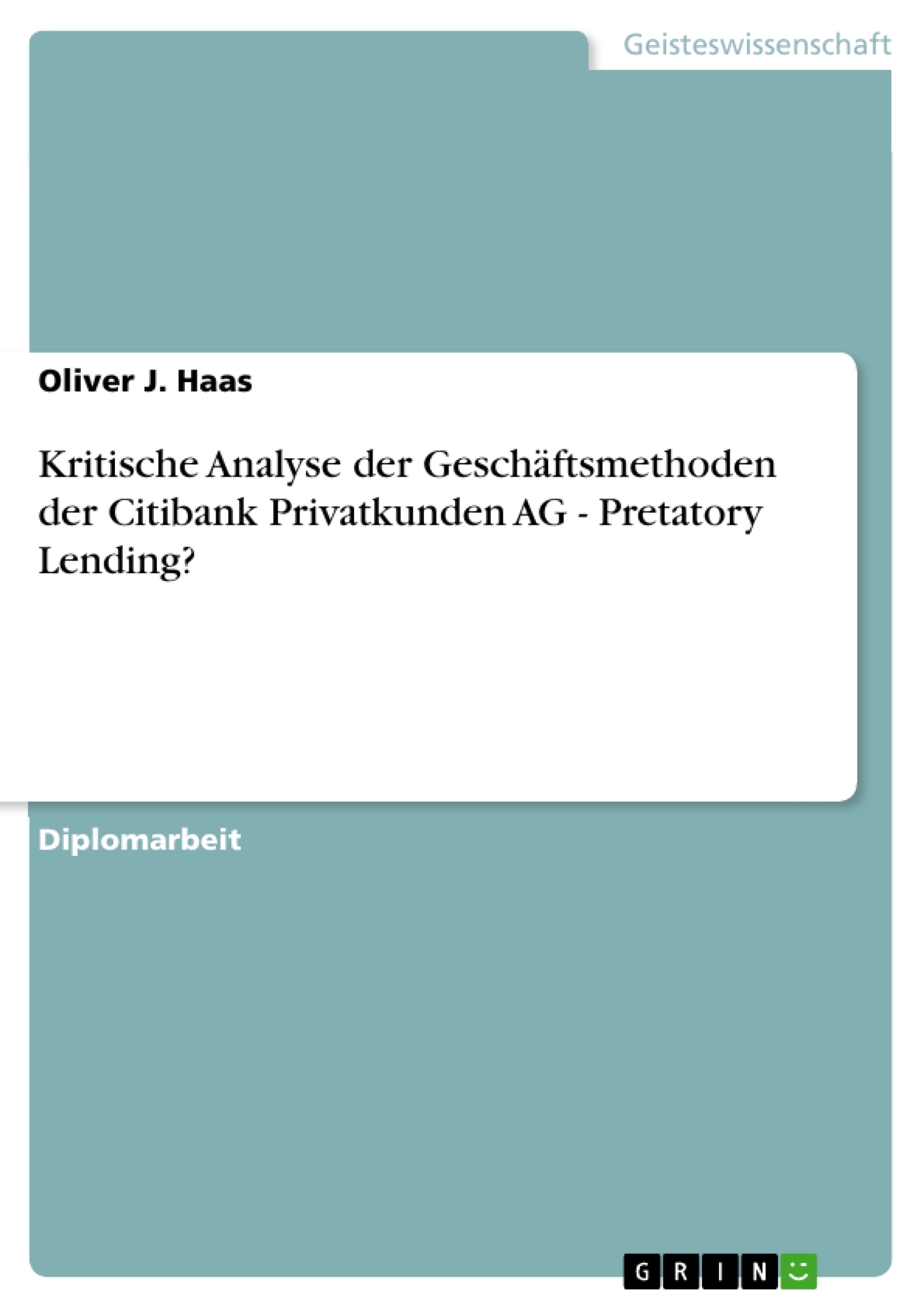Die Citibank Privatkunden AG & Co KAaA wird durch Verbraucherschützer und Schuldnerberater im besonderem Maße gerügt: Ihre Methoden seien teilweise rüde und die Verträge folglich häufig durch einseitigen ökonomischen Nutzen
geprägt. Der Autor erörtert die als aggressive kritisierte Kreditkultur wissenschaftlich. Es wird untersucht, ob die beobachteten Geschäftsmethoden der Citibank den Vorwurf des Predatory Lendings rechtfertigen. Der Begriff Predatory Lending stammt aus den USA und wird als einseitigen und sittenwidrige Gestaltung von Kreditbeziehungen zu Lasten des Kreditnehmers verstanden.
Zur Prüfung dieser These erörtert der Autor einleitend den übergeordneten Zusammenhang und führt eine empirische Medienanalyse durch. Dabei behandelt er die Frage, wie über die Citibank gesprochen wird. Die Sichtweisen unterscheiden sich diametral – je nach Perspektive. Darauf aufbauend wird die Kreditkultur der Citibank detailliert erörtert und die besondere Problematik der Kettenkredite, Umschuldungsverluste und überteuerten Restschuldversicherungen behandelt.
Zur Prüfung der erstellten Thesen wird eine empirische Untersuchung angestellt: In Zusammenarbeit mit Verbraucherzentralen, Schuldnerberatern und wissenschaftlichen Instituten wurden zehn so genannte Kettenkreditnehmer empirisch untersucht. Dabei wurden 50 Kreditverträge ausgewertet und tabellarisch und grafisch verarbeitet. Der Autor kommt zu dem Schluss, dass Predatory Lending bei der Citibank in den untersuchten Fällen vorliegt. Auf diese Erkenntnis aufbauend, werden die negativen sozialen, ökonomischen und
institutionellen Implikationen des Predatory Lending thematisiert. In diesem Zusammenhang schließt der Autor mit einem kritischen Resümee.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Medienanalyse
- Shareholder-Öffentlichkeit
- Stakeholder-Öffentlichkeiten
- Politische Öffentlichkeit
- Verbraucherschützer und Gewerkschaften
- Konsumentenkredit - Definition und Bedeutung
- Die Verschuldungsspirale der Citibank
- Dispositionskredit
- Kreditkarte
- Ratenkredit
- Empirische Betrachtung der Kettenkredite
- Transformation der Bankentheorie
- Sozialwissenschaftlicher Transfer
- Predatory Lending - eine Definition
- Predatory Lending bei der Citibank
- Ökonomie der Kreditkultur
- Faktoren und Indikatoren für Predatory Lending
- Soziale Implikation der Kreditkultur
- Institutionelle Transformation
- Soziologische Replik
- Unternehmensethische Aspekte
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Geschäftsmethoden der Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA und deren soziale Auswirkungen. Die Analyse betrachtet die Kreditvergabepraktiken der Bank im Kontext der Verschuldungsspirale und analysiert kritische Aspekte wie die Restschuldversicherung (RSV). Das Ziel ist es, ein soziologisches und institutionelles Verständnis der Kreditkultur der Citibank zu entwickeln und deren gesellschaftliche Implikationen zu beleuchten.
- Analyse der Kreditvergabepraktiken der Citibank
- Untersuchung der sozialen Auswirkungen der Kreditkultur der Citibank
- Bewertung der Rolle der Restschuldversicherung (RSV)
- Beziehung zwischen der Bank und der öffentlichen Wahrnehmung
- Institutionelle und soziologische Perspektiven auf das Thema
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung beschreibt die aggressive Kreditvergabepraxis der Citibank und deren Zusammenhang mit hohen Verbraucherinsolvenzraten. Sie argumentiert für einen interdisziplinären Ansatz, um die soziale Realität der ökonomischen Praxis zu verstehen und betont die Notwendigkeit, die ökonomische Realität und die soziale Realität miteinander zu verbinden. Die Arbeit fokussiert auf die Kritik an der Citibank und deren globalen Einfluss, basierend auf öffentlichen Kritiken und Studien, welche die Citibank als ein Modell der "finanziellen Apartheid" bezeichnen, welches von den Schwächsten in der Gesellschaft profitiert.
Medienanalyse: Dieses Kapitel untersucht die öffentliche Wahrnehmung der Citibank durch verschiedene Medien und Interessengruppen, wie Shareholder, Stakeholder, politische Öffentlichkeit, Verbraucherschützer und Gewerkschaften. Es analysiert die unterschiedlichen Perspektiven und die öffentliche Kritik an den Geschäftspraktiken der Bank.
Konsumentenkredit - Definition und Bedeutung: Dieses Kapitel definiert den Konsumentenkredit und erläutert dessen Bedeutung im Kontext der Citibank-Praktiken. Es stellt vermutlich eine Bewertungsmatrix für Konsumentenkredite vor und analysiert die Kreditkultur der Citibank im Detail.
Die Verschuldungsspirale der Citibank: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Kreditprodukten der Citibank (Dispositionskredit, Kreditkarte, Ratenkredit) und deren Rolle bei der Entstehung von Überschuldung. Der Schwerpunkt liegt dabei auf den Kosten der Kredite, insbesondere der Restschuldversicherung, und deren Auswirkungen auf die Kunden. Die Kapitel beschreibt die Mechanismen, die zu einer Verschuldungsspirale führen können.
Empirische Betrachtung der Kettenkredite: Dieses Kapitel präsentiert empirische Daten, die die Behauptungen über die aggressive Kreditvergabepraxis der Citibank unterstützen. Es analysiert vermutlich Daten zur RSV, deren obligatorische Natur, die Streuung der Prämien und die steigenden Kosten für geliehenes Geld. Die Kapitel liefert wahrscheinlich einen Beleg für die These der Verschuldungsspirale.
Transformation der Bankentheorie: Dieses Kapitel verbindet die empirischen Befunde mit bestehenden banktheoretischen und sozialwissenschaftlichen Modellen. Es analysiert vermutlich den Begriff "Predatory Lending" und wendet ihn auf die Citibank an. Die Kapitel verknüpft wahrscheinlich ökonomische und soziologische Perspektiven, um die Kreditkultur der Citibank zu verstehen.
Soziale Implikation der Kreditkultur: Dieses Kapitel untersucht die sozialen Konsequenzen der Kreditkultur der Citibank auf die betroffenen Personen und die Gesellschaft. Es analysiert die Auswirkungen der Verschuldung auf das Leben der Kreditnehmer und deren soziale Netzwerke.
Institutionelle Transformation: Dieses Kapitel analysiert die institutionellen Rahmenbedingungen, die die aggressive Kreditvergabepraxis der Citibank ermöglichen oder begünstigen. Es untersucht vermutlich die Rolle von Regulierungsbehörden und die institutionellen Strukturen, die zur Entwicklung der Kreditkultur beigetragen haben.
Soziologische Replik: Dieses Kapitel präsentiert wahrscheinlich eine soziologische Interpretation der Ergebnisse und analysiert die gesellschaftlichen Mechanismen, die zur Verschuldung beitragen.
Unternehmensethische Aspekte: Dieses Kapitel setzt sich kritisch mit den ethischen Aspekten der Geschäftspraktiken der Citibank auseinander und bewertet die Verantwortung der Bank gegenüber ihren Kunden und der Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Citibank, Konsumentenkredit, Verschuldung, Restschuldversicherung (RSV), Predatory Lending, Überschuldung, soziale Implikationen, institutionelle Analyse, soziologische Perspektive, Kreditkultur.
Citibank-Studie: Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Studie?
Diese Studie analysiert die Geschäftspraktiken der Citibank Privatkunden AG & Co. KGaA, insbesondere ihre Kreditvergabe, und deren soziale Auswirkungen. Im Fokus stehen die Entstehung von Überschuldung ("Verschuldungsspirale"), die Rolle der Restschuldversicherung (RSV) und die ethischen Aspekte des Geschäftsmodells. Die Studie verwendet einen interdisziplinären Ansatz, der ökonomische und soziologische Perspektiven verbindet.
Welche Themen werden in der Studie behandelt?
Die Studie umfasst eine Medienanalyse der öffentlichen Wahrnehmung der Citibank, eine Definition und Bedeutung von Konsumentenkrediten, eine detaillierte Untersuchung der Citibank-Kreditprodukte (Dispositionskredit, Kreditkarte, Ratenkredit) und ihrer Rolle bei der Überschuldung. Weiterhin werden empirische Daten zu Kettenkrediten präsentiert, die Bankentheorie im Kontext der Citibank-Praktiken transformiert und die sozialen Implikationen der Kreditkultur beleuchtet. Institutionelle Rahmenbedingungen, soziologische Interpretationen und unternehmensethische Aspekte werden ebenfalls analysiert.
Welche Methodik wird verwendet?
Die Studie verwendet einen interdisziplinären Ansatz, der sowohl ökonomische als auch soziologische Perspektiven integriert. Sie analysiert öffentliche Medienberichte, untersucht die verschiedenen Kreditprodukte der Citibank und deren Kostenstruktur (insbesondere die RSV), und präsentiert empirische Daten, um die Behauptungen über aggressive Kreditvergabepraktiken zu untermauern. Die Studie befasst sich auch mit bestehenden banktheoretischen und sozialwissenschaftlichen Modellen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Studie am besten?
Citibank, Konsumentenkredit, Verschuldung, Restschuldversicherung (RSV), Predatory Lending, Überschuldung, soziale Implikationen, institutionelle Analyse, soziologische Perspektive, Kreditkultur.
Welche Zielsetzung verfolgt die Studie?
Die Studie zielt darauf ab, ein soziologisches und institutionelles Verständnis der Kreditkultur der Citibank zu entwickeln und deren gesellschaftliche Implikationen zu beleuchten. Sie untersucht die Beziehung zwischen der Bank und der öffentlichen Wahrnehmung und bewertet die Rolle der Restschuldversicherung.
Welche Kapitel umfasst die Studie?
Die Studie umfasst Kapitel zu Einleitung, Medienanalyse, Definition und Bedeutung von Konsumentenkrediten, der Verschuldungsspirale der Citibank, empirischer Betrachtung von Kettenkrediten, Transformation der Bankentheorie, sozialen Implikationen der Kreditkultur, institutioneller Transformation, soziologischer Replik, Unternehmensethischen Aspekten und einem Resümee.
Welche konkreten Aspekte der Citibank werden untersucht?
Die Studie untersucht die Kreditvergabepraktiken der Citibank, insbesondere die verschiedenen Kreditprodukte (Dispositionskredit, Kreditkarte, Ratenkredit) und deren Kostenstruktur, die Rolle der Restschuldversicherung (RSV), die Entstehung von Überschuldung ("Verschuldungsspirale") und die öffentlichen Reaktionen auf diese Praktiken.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Studie?
(Diese Frage kann erst nach Lesen des vollständigen Textes beantwortet werden. Die Zusammenfassung der Kapitel gibt Hinweise auf die möglichen Schlussfolgerungen, aber keine expliziten Aussagen.)
- Citar trabajo
- Oliver J. Haas (Autor), 2004, Kritische Analyse der Geschäftsmethoden der Citibank Privatkunden AG - Pretatory Lending?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59379