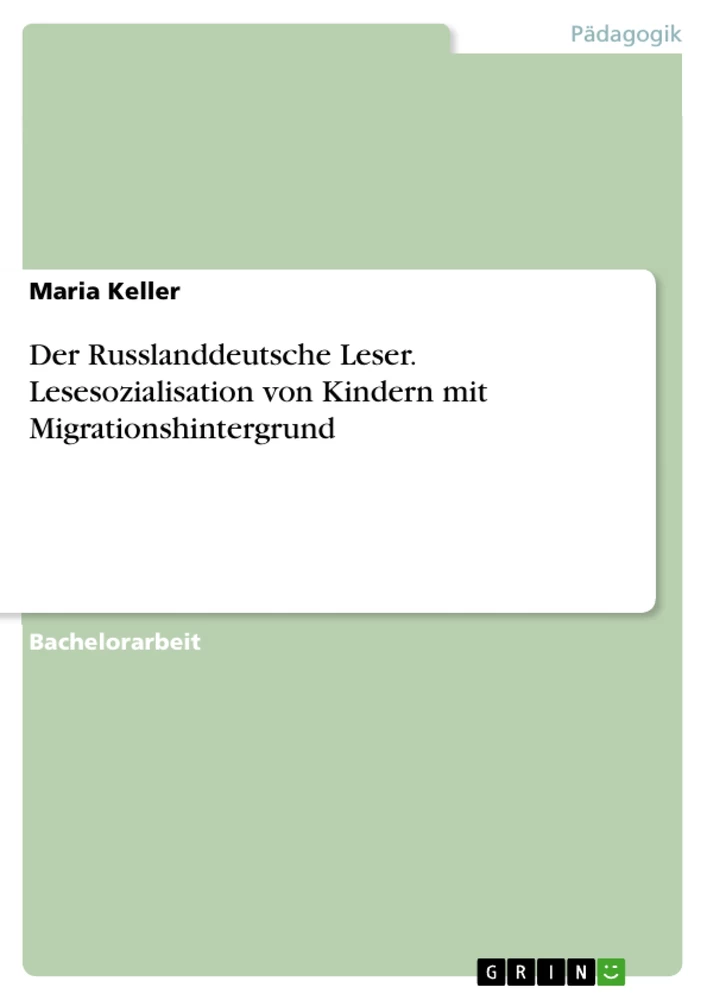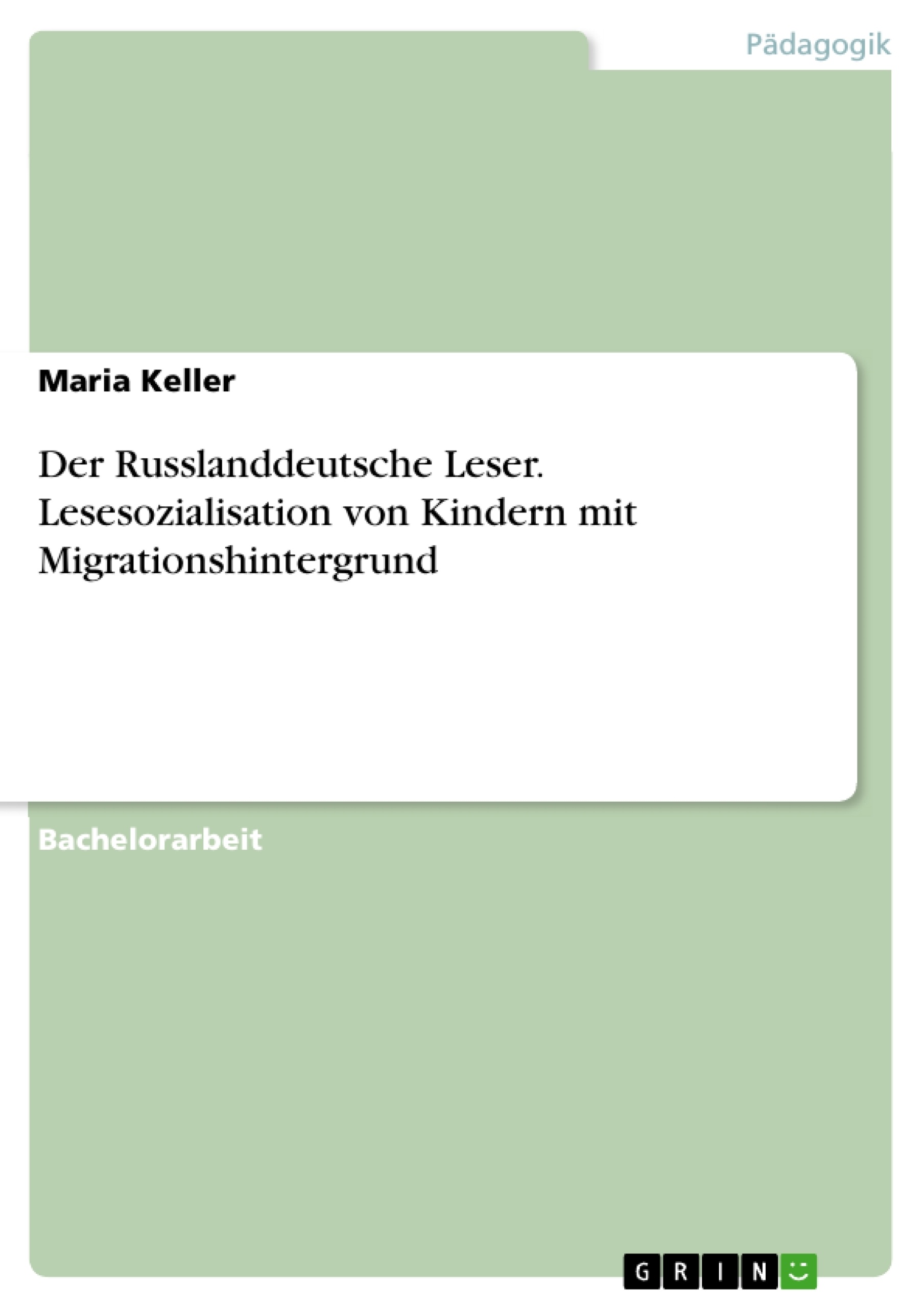Diese Arbeit befasst sich mit dem Prozess der Lesesozialisation, der Gegenstand zahlreicher Forschungsarbeiten und theoretischer Modelle ist. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Aufarbeitung der persönlichen Lesesozialisation, die unter Zugrundelegung der Leitlinien zum Verfassen der eigenen Lesegeschichte in dem von Garbe, Philipp und Ohlsen vorgelegten "Arbeitsbuches zur Lesesozialisation" erfolgt. Im Hinblick auf die Lesesozialisation stellt sich die Frage, inwieweit ein Migrationshintergrund Einfluss auf das Lesenlernen und das damit verbundene spätere literarische Interesse und individuelle Leseverhalten nehmen kann.
Eine umfassende Lesesozialisation gehört zweifelsohne zu den wichtigsten Qualifikationen, die ein jeder Heranwachsender sich aneignen sollte, um sich in einer sich immer schneller wandelnden Welt zurechtzufinden. Nach wie vor spielt die gezielte Leseförderung, besonders durch Lehrer und Eltern, eine entscheidende Rolle, sei diese Leseförderung auf das gesellschaftliche Bestehen der Kinder ausgelegt oder auf ihren beruflichen Werdegang. Damals wie heute trägt die Lesesozialisation dazu bei, Wissen aus allen Lebensbereichen, Werte und Normen der nächsten Generation in schriftlicher Form zu vermitteln. Der Prozess des Lesens trägt dazu bei, einen Zugang zu vergangenem Wissen und Erfahrungen, oft kulturell geprägt, zu erhalten, dieses zu reflektieren und in neuer Form weiterzutragen. Zu Beginn der Lesesozialisation wurde häufig durch die Vorgaben der Eltern bestimmt, was gelesen werden durfte, da der Prozess der Lesesozialisation in Verbindung mit kindgerechten (Bilder)Büchern, dann mit Kinderbüchern als wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu einer umfassenden Lesekompetenz galt und gilt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Forschungsstand
- 2. Definition Lesesozialisation
- 3. Die Wichtigkeit des Lesens
- 4. Modelle der Lesesozialisation bzw. Lesekompetenz
- 5. Wert des Lesens in der Familie aus Sicht der Gesellschaft
- 6. Migration und Integration deutscher Spätaussiedler*innen
- 7. Schriftliche Ausarbeitung der eigenen Lesesozialisation
- 8. Familiengeschichte und Leseverhalten der Familien
- 9. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Lesesozialisation von Kindern mit Migrationshintergrund, insbesondere mit dem Fokus auf Russlanddeutsche Einwanderer*innen. Ziel der Arbeit ist es, den Einfluss des Migrationshintergrunds auf das Lesenlernen und das spätere literarische Interesse und individuelle Leseverhalten zu untersuchen.
- Definition und Bedeutung von Lesesozialisation
- Modelle der Lesesozialisation und Lesekompetenz
- Der Wert des Lesens in der Familie aus gesellschaftlicher Sicht
- Herausforderungen und Chancen der Integration von Spätaussiedler*innen
- Analyse der eigenen Lesesozialisation und ihrer Einflussfaktoren
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Einleitung und Forschungsstand: Die Einleitung führt in die Thematik der Lesesozialisation ein und skizziert den Forschungsstand. Sie beleuchtet die Bedeutung der Lesesozialisation für die Persönlichkeitsentwicklung und den gesellschaftlichen Erfolg. Weiterhin werden Forschungslücken im Bereich der Lesesozialisation von Kindern mit Migrationshintergrund aufgezeigt, insbesondere im Hinblick auf Russlanddeutsche Einwanderer*innen.
- Kapitel 2: Definition Lesesozialisation: Dieses Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Lesesozialisation und setzt sie in den Kontext der Mediensozialisation. Dabei wird der Einfluss von verschiedenen Faktoren wie Geschlecht, Herkunft und sozialem Umfeld auf den Lesesozialisationsprozess hervorgehoben.
- Kapitel 3: Die Wichtigkeit des Lesens: Dieses Kapitel beleuchtet die Relevanz des Lesens in der heutigen Gesellschaft und betont die zentrale Rolle der Lesesozialisation für die Entwicklung einer umfassenden Lesekompetenz.
- Kapitel 4: Modelle der Lesesozialisation bzw. Lesekompetenz: Dieses Kapitel stellt verschiedene Modelle der Lesesozialisation und Lesekompetenz vor, die den Einfluss von Familie, Schule und Gesellschaft auf den Lesesozialisationsprozess beleuchten.
- Kapitel 5: Wert des Lesens in der Familie aus Sicht der Gesellschaft: Dieses Kapitel untersucht die Bedeutung des Lesens in der Familie aus gesellschaftlicher Perspektive und beleuchtet die Rolle der Eltern als wichtige Akteure der Lesesozialisation.
- Kapitel 6: Migration und Integration deutscher Spätaussiedler*innen: Dieses Kapitel beleuchtet die Herausforderungen und Chancen der Integration von Spätaussiedler*innen in Deutschland.
- Kapitel 7: Schriftliche Ausarbeitung der eigenen Lesesozialisation: Dieses Kapitel präsentiert eine persönliche Analyse der eigenen Lesesozialisation, die anhand der Leitlinien des ‚Arbeitsbuches zur Lesesozialisation' erfolgt.
- Kapitel 8: Familiengeschichte und Leseverhalten der Familien: Dieses Kapitel beleuchtet die Rolle der Familiengeschichte und die Lesekultur innerhalb der Familie im Hinblick auf die Lesesozialisation von Kindern.
Schlüsselwörter
Die vorliegende Arbeit fokussiert auf die Themenfelder Lesesozialisation, Migrationshintergrund, Russlanddeutsche Einwanderer*innen, Lesekompetenz, Familiengeschichte, Leseverhalten, Integration, zweisprachige Erziehung, Bildungsstand, Sprachentwicklung, literarisches Interesse.
- Quote paper
- Maria Keller (Author), 2019, Der Russlanddeutsche Leser. Lesesozialisation von Kindern mit Migrationshintergrund, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/593771