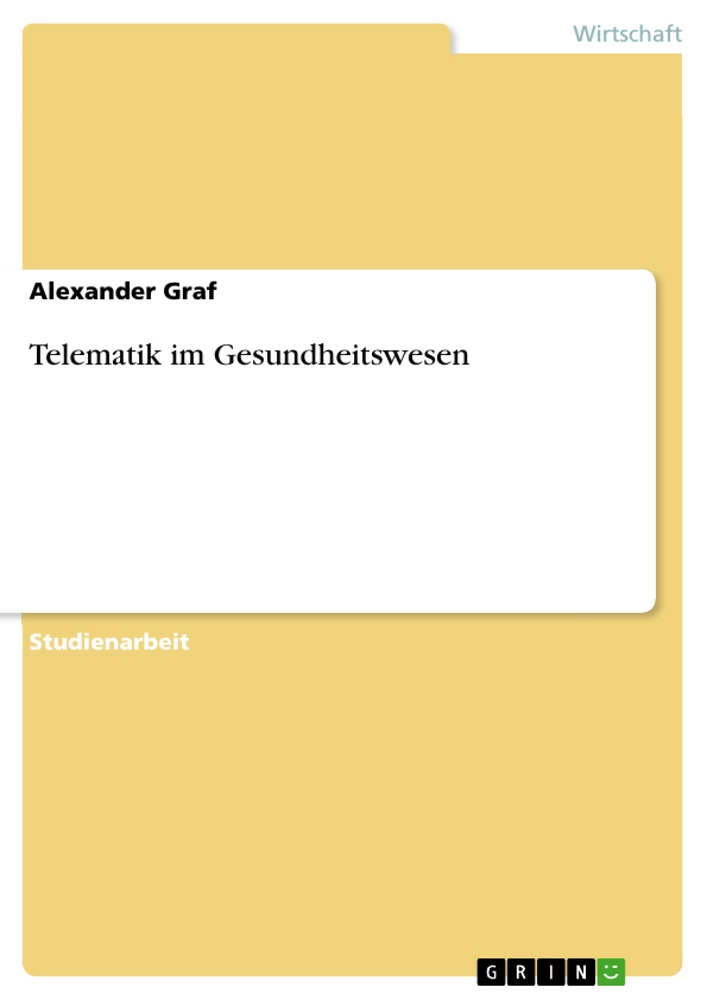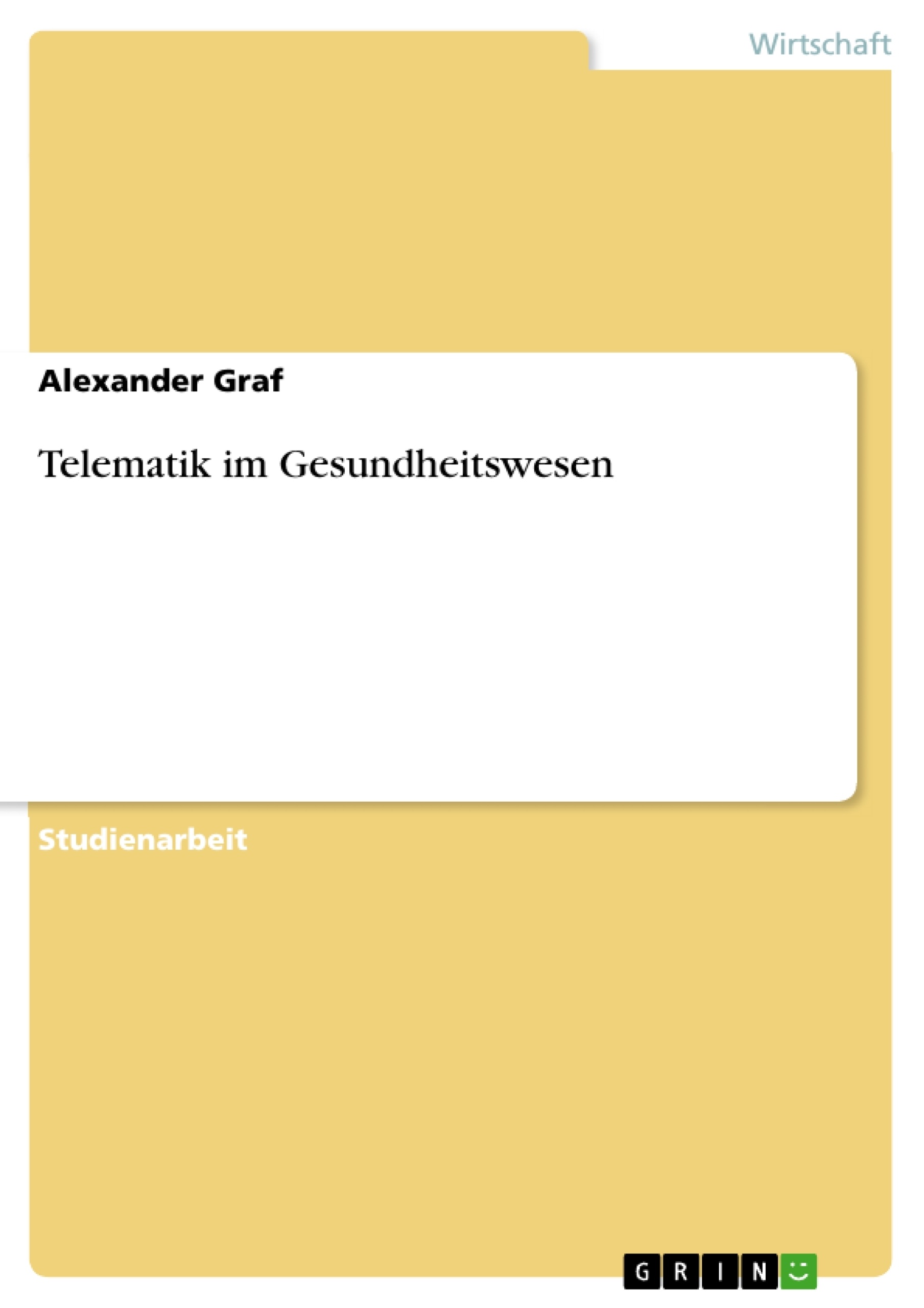Information und Kommunikation bilden sich immer stärker als Grundlagen unserer modernen Gesellschaft heraus. Gemäß dem Zentrum für Telematik im Gesundheitswesen (2006) werden Prozesse im Allgemeinen und nicht zuletzt im Bereich Gesundheit und Medizin aufgrund von Differenzierung, Spezialisierung und dem Anstieg von Wissen immer komplexer. Sinnvoll ist deshalb eine Verbindung des Gesundheitsystems mit den telematischen Innovationen die sich vorrangig in IT-gestützten Anwendungen wieder finden. Das von Doris Pfeifer (2005) geprägte Zitat „Move the information, and not the patient“, fasst die grundlegenden Ideen einer Telematik-Plattform im Gesundheitswesen in Deutschland zusammen. Patientendaten sollen jederzeit und überall verfügbar sein. Eine bessere Informationslage erhöht die Behandlungsqualität und langfristig können durch bessere Steuerung und Planung sogar die Beiträge sinken. Die Telematik-Initiative in Deutschland steht, angetrieben durch das Bundesministerium für Gesundheit (BMfGa) noch am Anfang, aber die Pläne zur deren Umsetzung sind zeitlich sehr ambitioniert, so dass noch im Jahr 2007 erste Feldtests mit der neuen Gesundheitskarte gemacht werden. In dieser Arbeit werden die technischen Ausprägungen einer Telematik-Plattform im Gesundheitswesen vorgestellt und mit Hilfe einer Kosten-Nutzen-Analyse in einen gesamtwirtschaftlichen Zusammenhang gestellt. Aufgezeigt werden auch die noch zu bearbeitenden Problemfelder und die Möglichkeiten einer Finanzierung telematischer Infrastruktur durch Öffentlich-Private-Partnerschaften. Die Ergebnisse zeigen, dass noch viele Details auf dem Weg zur vollständigen Telematik-Plattform diskutiert werden müssen, aber die Planungszahlen (Abschnitt 1.3.2.2) sind gesamtwirtschaftlich gesehen sehr attraktiv und die noch zu lösenden Probleme sind übersichtlich. In Abschnitt 2 werden die Begriffe „Gesundheitswesen“ und „Telematik“ konzeptionell erklärt. Abschnitt 3 beschäftigt sich mit den wichtigsten Anwendungen der Telematik, einer Kosten-Nutzen-Analyse im Rahmen der neuen deutschen Telematik-Plattform und einer Darstellung der wichtigsten Probleme. Abschließend wird im dritten Abschnitt auf die Finanzierungsmöglichkeiten der Telematik im Gesundheitswesen durch Öffentliche-Private-Partnerschaften eingegangen. Abschnitt 4 schließt mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick ab.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Begriffliche und konzeptionelle Grundlagen
- Begriff des Gesundheitswesens
- Begriff der Telematik
- Telematik im Gesundheitswesen
- Telematische Anwendungen
- Anwendungen im Rahmen der neuen deutschen Gesundheitskarte
- Weitere Anwendungen im Rahmen telematischer Innovationen
- Bewertung der Telematik unter ökonomischen Aspekten
- Stakeholder im deutschen Gesundheitswesen
- Ansätze zur Kosten-Nutzen-Analyse
- Bewertung der gezeigten Analysen im Zusammenhang mit dem Stakeholderansatz
- Problemfelder der Telematik
- Datenschutz und gesetzliche Rahmenbedingungen
- Probleme der Datenintegration
- Effiziente Auswertung der Daten
- Bewertung der maßgeblichen Problemfelder bei der Einführung einer Telematik-Plattform
- Partnerschaften
- Begriffsabgrenzung
- Anwendung der ÖPP bei der Finanzierung von Telematik im Gesundheitswesen
- Vorteils- und Risikoargumentation durch ÖPP
- Telematische Anwendungen
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Telematik im deutschen Gesundheitswesen. Ziel ist es, die technischen Ausprägungen einer Telematik-Plattform darzustellen, eine Kosten-Nutzen-Analyse durchzuführen und relevante Problemfelder zu beleuchten. Zusätzlich wird die Finanzierung durch Öffentlich-Private-Partnerschaften betrachtet.
- Konzeptionelle Klärung der Begriffe „Gesundheitswesen“ und „Telematik“
- Analyse telematischer Anwendungen im Gesundheitswesen, insbesondere im Kontext der neuen Gesundheitskarte.
- Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse der Telematik-Plattform.
- Bewertung der Problemfelder der Telematik, einschließlich Datenschutz und Datenintegration.
- Untersuchung der Finanzierungsmöglichkeiten durch Öffentlich-Private-Partnerschaften.
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Telematik im Gesundheitswesen ein und beschreibt die wachsende Komplexität im Gesundheitssektor, die durch telematische Innovationen adressiert werden soll. Das Zitat von Doris Pfeifer ("Move the information, and not the patient") unterstreicht das zentrale Ziel einer verbesserten Datenverfügbarkeit für höhere Behandlungsqualität und langfristig niedrigere Beiträge. Die Arbeit skizziert ihren Aufbau und die zu behandelnden Aspekte: technische Ausprägungen, Kosten-Nutzen-Analyse, Problemfelder und Finanzierungsmöglichkeiten durch Öffentlich-Private-Partnerschaften. Die Einleitung betont den ambitionierten Zeitplan der Telematik-Initiative und deutet auf positive gesamtwirtschaftliche Perspektiven hin, gleichzeitig aber auch auf noch zu klärende Details.
Begriffliche und konzeptionelle Grundlagen: Dieses Kapitel legt die konzeptionellen Grundlagen für das Verständnis der Arbeit. Es definiert präzise den Begriff des Gesundheitswesens in seiner Komplexität und Breite und beleuchtet den Begriff der Telematik im Kontext der Informations- und Kommunikationstechnologien im Gesundheitsbereich. Die klare Definition dieser beiden Kernbegriffe bildet die essentielle Basis für die anschließende Analyse telematischer Anwendungen und deren ökonomische Bewertung.
Telematik im Gesundheitswesen: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit. Es beschreibt verschiedene Anwendungen der Telematik, darunter die elektronische Gesundheitskarte, das elektronische Rezept, und den elektronischen Arztbrief. Die Kosten-Nutzen-Analyse betrachtet verschiedene Stakeholder, wie Patienten, Ärzte, Krankenhäuser und Krankenkassen, und versucht, den gesamtwirtschaftlichen Nutzen der Telematik zu quantifizieren. Zusätzlich werden kritische Problemfelder wie Datenschutz und Datenintegration ausführlich behandelt. Die Kapitel befasst sich auch mit der Rolle von öffentlich-privaten Partnerschaften bei der Finanzierung telematischer Innovationen, wobei die Vor- und Nachteile dieser Finanzierungsmodelle gewogen werden.
Schlüsselwörter
Telematik, Gesundheitswesen, elektronische Gesundheitskarte, elektronisches Rezept, elektronischer Arztbrief, Kosten-Nutzen-Analyse, Datenschutz, Datenintegration, Öffentlich-Private-Partnerschaft, Informationstechnologie, gesamtwirtschaftliche Effekte, Stakeholder.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Telematik im deutschen Gesundheitswesen
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Telematik im deutschen Gesundheitswesen. Sie analysiert die technischen Aspekte einer Telematik-Plattform, führt eine Kosten-Nutzen-Analyse durch und beleuchtet relevante Problemfelder. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Finanzierung durch Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP).
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themenbereiche: konzeptionelle Klärung der Begriffe „Gesundheitswesen“ und „Telematik“, Analyse telematischer Anwendungen (insbesondere im Kontext der neuen Gesundheitskarte), Durchführung einer Kosten-Nutzen-Analyse der Telematik-Plattform, Bewertung der Problemfelder (Datenschutz, Datenintegration etc.), und Untersuchung der Finanzierungsmöglichkeiten durch ÖPP.
Welche konkreten Anwendungen der Telematik werden betrachtet?
Die Arbeit betrachtet verschiedene Anwendungen der Telematik, darunter die elektronische Gesundheitskarte, das elektronische Rezept und den elektronischen Arztbrief. Weitere telematische Innovationen werden ebenfalls berücksichtigt.
Wie wird die Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt?
Die Kosten-Nutzen-Analyse berücksichtigt verschiedene Stakeholder im deutschen Gesundheitswesen (Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Krankenkassen) und versucht, den gesamtwirtschaftlichen Nutzen der Telematik zu quantifizieren. Die Analyse betrachtet Ansätze zur Kosten-Nutzen-Bewertung im Zusammenhang mit dem Stakeholderansatz.
Welche Problemfelder der Telematik werden beleuchtet?
Die Arbeit behandelt kritische Problemfelder wie Datenschutz, gesetzliche Rahmenbedingungen, Probleme der Datenintegration und die effiziente Auswertung der Daten. Die Bewertung dieser Problemfelder im Kontext der Einführung einer Telematik-Plattform ist ein wichtiger Bestandteil der Analyse.
Welche Rolle spielen Öffentlich-Private-Partnerschaften (ÖPP)?
Die Seminararbeit untersucht die Anwendung von ÖPP bei der Finanzierung von Telematik im Gesundheitswesen. Die Vor- und Nachteile dieser Finanzierungsmodelle werden abgewogen und eine Vorteils- und Risikoargumentation im Kontext der ÖPP durchgeführt.
Welche Schlüsselbegriffe sind für das Verständnis der Arbeit relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Telematik, Gesundheitswesen, elektronische Gesundheitskarte, elektronisches Rezept, elektronischer Arztbrief, Kosten-Nutzen-Analyse, Datenschutz, Datenintegration, Öffentlich-Private-Partnerschaft, Informationstechnologie, gesamtwirtschaftliche Effekte und Stakeholder.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Kapitelzusammenfassungen, die die Inhalte der Einleitung, der konzeptionellen Grundlagen, der Telematik im Gesundheitswesen und der Schlussfolgerungen kurz beschreiben.
Wer ist die Zielgruppe dieser Arbeit?
Die Zielgruppe umfasst alle, die sich für die Telematik im deutschen Gesundheitswesen interessieren, insbesondere Studierende, Wissenschaftler und Entscheidungsträger im Gesundheitssektor.
Wo finde ich das vollständige Inhaltsverzeichnis?
Das vollständige Inhaltsverzeichnis ist im HTML-Dokument enthalten und zeigt den detaillierten Aufbau der Seminararbeit.
- Quote paper
- Alexander Graf (Author), 2006, Telematik im Gesundheitswesen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59346