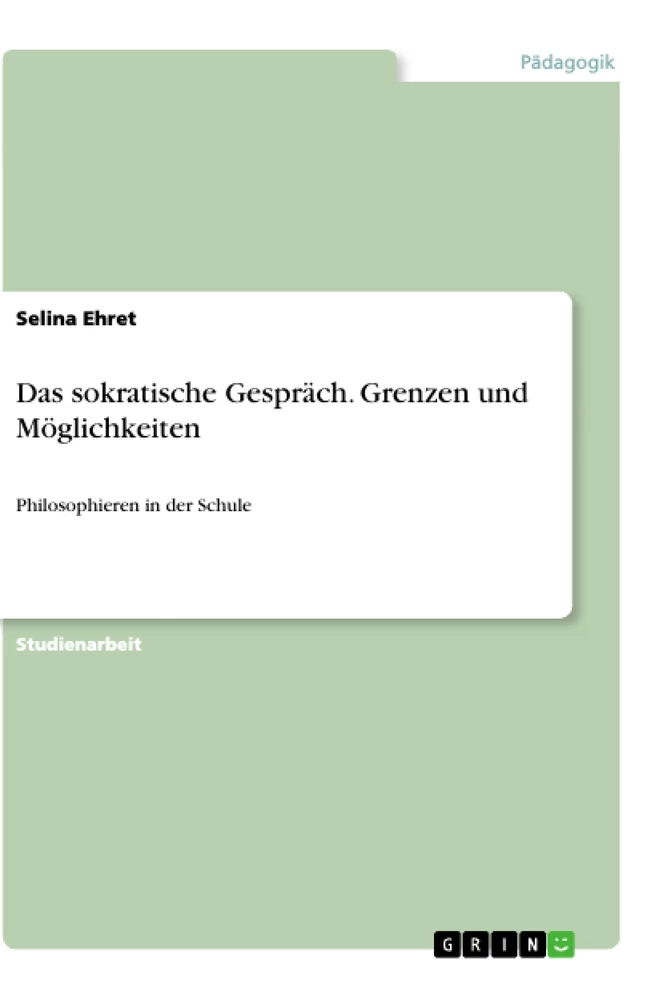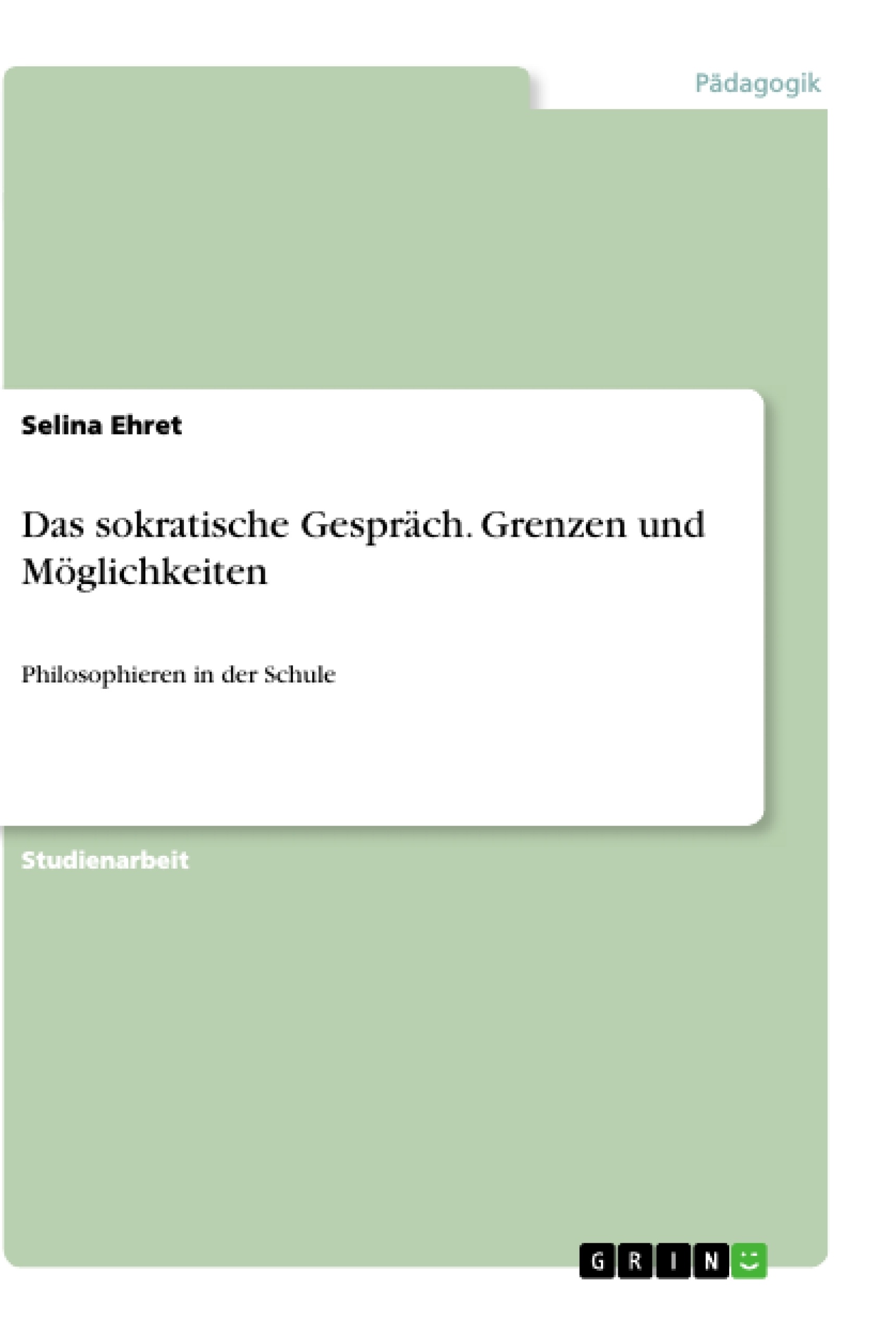Seit Beginn der Philosophie steht der Dialog im Zentrum und das Gespräch ist die grundlegendste Art der Kommunikation. Wir begegnen dabei anderen Menschen, können unser Denken artikulieren und sind dabei auf der Suche nach der Wahrheit. Obwohl das Gespräch so wichtig ist, wird dieses im Unterricht oft vernachlässigt beziehungsweise unterschätzt. Um unsere Meinungen austauschen und uns der Wahrheit nähern zu können, ist das sokratische Gespräch eine geeignete Wahl für den Unterricht. Das Philosophieren in der Schule hat sicherlich seine Vorzüge, ist aber bis heute eine viel diskutierte und schwierige Angelegenheit.
Im Folgenden soll darauf eingegangen werden, welchen Nutzen das Philosophieren mit Kindern im Unterricht bringen kann, aber auch welche Kritikpunkte dagegen sprechen. Zu Beginn wird ein knapper geschichtlicher Überblick zu den Anfängen der sokratischen Methode gegeben, folgend von der Weiterentwicklung nach Nelson. Über die Praxis und die Phasen des Gesprächsverlaufs geht es im Kapitel drei. Darauffolgend bezieht sich die Arbeit auf Möglichkeiten und Grenzen des sokratischen Gesprächs in der Schule und eine knappe Zusammenfassung beendet dann die Hausarbeit.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Geschichtlicher Hintergrund und Grundlagen
- 2.1 Die sokratische Methode
- 2.2 Weiterentwicklung durch Leonard Nelson
- 3. Phasen des Gesprächsablaufs
- 3.1 Themenstellung
- 3.2 Beispielsuche
- 3.3 Beispielanalyse
- 3.4 Diskursive Suche wahrer Aussagen (,regressive Abstraktion‘)
- 3.5 Gesprächsabschluss (i.d.R. aus zeitlichen Gründen)
- 3.6 Zwischenphasen als Metangespräche
- 4. Das Sokratische Gespräch in der Schule
- 4.1 Gründe für das Philosophieren mit Kindern und Jugendlichen
- 4.2 Schwierigkeiten im Unterricht
- 4.3 Kritik am Philosophieren mit Kindern
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Nutzen und die Herausforderungen des sokratischen Gesprächs im Schulunterricht. Sie beleuchtet die historische Entwicklung der sokratischen Methode, ihre Weiterentwicklung durch Leonard Nelson und die praktischen Phasen eines solchen Gesprächs. Die Arbeit analysiert sowohl die Vorteile des philosophischen Diskurses mit Kindern und Jugendlichen als auch die damit verbundenen Kritikpunkte.
- Historische Entwicklung der sokratischen Methode und deren Anpassung für den Unterricht.
- Praktische Anwendung des sokratischen Gesprächs in verschiedenen Phasen.
- Vorteile des Philosophierens mit Kindern und Jugendlichen.
- Schwierigkeiten und Herausforderungen bei der Implementierung im Unterricht.
- Kritische Auseinandersetzung mit dem sokratischen Gespräch im schulischen Kontext.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die zentrale Rolle des Dialogs in der Philosophie und im menschlichen Austausch. Sie hebt die Bedeutung des sokratischen Gesprächs als Methode des Erkenntnisgewinns im Unterricht hervor und kündigt die Auseinandersetzung mit Nutzen und Kritikpunkten des Philosophierens mit Kindern an. Der Text gibt einen Ausblick auf die Struktur der Arbeit, beginnend mit einem geschichtlichen Überblick über die sokratische Methode und deren Weiterentwicklung durch Nelson, über die Phasen des Gesprächsablaufs, bis hin zu Möglichkeiten und Grenzen des sokratischen Gesprächs in der Schule.
2. Geschichtlicher Hintergrund und Grundlagen: Dieses Kapitel beschreibt die sokratische Methode, ausgehend von Sokrates' berühmtem Ausspruch "Ich weiß, dass ich nicht weiß". Es beleuchtet die Betonung des gesprochenen Wortes gegenüber dem geschriebenen und erklärt, wie Sokrates durch Dialog und gezielte Fragen seine Gesprächspartner zur Selbstreflexion und Erkenntnisgewinn anregte. Die Mäeutik, die Hebammenkunst, wird als Methode des Hilfestellens beim Geburtsprozess der Erkenntnis beschrieben. Der Abschnitt über Leonard Nelson erläutert die Weiterentwicklung der sokratischen Methode zum moderierten Gruppengespräch im Unterricht, wobei der Lehrer als Gesprächsleiter fungiert und die Schüler in der Rolle der Argumentationspartner agieren. Im Gegensatz zu Sokrates stellt Nelson keine inhaltlichen Fragen, sondern lenkt das Gespräch durch methodische Hilfestellungen.
3. Phasen des Gesprächsablaufs: Dieses Kapitel beschreibt die einzelnen Phasen eines sokratischen Gesprächs. Es beginnt mit der Themenstellung, die in Form einer Frage formuliert wird und die Rahmenbedingungen des Gesprächs klärt. Die Beispielsuche folgt, bei der die Teilnehmer eigene Erfahrungen und Erinnerungen zum Thema beisteuern. Die Beispielanalyse beinhaltet die Formulierung konkreter Fragen zum gewählten Beispiel, um die Themenfrage zu bearbeiten. Die diskursive Suche wahrer Aussagen zielt darauf ab, durch Konsensfindung zu wahren Aussagen zu gelangen. Der Text erwähnt weitere Phasen wie den Gesprächsabschluss und Zwischenphasen als Metangespräche, ohne sie im Detail zu beschreiben.
Schlüsselwörter
Sokratisches Gespräch, Sokratische Methode, Leonard Nelson, Mäeutik, Philosophieren mit Kindern, Schulunterricht, Dialog, Erkenntnisgewinn, regressive Abstraktion, Konsens, Kritik.
Häufig gestellte Fragen zum Sokratischen Gespräch im Unterricht
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über das Sokratische Gespräch, insbesondere dessen Anwendung im Schulunterricht. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, die Zielsetzung und Themenschwerpunkte, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und eine Liste von Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf der historischen Entwicklung der Methode, ihrer praktischen Anwendung im Unterricht und der kritischen Auseinandersetzung mit ihren Vor- und Nachteilen.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt die historische Entwicklung des Sokratischen Gesprächs von Sokrates bis zu Leonard Nelsons Weiterentwicklungen. Es beschreibt detailliert die Phasen eines solchen Gesprächs (Themenstellung, Beispielsuche, -analyse, diskursive Suche wahrer Aussagen, Gesprächsabschluss). Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Anwendung im Schulunterricht, einschließlich der Herausforderungen und der Kritik an dieser Methode.
Wer ist Leonard Nelson und welche Rolle spielt er?
Leonard Nelson ist eine wichtige Figur im Kontext dieses Dokuments, da er die sokratische Methode weiterentwickelt hat, insbesondere für den Einsatz im Unterricht. Er adaptierte die Methode zu einem moderierten Gruppengespräch, in dem der Lehrer als Gesprächsleiter fungiert und die Schüler in der Rolle der Argumentationspartner agieren. Im Gegensatz zu Sokrates stellt Nelson keine inhaltlichen Fragen, sondern steuert den Gesprächsverlauf durch methodische Hilfestellungen.
Welche Phasen umfasst ein Sokratisches Gespräch?
Ein Sokratisches Gespräch gliedert sich in mehrere Phasen: Die Themenstellung, die in Form einer Frage formuliert wird; die Beispielsuche, in der Teilnehmer eigene Erfahrungen beisteuern; die Beispielanalyse, die konkrete Fragen zum Beispiel stellt; die diskursive Suche wahrer Aussagen, die durch Konsensfindung zu wahren Aussagen führt; und schließlich der Gesprächsabschluss (oftmals aus zeitlichen Gründen). Zwischenphasen können als Metangespräche betrachtet werden.
Welche Vorteile und Nachteile bietet das Sokratische Gespräch im Unterricht?
Das Dokument beleuchtet sowohl die Vorteile des Sokratischen Gesprächs im Unterricht (Förderung von kritischem Denken, Erkenntnisgewinn durch Dialog, Selbstreflexion der Schüler) als auch die Herausforderungen (mögliche Schwierigkeiten bei der Moderation, Zeitaufwand, potentielle Widerstände der Schüler). Es beinhaltet auch eine kritische Auseinandersetzung mit dem Einsatz dieser Methode im schulischen Kontext.
Welche Schlüsselbegriffe sind im Zusammenhang mit dem Sokratischen Gespräch relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Sokratisches Gespräch, Sokratische Methode, Leonard Nelson, Mäeutik, Philosophieren mit Kindern, Schulunterricht, Dialog, Erkenntnisgewinn, regressive Abstraktion, Konsens und Kritik.
Für wen ist dieses Dokument relevant?
Dieses Dokument richtet sich an Lehrer, Pädagogen, Studenten der Pädagogik und Philosophie sowie alle, die sich für die Anwendung des Sokratischen Gesprächs im Unterricht interessieren. Es bietet sowohl einen theoretischen Hintergrund als auch praktische Hinweise zur Umsetzung dieser Methode.
- Quote paper
- Selina Ehret (Author), 2018, Das sokratische Gespräch. Grenzen und Möglichkeiten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/593415