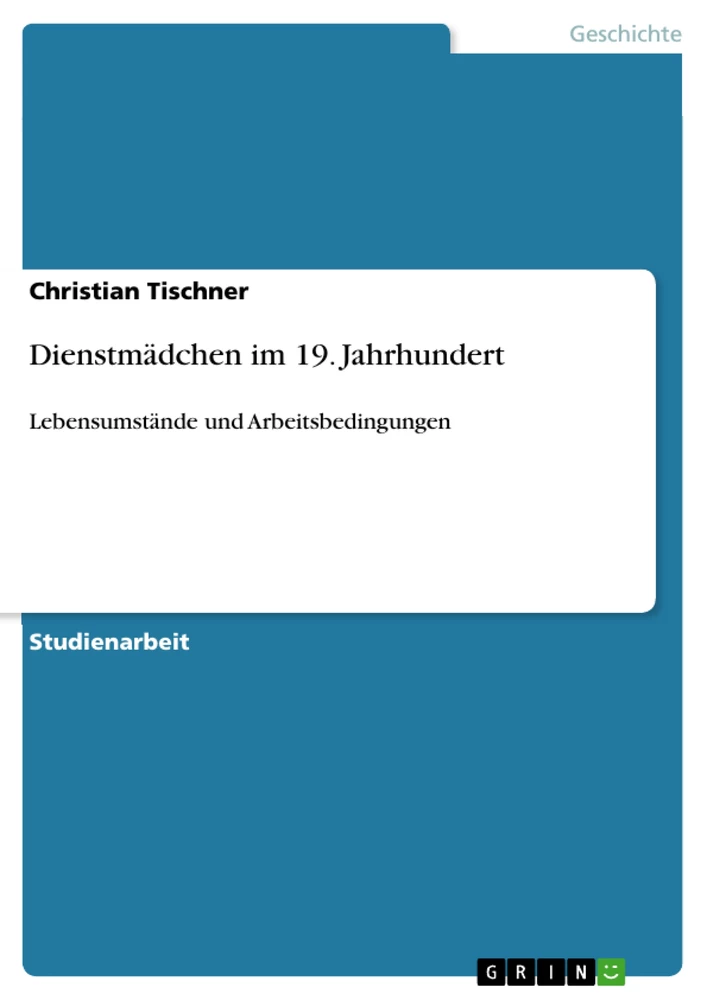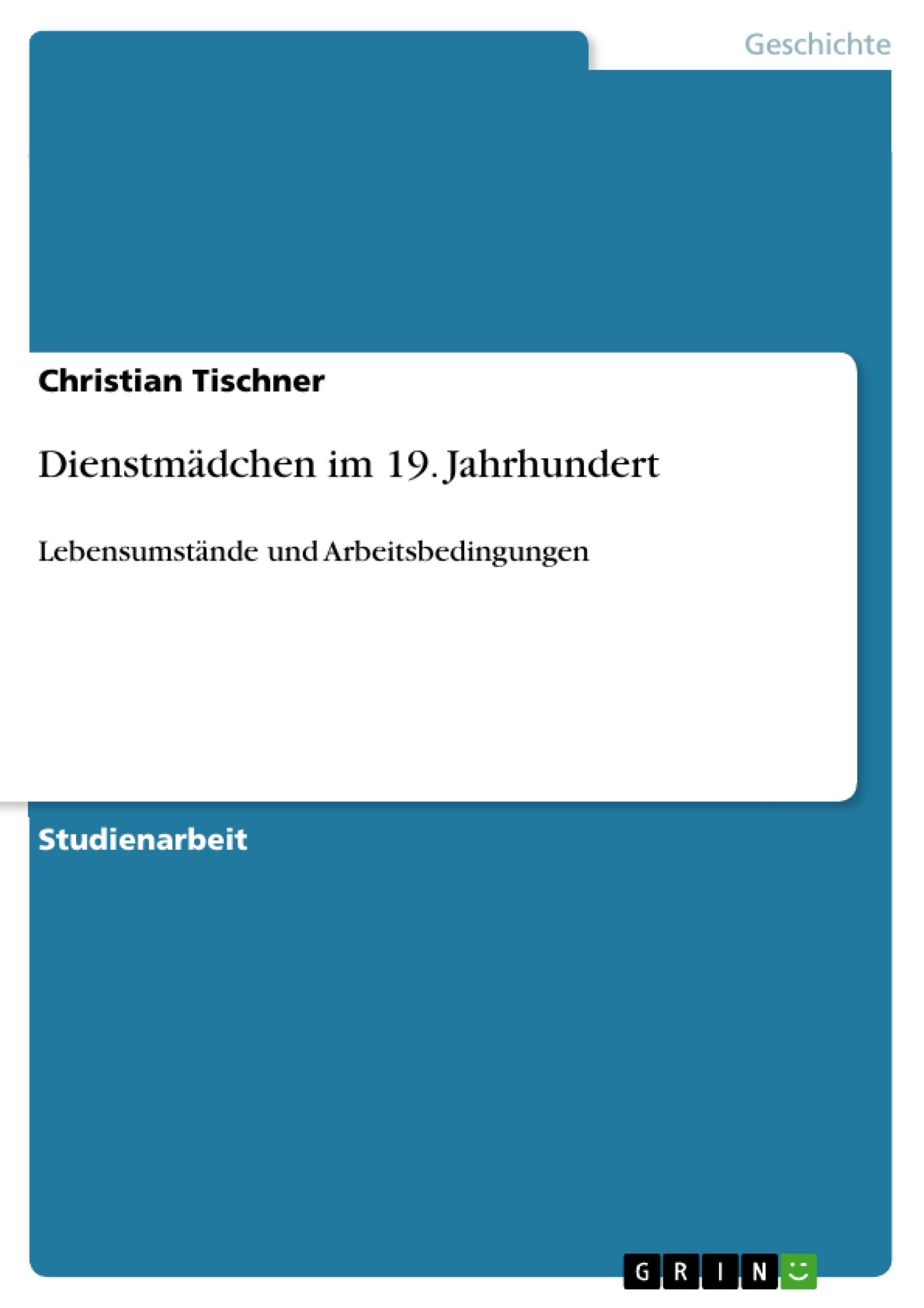In der vorliegenden Arbeit soll sich mit den Lebens- und Arbeitsverhältnissen der häuslichen Dienstboten, vornehmlich der der Dienstmädchen um die Jahrhundertwende befasst werden. Es ist Ziel dieser Arbeit aufzuzeigen, dass diese gesellschaftliche Gruppe den Prozess der Verstädterung, der mit der Industrialisierung einherging, prägte.
Bevor sich aber mit den „sogenannten Dienstbaren Geistern“ auseinandergesetzt wird, soll der Frage nachgegangen werden, wie sich der Wandel von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft vollzogen hat bzw. vollzieht. Dabei wird zu untersuchen sein, inwieweit der steigende Wohlstand den Weg in die Welt der Dienstleistungsgesellschaft beschleunigt. Die Dienstmädchen, so die These, waren ein Beispiel für die im 19. Jahrhundert stattfindende Wohlstandsvergrößerung vom höheren Bürgertum auf das mittlere Bürgertum.
Der zentrale Teil dieser Arbeit wird sich mit den Lebensumständen und Arbeitsbedingungen befassen. Dabei soll untersucht werden, was die Anziehungskraft des Dienstmädchenberufes ausmachte, welche Erwartungen die Mädchen an die Arbeit im städtischen Haushalt richteten und wie die Realität sich oftmals darstellte. Die These hierbei ist, dass die Mädchen häufig in völliger Naivität vom Land in die Stadt gingen und viele der Erwartungen sich nicht erfüllten. Es soll in dieser Arbeit auch auf die Beziehungen der Mädchen mit den Herrschaften eingegangen werden sowie auf deren Arbeitszeit, Entlohnung, Unterbringung und Verpflegung. Wichtige Quellen, wenn man sich mit den Dienstboten beschäftigt, sind die Gesindeordnungen. Sie sorgten im Grunde bis 1918 für ein Abhängigkeitsverhältnis zwischen Dienenden und Herrschaften, dass in anderen Berufszweigen schon lange liberalisiert wurde. Deshalb soll der Behauptung nachgegangen werden, dass die Gesindeordnungen den Beruf des „Mädchens für Alles“ künstlich aufrecht erhalten haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Wandel von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft
- Dienstleistungsberufe in der Geschichte
- Die Dienstbaren Geister des „langen 19. Jahrhunderts“
- Der häusliche Dienst wird zum typischen Frauenberuf
- Der Weg vom Land in die Stadt
- Arbeiten und Leben der Dienstmädchen im bürgerlichen Haushalt
- Die Arbeit im Haus
- Die Arbeitszeit
- Die Entlohnung
- Die Unterbringung und Verpflegung
- Gesindeordnungen, Dienstbotenbücher und andere Reglementierungswerke
- Didaktische Analyse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Lebens- und Arbeitsbedingungen häuslicher Dienstboten, insbesondere von Dienstmädchen um die Jahrhundertwende. Ziel ist es aufzuzeigen, wie diese gesellschaftliche Gruppe den Prozess der Verstädterung während der Industrialisierung prägte und als Vorboten der Dienstleistungsgesellschaft verstanden werden können. Dabei wird der Wandel von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft analysiert und der Unterschied zwischen landwirtschaftlichem Gesinde und Dienstboten beleuchtet.
- Wandel von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft
- Lebens- und Arbeitsbedingungen von Dienstmädchen
- Die Rolle der Gesindeordnungen
- Der Dienstmädchenberuf als typischer Frauenberuf
- Didaktische Umsetzung der Forschungsergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit befasst sich mit den Lebens- und Arbeitsbedingungen häuslicher Dienstboten um die Jahrhundertwende, insbesondere Dienstmädchen. Sie untersucht deren Einfluss auf die Verstädterung während der Industrialisierung und die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft. Die Arbeit analysiert den Wandel von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft und den Unterschied zwischen landwirtschaftlichem Gesinde und Dienstboten. Die These ist, dass Dienstmädchen als Vorboten der Dienstleistungsgesellschaft gelten können, obwohl Dienen ein Phänomen aller Zeiten ist. Die Arbeit untersucht die Anziehungskraft des Berufes, die Erwartungen der Mädchen und die Realität, ihre Beziehungen zu den Herrschaften, sowie Arbeitszeit, Entlohnung und Unterbringung. Gesindeordnungen werden als ein wichtiger Faktor für die Abhängigkeit der Dienstboten betrachtet.
Der Wandel von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft: Dieses Kapitel beschreibt den Strukturwandel von einer Agrar- zu einer Dienstleistungsgesellschaft. Es erläutert die „Drei-Sektoren-Theorie“ von Fourastié/Clark, die den Schwerpunktverschiebung von der Primärproduktion (Landwirtschaft) über die Sekundärproduktion (Industrie) zum Tertiärsektor (Dienstleistungen) beschreibt. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt, das Bevölkerungswachstum und das zunehmende Produktivvermögen werden als Hauptfaktoren für diesen Wandel identifiziert. Der steigende Wohlstand, besonders im aufstrebenden Bürgertum, führte zu einer erhöhten Nachfrage nach Dienstleistungen, zunächst im häuslichen Bereich, später in der gesamten Volkswirtschaft. Kleinere Familienstrukturen verstärkten diese Nachfrage. Die Dienstmädchen werden als Beispiel für diese Entwicklung dargestellt.
Schlüsselwörter
Dienstmädchen, Dienstleistungsgesellschaft, Agrargesellschaft, Industrialisierung, Verstädterung, Gesindeordnungen, Frauenberuf, Arbeitsbedingungen, Lebensumstände, 19. Jahrhundert, soziale Geschichte, Didaktik.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Lebens- und Arbeitsbedingungen häuslicher Dienstboten um die Jahrhundertwende
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Lebens- und Arbeitsbedingungen häuslicher Dienstboten, insbesondere von Dienstmädchen, um die Jahrhundertwende. Sie analysiert deren Rolle im Prozess der Verstädterung während der Industrialisierung und betrachtet sie als Vorboten der Dienstleistungsgesellschaft.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt den Wandel von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft, die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Dienstmädchen (Arbeit im Haus, Arbeitszeit, Entlohnung, Unterbringung, Beziehungen zu den Arbeitgebern), die Bedeutung von Gesindeordnungen, den Dienstmädchenberuf als typischen Frauenberuf und die didaktische Umsetzung der Forschungsergebnisse. Der Fokus liegt auf dem Vergleich zwischen landwirtschaftlichem Gesinde und Dienstboten.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine sozialhistorische Analyse der Lebens- und Arbeitsbedingungen von Dienstmädchen. Sie bezieht sich auf die „Drei-Sektoren-Theorie“ von Fourastié/Clark zur Beschreibung des Strukturwandels von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft. Die Analyse umfasst die Betrachtung von Faktoren wie Arbeitszeit, Entlohnung, Unterbringung und die Rolle von Gesindeordnungen.
Welche zentralen Thesen werden vertreten?
Die zentrale These ist, dass Dienstmädchen als Vorboten der Dienstleistungsgesellschaft betrachtet werden können, obwohl Dienen ein Phänomen aller Zeiten ist. Die Arbeit untersucht die Anziehungskraft des Berufes für die Mädchen, die Erwartungen im Vergleich zur Realität, und die Rolle von Gesindeordnungen als Faktor für die Abhängigkeit der Dienstboten.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit beinhaltet eine Einleitung, ein Kapitel zum Wandel von der Agrar- zur Dienstleistungsgesellschaft, ein Kapitel über Dienstleistungsberufe in der Geschichte mit einem Fokus auf den häuslichen Dienst, eine didaktische Analyse und ein Fazit. Ein besonderer Fokus liegt auf den Lebens- und Arbeitsbedingungen der Dienstmädchen im bürgerlichen Haushalt des späten 19. Jahrhunderts.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Dienstmädchen, Dienstleistungsgesellschaft, Agrargesellschaft, Industrialisierung, Verstädterung, Gesindeordnungen, Frauenberuf, Arbeitsbedingungen, Lebensumstände, 19. Jahrhundert, soziale Geschichte, Didaktik.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die Lebens- und Arbeitsbedingungen häuslicher Dienstboten aufzuzeigen und deren Bedeutung für den Prozess der Verstädterung während der Industrialisierung und die Entwicklung zur Dienstleistungsgesellschaft zu analysieren.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Studierende der Sozialwissenschaften, Geschichte, Wirtschaftswissenschaften und Didaktik, die sich mit der Sozialgeschichte des 19. Jahrhunderts, der Entwicklung der Dienstleistungsgesellschaft und der Geschichte der Frauenarbeit beschäftigen.
- Quote paper
- Christian Tischner (Author), 2004, Dienstmädchen im 19. Jahrhundert, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59244