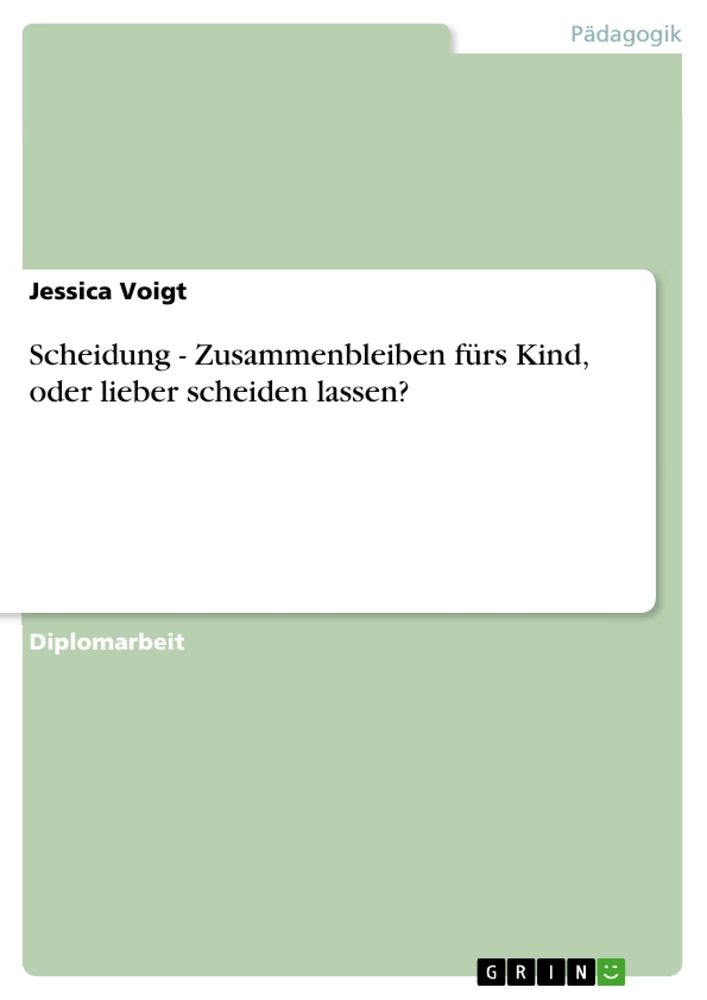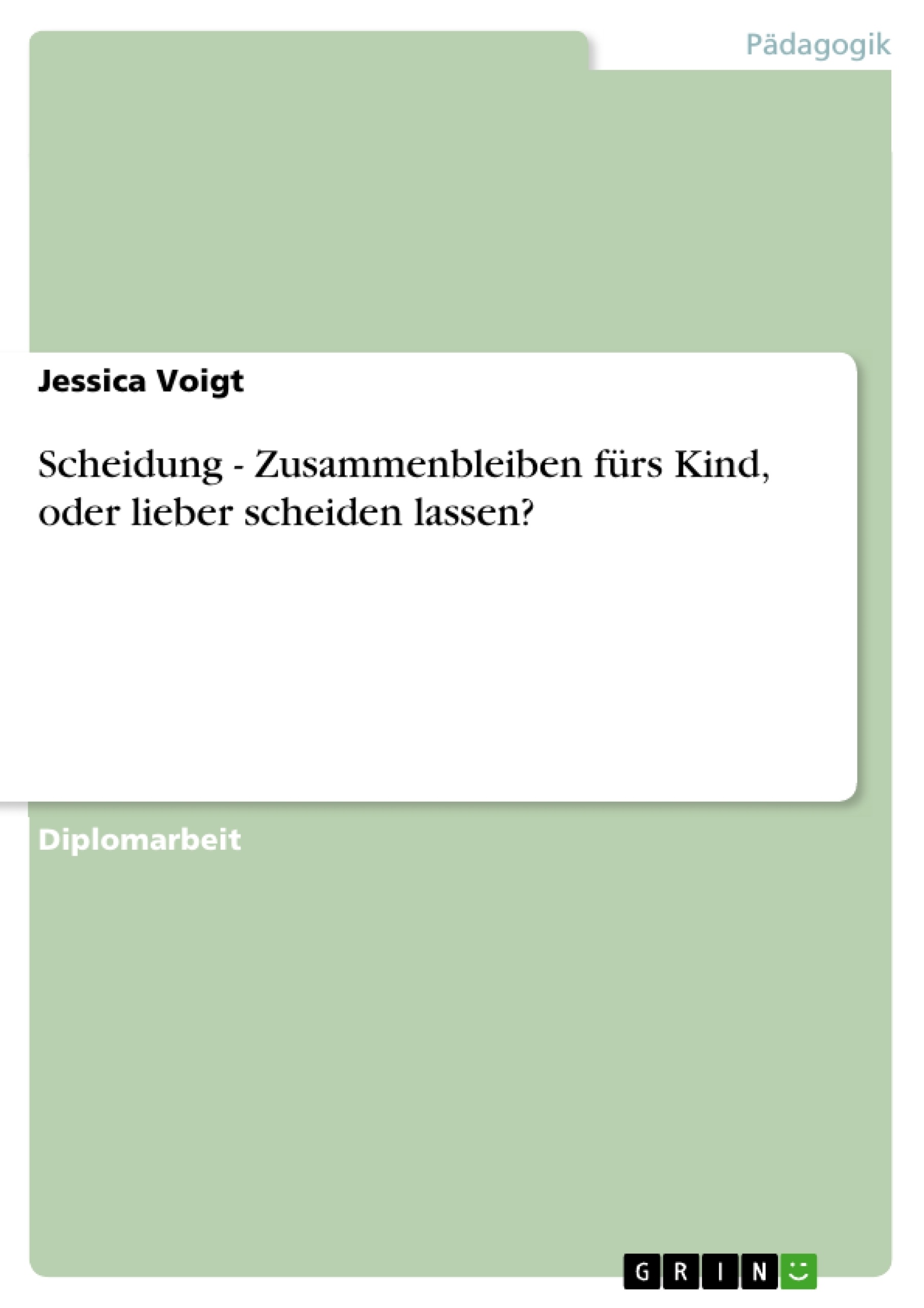Jährlich geben sich mehrere Tausend Paare beim Standesamt und in der Kirche das „Ja-Wort“. Sie schwören sich die Treue und versprechen sich ein gemeinsames Leben, „bis dass der Tod sie scheidet“.
Die Ehe ist zwar inzwischen nicht mehr als ausschließliche Form des Zusammenlebens, erfreut sie sich aber nach wie vor großer Beliebtheit. Neben dem einfachen Zusammenleben ohne Trauschein entscheiden sich „drei von vier Personen mindestens einmal in ihrem Leben“ für eine Heirat.
Die Ehe ist in unserer Kultur inzwischen keine bloße Zweckgemeinschaft mehr, wie noch bis Anfang des 20. Jahrhunderts, sondern ist zu einer frei wählbaren und individuell gestaltbaren Lebensform geworden. Hier ist niemand mehr irgendwelchen Heiratszwängen unterworfen und jeder kann die Ehe mit dem Partner, bzw. der Partnerin seiner Wahl eingehen.
Bei einem Drittel der Paare erfüllen sich allerdings die Glückserwartungen, die dabei aneinander gestellt werden nicht. Gerade weil die Ehe in der modernen Gesellschaft nicht mehr aus Zweckgründen geschlossen und dadurch zusammengehalten wird, ist eine Scheidung oft schnell vorherzusehen, wenn ein Ehepartner den Erwartungen des anderen nicht genügend nachkommt.
Das Fundament einer Ehe sollte ewige Treue sein, doch nur wenige Ehen halten tatsächlich ein Leben lang. „Aufgrund der derzeitigen Scheidungsquoten ist damit zu rechnen, dass ca. 14% der ehelich geborenen Kinder damit rechen müssen, dass ihre Eltern sich scheiden lassen werden, bevor sich selbst das 15. Lebensjahr erreicht haben. Wie viele ehelich geborene Kinder von einer Trennung ihrer Eltern ohne gerichtliche Scheidung und wie viele nicht ehelich geborenen Kinder von Eltern, die in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft leben, von deren Trennung betroffen sind, lässt sich nicht exakt feststellen.“
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Einführung
- 1.2 Definition von Familie
- 1.3 Die Stellung der Familie in der heutigen Zeit
- 1.4 Verschiedene Formen von Familie
- 1.5 Die Bedeutung der Familie für das Kind
- 2. Statistik
- 2.1 Ehe- und Scheidungszahlen Deutschlands
- 2.2 Ehe- und Scheidungszahlen Nordrhein-Westfalens
- 3. Familiale Krisen und Konflikte
- 3.1 Das ABC-X Modell von Reuben Hill
- 3.2 Krisenbewältigung
- 4. Lösungsversuche der Familien
- 4.1 Ignoranz der Konflikte
- 4.2 „Zusammenraffen“ & Kompromisse eingehen
- 4.3 Ehe- und Paarberatung
- 4.4 Trennung auf Zeit
- 4.5 Scheidung
- 4.5.1 Scheidungszyklus (Phasen)
- 4.5.1.1 Vorscheidungsphase / Ambivalenzphase
- 4.5.1.2 Trennungsphase / Scheidungsphase
- 4.5.1.3 Nachscheidungsphase
- 4.5.1 Altersspezifische Reaktionen des Kindes
- 5. Positive Aspekte der Scheidung
- 6. Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten für die Kinder
- 6.1 Hilfen durch die Eltern
- 6.2 Hilfen in der Schule
- 6.3 Mediation
- 6.4 Bücher für Kinder und Jugendliche
- 6.5 Beratungsstellen
- 6.5.1 Ziele der Beratungsarbeit
- 6.5.2 Ebenen in der Beratungsarbeit
- 6.5.3 Beratung in den Scheidungs-Phasen
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Auswirkungen von Streitigkeiten zwischen Eltern und Ehescheidungen auf Kinder. Die Arbeit zielt darauf ab, verschiedene Aspekte der familiären Krisenbewältigung, die Reaktionen von Kindern auf Scheidungssituationen und die verfügbaren Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten zu beleuchten.
- Auswirkungen von Elternkonflikten auf Kinder
- Der Scheidungsprozess und seine Phasen
- Altersspezifische Reaktionen von Kindern auf Scheidung
- Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Kinder
- Positive Aspekte von Scheidung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses einleitende Kapitel liefert eine allgemeine Einführung in das Thema Scheidung und seine Relevanz in der heutigen Gesellschaft. Es definiert den Begriff Familie aus verschiedenen Perspektiven und beleuchtet die Bedeutung der Familie für die kindliche Entwicklung. Die steigenden Scheidungsraten und deren Auswirkungen auf Kinder werden kurz angesprochen, um den Kontext der Arbeit zu etablieren. Die Kapitel legen die Grundlage für die tiefergehende Auseinandersetzung mit den Auswirkungen von Scheidung auf die betroffenen Kinder.
2. Statistik: Kapitel 2 präsentiert statistische Daten zu Ehe- und Scheidungszahlen in Deutschland und Nordrhein-Westfalen. Diese Daten dienen als empirische Grundlage und veranschaulichen das Ausmaß des Problems. Die statistischen Zahlen liefern ein objektives Bild der Häufigkeit von Ehescheidungen und bieten eine wichtige Kontextualisierung für die folgenden Kapitel, die sich mit den Auswirkungen dieser Entwicklung auf Familien und insbesondere Kinder auseinandersetzen.
3. Familiale Krisen und Konflikte: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Arten von familiären Krisen und Konflikten, die zu einer Trennung oder Scheidung führen können. Es wird das ABC-X-Modell von Reuben Hill vorgestellt, um die Dynamik solcher Krisen zu verdeutlichen. Des Weiteren werden wichtige Konzepte der Krisenbewältigung in Familien beleuchtet. Das Kapitel schafft somit ein Verständnis für die komplexen Faktoren, die zu einer Belastung der Familien führen und somit die Grundlage für die nachfolgenden Kapitel schaffen.
4. Lösungsversuche der Familien: Kapitel 4 erörtert verschiedene Strategien und Lösungsversuche von Familien, um mit Konflikten umzugehen, die zum Scheitern der Ehe führen können. Es werden verschiedene Lösungsansätze, von Ignoranz über Kompromisse bis hin zur Paarberatung und Trennung auf Zeit, diskutiert. Der Schwerpunkt liegt hier auf dem Scheidungsprozess selbst, der in verschiedene Phasen unterteilt und detailliert beschrieben wird. Die Perspektive des Kindes während der verschiedenen Phasen wird dabei berücksichtigt. Das Kapitel bietet einen umfassenden Überblick über den Prozess, der für Familien schwierig zu bewältigen sein kann und bietet somit ein tiefes Verständnis der Herausforderungen.
5. Positive Aspekte der Scheidung: Im Gegensatz zu den vorhergehenden Kapiteln, die sich vorwiegend mit den negativen Aspekten auseinandersetzen, beleuchtet Kapitel 5 positive Aspekte, die mit einer Scheidung einhergehen können. Hier wird auf die potenziellen Vorteile einer Trennung eingegangen, wenn die Beziehung der Eltern von andauernden Konflikten geprägt ist. Es werden Situationen beschrieben, in denen eine Trennung zum Wohl des Kindes beitragen kann und positive Entwicklungen ermöglicht.
6. Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten für die Kinder: Das Kapitel beschreibt verschiedene Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder aus geschiedenen Familien. Es werden die Rolle der Eltern, der Schule, Mediation, Bücher und Beratungsstellen im Umgang mit diesen Herausforderungen erörtert. Die Kapitel zeigen die vielfältigen Möglichkeiten und Ressourcen auf, welche betroffenen Kindern und ihren Familien zur Verfügung stehen. Das Kapitel betont die Wichtigkeit von Unterstützung für den Umgang mit den emotionalen, sozialen und psychischen Folgen.
Schlüsselwörter
Scheidung, Familie, Kinder, Elternkonflikt, Krisenbewältigung, Scheidungsprozess, Hilfsangebote, Kindeswohl, Trennung, Paarberatung, Mediation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Auswirkungen von Scheidungen auf Kinder
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Auswirkungen von Streitigkeiten zwischen Eltern und Ehescheidungen auf Kinder. Sie beleuchtet verschiedene Aspekte der familiären Krisenbewältigung, die Reaktionen von Kindern auf Scheidungssituationen und die verfügbaren Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten.
Welche Themen werden im Einzelnen behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem die Auswirkungen von Elternkonflikten auf Kinder, den Scheidungsprozess mit seinen verschiedenen Phasen, altersspezifische Reaktionen von Kindern auf Scheidung, Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten für betroffene Kinder und positive Aspekte von Scheidung.
Welche Kapitelstruktur hat die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Einleitung (mit Definition von Familie und deren Bedeutung), Statistik (Ehe- und Scheidungszahlen), Familiäre Krisen und Konflikte (inkl. ABC-X-Modell), Lösungsversuche der Familien (Ignoranz, Kompromisse, Beratung, Trennung, Scheidung mit Phasen und altersspezifische Reaktionen des Kindes), Positive Aspekte der Scheidung, Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder (Eltern, Schule, Mediation, Bücher, Beratungsstellen) und Fazit.
Wie wird der Scheidungsprozess dargestellt?
Der Scheidungsprozess wird in verschiedene Phasen unterteilt: Vorscheidungsphase/Ambivalenzphase, Trennungsphase/Scheidungsphase und Nachscheidungsphase. Die Arbeit beschreibt diese Phasen detailliert und berücksichtigt die Perspektive des Kindes während dieser Phasen.
Welche Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten für Kinder werden beschrieben?
Die Arbeit beschreibt diverse Hilfs- und Unterstützungsmöglichkeiten, darunter Hilfen durch die Eltern, Hilfen in der Schule, Mediation, Bücher für Kinder und Jugendliche sowie Beratungsstellen. Die Ziele und Ebenen der Beratungsarbeit und die Beratung in den verschiedenen Scheidungsphasen werden ebenfalls erläutert.
Welche statistischen Daten werden verwendet?
Die Arbeit präsentiert statistische Daten zu Ehe- und Scheidungszahlen in Deutschland und Nordrhein-Westfalen, um das Ausmaß des Problems zu veranschaulichen und die folgenden Kapitel zu kontextualisieren.
Welche Modelle oder Theorien werden verwendet?
Die Arbeit verwendet das ABC-X-Modell von Reuben Hill, um die Dynamik familiärer Krisen zu verdeutlichen.
Gibt es auch positive Aspekte von Scheidung?
Ja, die Arbeit beleuchtet auch positive Aspekte von Scheidung, beispielsweise in Situationen, in denen eine Trennung zum Wohl des Kindes beiträgt und positive Entwicklungen ermöglicht, wenn die Elternbeziehung von andauernden Konflikten geprägt ist.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Scheidung, Familie, Kinder, Elternkonflikt, Krisenbewältigung, Scheidungsprozess, Hilfsangebote, Kindeswohl, Trennung, Paarberatung, Mediation.
- Quote paper
- Jessica Voigt (Author), 2005, Scheidung - Zusammenbleiben fürs Kind, oder lieber scheiden lassen?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59239