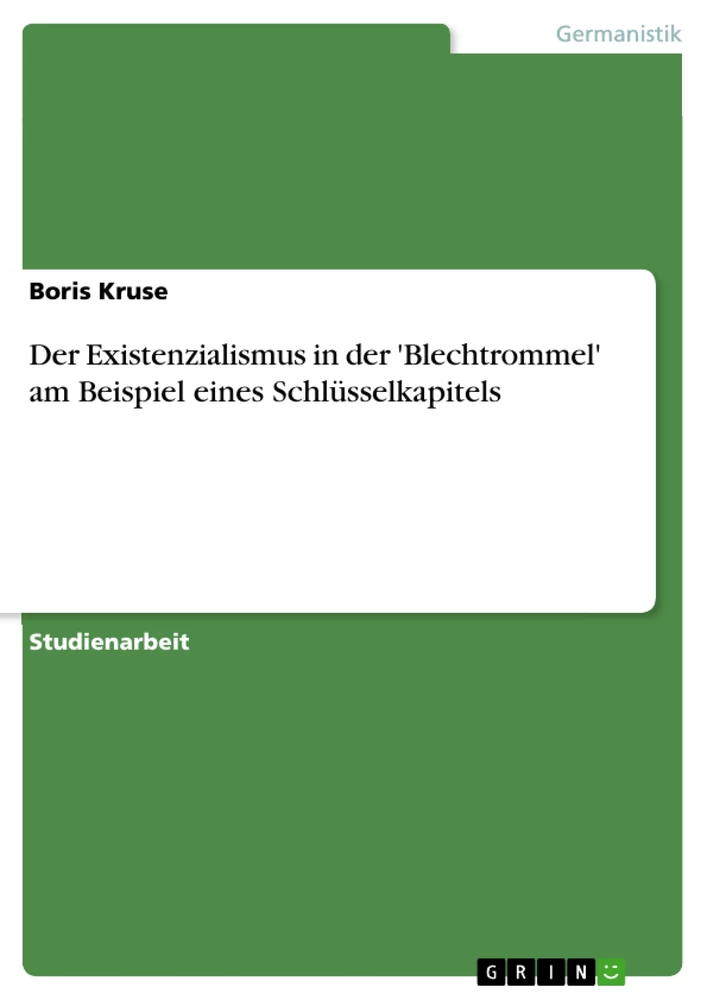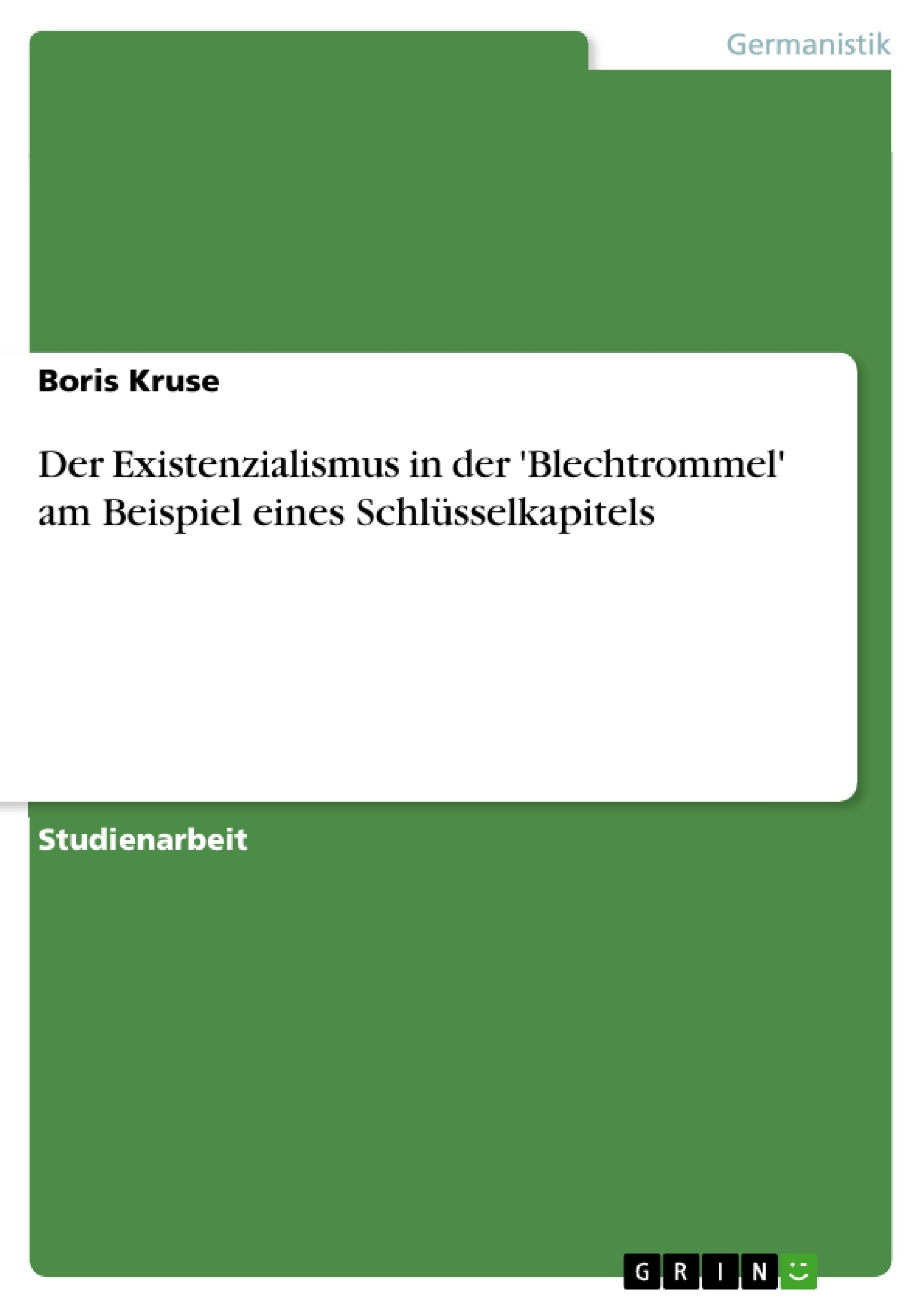In Günter Grass` Debüt- Roman„Die Blechtrommel“,erschienen 1959, nimmt das Kapitel„Glaube, Hoffnung, Liebe“eine besondere Stellung ein. Zum einen sticht es durch formalistische Auffälligkeiten, d.h. durch eine strenge Komposition, hervor. Zum anderen stellt dieses Kapitel einen Schlüssel zum Verständnis der Aussage des gesamten Werkes dar. Insbesondere offenbart sich hier die Handlungsmotivation des Protagonisten Oskar Matzerath und dessen Einstellung zur Umwelt. In den folgenden Ausführungen wird sich das Augenmerk zunächst auf die formalen Aspekte und die Grundzüge der erzählten Handlung im besagten Kapitel richten. Hierbei soll ob der interessanten Textgestaltung und der virtuosen sprachlichen Aspekte gezielt nah am Text verfahren werden. Von großer Bedeutung für die Entwicklung der hier vertretenen Argumentation war die Kapitel- Interpretation von Irmela Schneider. Gleichwohl soll dabei eine mögliche Deutung der Aussage dieses Kapitels in Hinblick auf den wesentlichen erzählerischen Gegenstand der Blechtrommel, die Zeit des Nazi- Regimes in Deutschland und dessen Folgen für die deutsche Gesellschaft, angeboten werden. Davon ausgehend wird sich schließlich der philosophisch- weltanschauliche Hintergrund der„Blechtrommel“eröffnen. Auch dieser Teil wäre in der vorliegenden Form nicht ohne die Anregungen einer weiteren Arbeit zustande gekommen, und zwar ist dies Volker Neuhaus` Essay, der sich mit dem Christentum im Werk Günter Grass` auseinandersetzt2. Im Verlaufe der Beschäftigung mit dem Text drängte sich der Eindruck auf, daß insbesondere im hier verhandelten Kapitel der Zusammenhang zwischen der inhaltlichen und der textgestalterischen Ebene sehr eng ist und es daher eine genaue Lektüre verdient.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Das Kapitel „Glaube Hoffnung Liebe“
- 1. Es war einmal...
- 2. Glaube, Liebe, Hoffnung
- 3. Die Märchenstruktur
- III. Oskars skeptischer Ästhetizismus
- IV. Schlußbemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit analysiert das Kapitel „Glaube, Hoffnung, Liebe“ aus Günter Grass’ Roman „Die Blechtrommel“. Dabei wird zunächst die formale Gestaltung des Kapitels untersucht, um anschließend dessen Bedeutung für die Gesamtinterpretation des Romans zu erörtern.
- Formale Aspekte des Kapitels „Glaube, Hoffnung, Liebe“
- Oskars Handlungsmotivation und Einstellung zur Umwelt
- Das Kapitel als Schlüssel zum Verständnis der Aussage des Romans
- Der philosophisch-weltanschauliche Hintergrund der „Blechtrommel“
- Der Zusammenhang zwischen inhaltlicher und textgestalterischer Ebene
Zusammenfassung der Kapitel
Das Kapitel „Glaube, Hoffnung, Liebe“ zeichnet sich durch eine strenge Komposition und die Verwendung einer Märchenstruktur aus. Oskar Matzerath, der Protagonist des Romans, erzählt die Geschichte des Trompeters Meyn in Form von zwölf kleinen Märchen. Diese Märchen werden von Oskar interpretiert und in ihren Kontext eingebettet, wodurch die Handlungsmotivation des Protagonisten und dessen Einstellung zur Umwelt deutlich werden. Die Erzählung beschreibt Meyns Beitritt zur SA und seine damit verbundene Entfremdung von seiner ursprünglichen Lebensweise. Das Kapitel zeichnet ein komplexes Bild der politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse in Deutschland während des Nazi-Regimes und bietet Einblicke in die philosophischen und weltanschaulichen Grundlagen der „Blechtrommel“.
Schlüsselwörter
Die Analyse des Kapitels „Glaube, Hoffnung, Liebe“ fokussiert auf Themen wie formale Gestaltung, Handlungsmotivation, Einstellung zur Umwelt, politische und gesellschaftliche Verhältnisse im Nazi-Regime, philosophisch-weltanschauliche Hintergründe, Märchenstruktur, erzählerische Gestaltung und Textinterpretation. Der Roman „Die Blechtrommel“ wird als Ganzes betrachtet, wobei die Analyse des Kapitels als Schlüssel zum Verständnis der Gesamtaussage des Werkes dient.
- Quote paper
- Boris Kruse (Author), 2000, Der Existenzialismus in der 'Blechtrommel' am Beispiel eines Schlüsselkapitels, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/59208