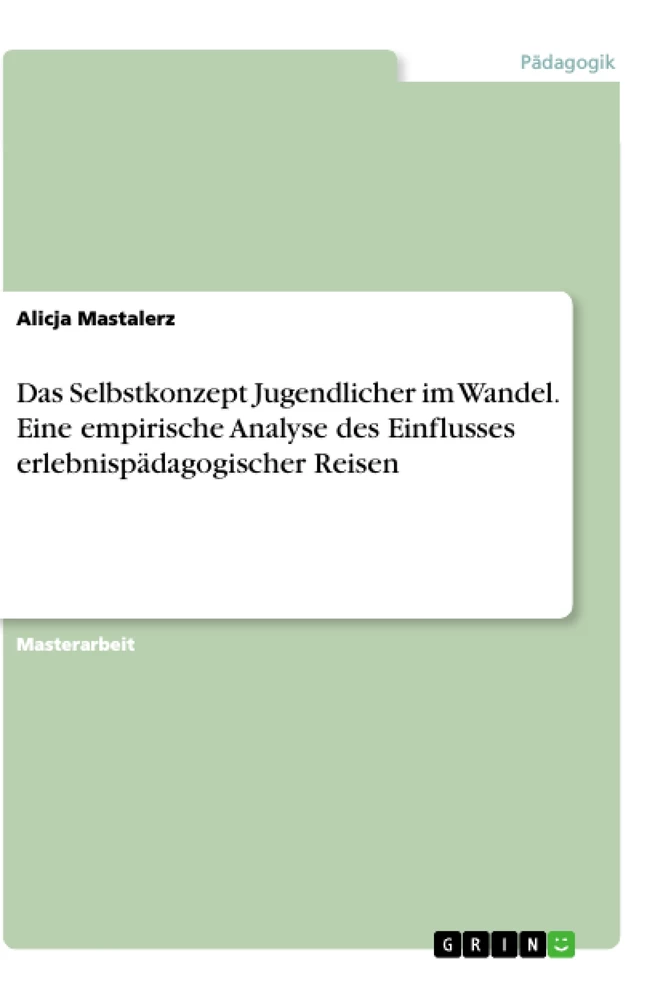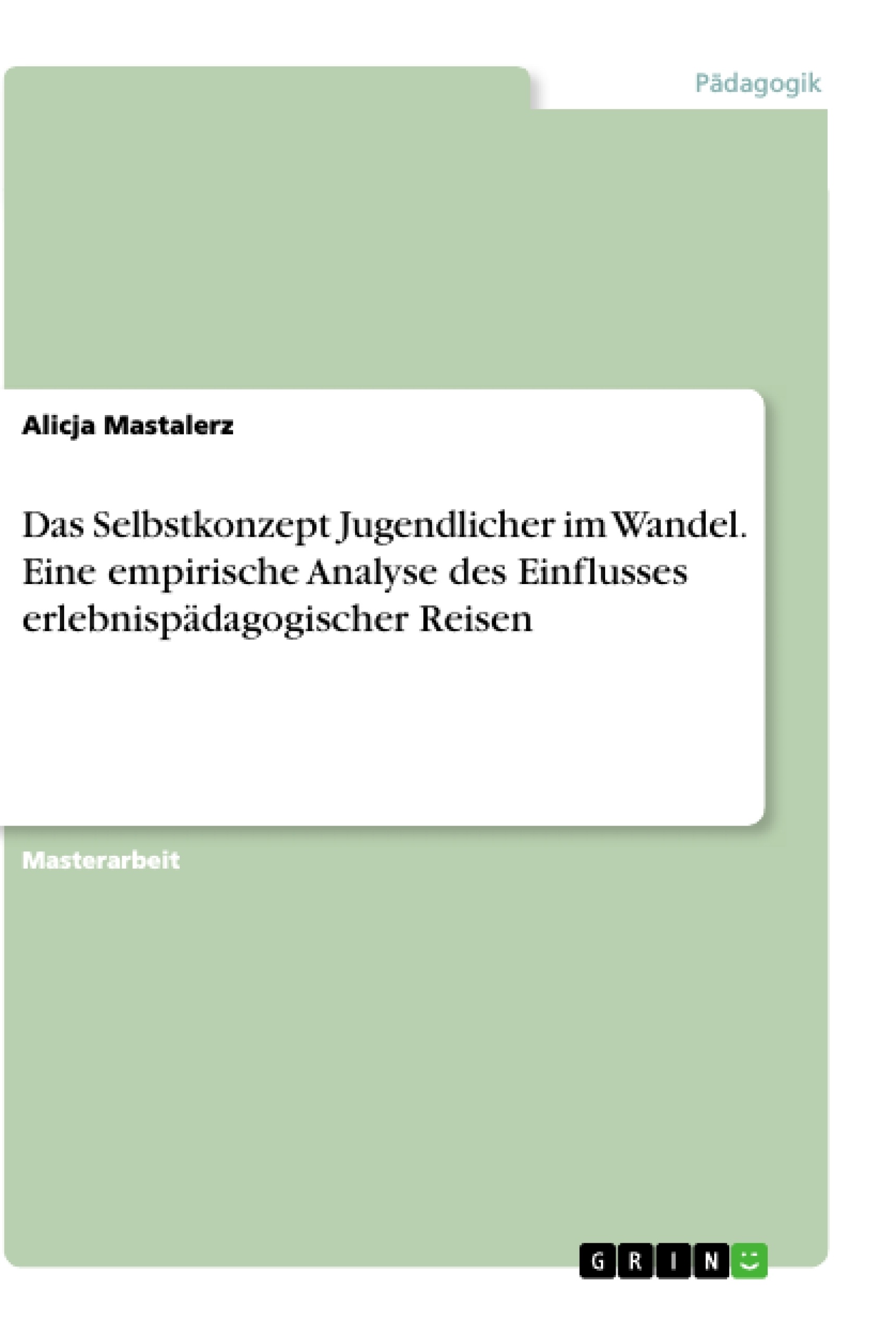Die Zusammenhänge zwischen erlebnispädagogischen Settings und dem schulischen Selbstkonzept von Jugendlichen sind bislang wenig erforscht. Um diese Forschungslücke zu schließen, setzt sich die vorliegende Masterarbeit die Exploration dieser Einflüsse zum Ziel.
Zunächst wird der Forschungsstand zum Selbstkonzept und zur Erlebnispädagogik aus Sicht der Entwicklungspsychologie und Pädagogik theoretisch beleuchtet. Anschließend wird eine empirische Untersuchung der Einflüsse einer exemplarischen erlebnispädagogischen Schulreise durchgeführt. Dazu wurde ein Test in Form eines skalierten Fragebogens (SESSKO, Schöne et al. 2012) gewählt und empirische Daten von 25 Jugendlichen erhoben und analysiert. Die qualitative Subuntersuchung umfasst zwei Fallbeispiele. Alle Testpersonen, Schülerinnen und Schüler im Alter von 13 bis 14 Jahren, waren Teil des erlebnispädagogischen Schulprojekts. Der gewählte Fragebogen wurde zu drei Messzeit-punkten durchgeführt. Einmal vor der Reise, einmal direkt nach der Reise und schließlich mehrere Wochen danach, um die Langzeiteffekte zu messen. Die erhobenen Daten werden im Rahmen dieser Arbeit auf Signifikanz untersucht, die Ergebnisse analysiert und diskutiert.
Die gemessenen Resultate können aufgrund komplexer, multidimensionaler Wirkweisen der Erlebnispädagogik erklärt und vor diesem Hintergrund interpretiert werden. Entsprechende Erklärungshypothesen für die Ergebnisse werden in der Arbeit angeboten. Da das schulische Selbstkonzept des Menschen ein Prädikator für den individuellen Schulerfolg ist, ist die vorliegende Masterarbeit für Studierende und Lehrende in der Pädagogik und Sonderpädagogik relevant und bietet nützliche Implikationen für die erlebnispädagogische Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Selbst und Selbstkonzept
- Forschungsstand Selbst und Selbstkonzept
- Ursprünge der Selbst-Forschung
- Moderne Selbst-Forschung
- Dimensionen des Selbstkonzepts
- Selbstkonzeptentwicklung und -modifikation
- Selbstkonzeptbildung im Jugendalter
- Stabilität des Selbstkonzepts
- Schulisches Fähigkeitsselbstkonzept
- Geschlechtsspezifische Unterschiede
- Einfluss der Schule auf das Selbstkonzept
- Modelle der Selbstkonzeptforschung
- Determinationsrichtungen
- Erlebnispädagogik und schulische Langzeitprojekte
- Forschungsstand Erlebnispädagogik
- Erlebnispädagogische Settings
- Potentiale der Erlebnispädagogik
- Grenzen der Erlebnispädagogik
- Schulische Langzeitprojekte
- Wirkweisen von Erlebnispädagogik auf das Selbstkonzept
- Merkmale einer gelungenen Erlebnispädagogik
- Praktische Umsetzung
- Forschungsstand Erlebnispädagogik
- Langzeitprojekt „Elbsandsteingebirge“
- Reisegruppe
- Projektvorbereitung
- Projektdurchführung
- Projektnachbereitung
- Projektziele
- Erlebnispädagogische Herausforderungen und Sozialverhalten
- Fallbeispiel
- Barbara
- Can
- Empirische Forschungsmethoden
- Methoden der Selbstkonzeptforschung
- Probleme bei der Erforschung von Selbstkonzepten
- Forschungsinstrumente
- Wahl des Messinstruments
- Messinstrument SESSKO
- Aufbau des Messinstruments
- Gütekriterien
- Durchführung
- Auswertung
- Interpretation
- Kritik des Messinstruments
- Methoden der Selbstkonzeptforschung
- Forschungsdesign
- Grundannahme zur Wirkweise von Erlebnispädagogik
- Durchführung
- Auswertung I: Normwerttabellen
- Auswertung II: SPSS - Wilcoxon Test
- Ergebnisse
- Ergebnisse auf Klassenebene
- Auswertung I: SPSS - Daten
- Zusammenfassung der Ergebnisse
- Fallbeispiele
- Barbara
- Can
- Ergebnisse auf Klassenebene
- Diskussion
- Beantwortung der Forschungsfrage
- Diskussion der methodischen Aspekte
- Messinstrument
- Messzeitpunkte
- Aussagekraft der Ergebnisse
- Länge des Projekts
- Alter der Probanden
- Geschlechteridentitäten
- Antworttendenz und Soziale Erwünschtheit
- Reaktanz und Selbstverifikation
- Diskussion der Fallbeispiele
- Barbara
- Can
- Diskussion der Ergebnisse auf Klassenebene
- Wirkungslosigkeit des Projekts
- Indirekte Wirkweise
- Multikausale Wirkweise
- Interpretation
- Implikationen für erlebnispädagogische Schulprojekte
- Implikationen für die (sonder-)pädagogische Praxis
- Ausblick
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Masterarbeit untersucht den Einfluss von erlebnispädagogischen Reisen auf das Selbstkonzept von Jugendlichen. Sie will die Zusammenhänge zwischen erlebnispädagogischen Settings und dem schulischen Selbstkonzept von Jugendlichen beleuchten und die Forschungslücke in diesem Bereich schließen.
- Das Selbstkonzept von Jugendlichen und seine Entwicklung im Jugendalter
- Erlebnispädagogik als pädagogisches Konzept und ihre Anwendung in Schulprojekten
- Der Einfluss von erlebnispädagogischen Reisen auf das schulische Selbstkonzept
- Die Analyse von empirischen Daten aus einem Langzeitprojekt mit erlebnispädagogischen Reisen
- Implikationen für die erlebnispädagogische Praxis und die (sonder-)pädagogische Arbeit
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Masterarbeit ein und erläutert die Forschungsfrage und die Relevanz der Untersuchung.
Selbst und Selbstkonzept: Dieses Kapitel beleuchtet den Forschungsstand zum Selbst und Selbstkonzept in der Entwicklungspsychologie und Pädagogik. Es werden verschiedene Dimensionen des Selbstkonzepts, die Entwicklung des Selbstkonzepts im Jugendalter sowie der Einfluss der Schule auf das Selbstkonzept betrachtet.
Erlebnispädagogik und schulische Langzeitprojekte: Dieses Kapitel beleuchtet den Forschungsstand der Erlebnispädagogik und ihre Anwendung in schulischen Langzeitprojekten. Es werden die Potentiale und Grenzen der Erlebnispädagogik sowie die Wirkweisen von erlebnispädagogischen Projekten auf das Selbstkonzept untersucht.
Langzeitprojekt „Elbsandsteingebirge“: Dieses Kapitel beschreibt das Langzeitprojekt „Elbsandsteingebirge“, welches Gegenstand der empirischen Untersuchung ist. Es werden die Reisegruppe, die Projektvorbereitung und -durchführung, die Projektziele sowie die erlebnispädagogischen Herausforderungen und das Sozialverhalten der Jugendlichen während des Projekts erläutert.
Empirische Forschungsmethoden: Dieses Kapitel erläutert die empirischen Methoden, die zur Untersuchung des Einflusses von erlebnispädagogischen Reisen auf das Selbstkonzept von Jugendlichen eingesetzt wurden. Es werden das gewählte Messinstrument, der SESSKO-Fragebogen, sowie die Durchführung der Untersuchung und die Auswertung der erhobenen Daten beschrieben.
Forschungsdesign: Dieses Kapitel stellt das Forschungsdesign der Masterarbeit dar und beschreibt die Grundannahme zur Wirkweise von Erlebnispädagogik, die Durchführung der Untersuchung sowie die Auswertung der Daten.
Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung. Es werden die Ergebnisse auf Klassenebene sowie die Ergebnisse der Fallbeispiele dargestellt und analysiert.
Diskussion: Dieses Kapitel diskutiert die Ergebnisse der empirischen Untersuchung und reflektiert die methodischen Aspekte der Studie. Es werden die Beantwortung der Forschungsfrage, die Aussagekraft der Ergebnisse sowie die Diskussion der Fallbeispiele und der Ergebnisse auf Klassenebene erörtert.
Interpretation: Dieses Kapitel interpretiert die Ergebnisse der Untersuchung und leitet Implikationen für die erlebnispädagogische Praxis und die (sonder-)pädagogische Arbeit ab.
Schlüsselwörter
Selbstkonzept, Erlebnispädagogik, Schulische Langzeitprojekte, Jugendlicher, Selbstkonzeptentwicklung, Schulisches Fähigkeitsselbstkonzept, Empirische Forschung, SESSKO-Fragebogen, Einflussanalyse, Implikationen
- Citar trabajo
- Alicja Mastalerz (Autor), 2020, Das Selbstkonzept Jugendlicher im Wandel. Eine empirische Analyse des Einflusses erlebnispädagogischer Reisen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/591007